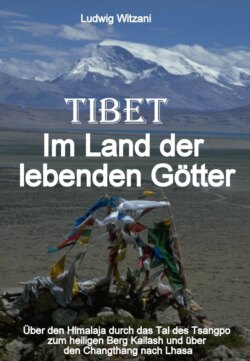Читать книгу Tibet – Im Land der lebenden Götter - Ludwig Witzani - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIV In der Hölle des Milarepa
Es waren Bilder wie nach der Sintflut, als wir am nächsten Morgen den Wagen nach Tibet bestiegen. Die ganze Nacht hatte es wieder geregnet, knöchelhoch stand das Wasser in den Gassen. Das Licht der morgendlichen Tschaifeuer spiegelte sich in den Pfützen, während für die Menschen im Halbdunkel der Toreingänge der Tag begann. An einer Ecke sah ich durch die Fensterscheiben in weit aufgerissene Kinderaugen, Kühe lagen am Rande der Straße, die Abfallhaufen waren mit einem pappigen, feuchten Film überzogen.
Bald hatten wir Kathmandu verlassen, nepalesische Popmusik tönte aus dem Autoradio, als wir die große Ausfallstraße nach Norden erreichten. Unser Fahrer sollte uns heute bis an die chinesische Grenze bringen, jenseits derer wir auf unsere Crew stoßen würden. Es war höchste Zeit, denn spätestens im Juli begann sich das alljährliche Zeitfenster für eine Reise nach Tibet zu schließen. Die Hochlandpässe nach Tibet waren zu dieser Jahreszeit eisfrei, doch der Sommermonsun würde schon damit begonnen haben, die Straßenführungen zu unterspülen. Noch zwei Wochen, und die Passage durch den Himalaja wäre ein Hasardspiel. Auch in Tibet würde uns die Geografie die Reiseroute diktieren: das Tal des Tsangpo würden wir gleich nach unserer Ankunft in Tibet so schnell wie möglich nach Westen durchqueren müssen, ehe die Schneeschmelze ihre volle Kraft entfalten und jedes Durchkommen bis zum Kailash unmöglich machen würde. Erst danach würden wir unseren Rückweg über das extrem hoch gelegene Changthang Plateau suchen müssen, um zum Finale unserer Reise das sattgrüne und relativ warme Zentraltibet zu erreichen.
Kurz bevor wir den Arniko Highway, die Straße durch den Himalaja, erreichten, stoppte der Wagen an einer Kreuzung, und zwei Gestalten mit Rucksäcken und Regenumhängen stiegen ein.
„Das sind die Sherpas“, kommentierte unser Fahrer. „Sie steigen schon hier ein. Der Rest der Crew wartet in Zanghmu.“
Frank, der eingeschlafen war, wachte auf und blickte mit halb zugeklebten Augen auf unsere neuen Begleiter. „Hallo“, sagte er müde und drehte sich wieder um. Der ältere der beiden Sherpas stellte sich als Tensing vor. Wie die meisten Nepali trug er seine tiefschwarzen Haare kurzgeschnitten. Er war kräftig gebaut und hatte ein rundliches Gesicht mit großen mandelförmigen Augen, einen sensiblen, weichen Zug um den Mund und eine überraschend tiefe Stimme.
Sein Partner, der Zeltsherpa Mun, sah aus wie ein junger Fuchs mit schrägstehenden Augen. Er wirkte auf mich zerbrechlich und unsicher, und als ich ihm die Hand gab, blickte er an mir vorbei, um sich gleich nach der Begrüßung ganz nach hinten zu setzen. Erst später erfuhr ich, dass unsere Tour Muns erste Reise als Sherpa war, und dass er schon das eine oder andere von der unberechenbaren Launenhaftigkeit der westlichen Kundschaft gehört hatte.
Keine Reise im Himalaja kann ein Erfolg werden, wenn du die falschen Sherpa dabei hast, heißt es irgendwo bei Sven Hedin. Aber woran erkennt man einen guten Sherpa? Von meinen früheren Wanderungen durch Nepal wusste ich nur, dass die guten Sherpas meistens nicht die waren, die viel redeten. Deswegen war es mir ganz recht, dass Tensing und Mun, kaum hatten sie ihre Plätze im Bus gefunden, sich einfach auf ihre Rücksäcke legten und einschliefen.
Inzwischen war die Morgensonne aufgegangen. Die Reisfelder und Wälder links und rechts der Straße schickten ihre nächtliche Feuchtigkeit als Nebelschwaden in den Himmel, so dass unser Fahrzeug wie durch eine endlose Reihe milchigweißer Vorhänge in den erwachenden Tag hineinfuhr. Erst in Dhulikhel wurde die Sicht etwas klarer. Nun hatten sich die Morgennebel zu weißen Wolkenschlangen zusammengeklumpt, die die umliegenden Bergabhänge wie Lametta verzierten. Für wenige Augenblicke hatte sich der Regenvorhang des Sommermonsuns vom Horizont zurückgezogen, um einen Blick auf eine fantastische Märchenwelt zu gestatten: Wie auf eine Familie von Riesen, bei denen der Fernere immer größer ist als der Nähere, mit weißen Fäden verziert, von denen man nicht sagen konnte, ob es Schneefelder oder Wolkenfetzen waren, so blickten wir für eine Sekunde in das feuchte Herz des Himalaja. Eine Unendlichkeit von Reisterassen wurden sichtbar, die einem System zerbrochener Spiegel glichen, die wie Brenngläser das Licht der Sonne reflektierten, wenn sie hier und da für wenige Augenblicke die Wolkendecke durchbrach. Dann schoben sich wieder die Wolken vor das Bild, und alles versank in einem stumpfen blaugrau.
Hinter Dhulikhel begann es wieder zu regnen. Die Straße war nun endgültig zu einer Piste geworden, unbefestigt und zunehmend rutschiger zog sie sich durch die Täler und passierte ein ärmliches Nepali-Dorf nach dem nächsten. Wasserbüffel standen teilnahmslos in einem Reisfeld, eine Mutter, die ihr Kind in einem Korb auf dem Rücken trug, hob die Hand und wollte mitgenommen werden, doch unser Fahrer winkte ab. „Diese Bauern bringen nur Dreck“, sagte er wegwerfend. „Außerdem klauen sie. Sollen sie doch den Bus nehmen.“ Tatsächlich kamen uns manchmal auch Busse entgegen, uralte Gefährte, die wie betrunkene Kolosse auf der glitschigen Straße an uns vorbeifuhren.
So vergingen die Stunden, ohne dass sich am Wetter oder an der Umgebung etwas Wesentliches änderte. Allerdings wurden die Reisefelder seltener, die Dörfer noch eine Spur erbärmlicher. Hinter Balabisa lagen noch die karrengroßen Felsbrocken in der Gegend herum, die beim letzten Steinschlag ins Tal herabgestürzt waren, doch die Straße war notdürftig freigeräumt. Der Fahrer küsste kurz die Ganesh Staue auf seinem Armaturenbrett, blickte die Bergabhänge hoch, an denen wegen des Nebels ohnehin nichts zu sehen war, und gab Gas. Wenn es jetzt krachte, war ohnehin nichts mehr zu machen.
Am frühen Nachmittag erreichten wir den Grenzort Kodari, ein langgezogenes Nest in einer Höhe von knapp 1800 Metern über dem Meeresspiegel. Von alters her nur eine Etappe auf den uralten Salzkarawanenrouten zwischen Tibet nach Nepal, hatte sich Kodari nach der Fertigstellung der Himalajastraße zu einem turbulenten Schnittpunkt der Welten entwickelt. Hier kreuzten sich die Wege von Gurkhas, Sherpas und Newaris, von Uiguren, Chinesen und Tibetern mit denen der wenigen Touristen, die überland nach Tibet reisen wollen. Eigentlich bestand der ganze Ort nur aus einer einzigen Straße, die tagaus tagein von Karren, Lastwagen, Bussen oder Gespannen verstopft war, so dass sich die Annäherung an die nepalesisch-tibetische Grenze etwa nach dem Prinzip einer Kniffel-Aufgabe vollzog: “Bringen Sie den roten Wagen möglichst schnell durch, ohne das die anderen es merken.“ Aber alle merkten es, alle drängelten, schnitten, rangierten und überholten so gut sie konnten, sodass das ineinander verkeilte Chaos immer unentwirrbarer wurde, je mehr wir uns der Grenze näherten.
Auf diese Weise dauerte es geschlagene zwei Stunden, ehe wir die nepalesisch-tibetische Grenze erreichten, eine unscheinbare graue Bogenbrücke, an deren Auffahrt nepalesische und chinesische Grenzbeamte die Reisedokumente kontrollierten. Je schlimmer der Anblick, desto freundlicher der Name, dachte ich, denn dieses Gebilde aus großen Schlaglöchern und fragmentarischen Brüstungen trug den stolzen Namen „Freundschaftsbrücke“.
„Einmal am Tag stürzt die Brücke ein“, spottete unser Fahrer, „hoffentlich nicht gerade dann, wenn wir auf der Brücke sind.“
Tatsächlich hatten wir Glück. Gerade als sich an der Abfertigung nur noch ein einziges Fahrzeug vor uns befand, stürzte urplötzlich und merkwürdig geräuschlos ein ganzes Brückenstück in die Tiefe. Der Zement hatte sich wie Fleisch von den Knochen gelöst, und während die Steine im reißenden Kodari-River unter uns verschwanden, war die Verbindung von Nepal und China auf ein zwei Meter langes Gestängegewirr reduziert.
Wirklich aufzuregen aber schien dieses Malheur jedoch Niemanden. Die Grenzbeamten zuckten nur mit den Schultern, da trat schon die ortsansässige Reparaturkolonne in Aktion. Eine Gruppe wüst aussehender chinesischer Straßenarbeiter erschien mit Zementsäcken, Hacken und Schubkarren und begann übergangslos zu rackern, als ginge es um ihr Leben. In gerademal einer guten Stunde hatten die sechs Wanderarbeiter aus Mörtel, Stangen, breiten Brettern und Schlamm das Loch in der Brücke so notdürftig wieder zugeschüttet, dass es wohl für den Rest des Tages keine Zwischenfälle mehr geben würde.
Die Nepalis beobachteten diese Arbeitsschlacht mit einer Mischung aus Staunen und Belustigung. “Diese Chinesen sind verrückt", sagte ein Lastwagenfahrer. "Sie arbeiten für ein paar Rupien wie die Sklaven.“
Hinter der Grenze befand sich ein großer Parkplatz, die Endstation für alle Fahrzeuge aus Nepal. Während Frank und ich, von Tensing und Mun unterstützt, unser gesamtes Gepäck auf die Ladefläche eines bereitstehenden chinesischen Dongfeng-Lastwagens umräumten, steckte sich unser Fahrer in aller Seelenruhe eine weitere Zigarette an. Ehe ich mich versah, war mein kleiner Rucksack mit meinem Fernglas und meinem MP3-Player verschwunden, Frank schlug einem Uiguren auf die Finger, der sich an seiner Jackentasche zu schaffen machte.
„Schön aufpassen“, rief uns der Fahrer zum Abschied. „Wenn ihr oben ankommt und euere großen Rucksäcke noch habt, könnt Ihr zufrieden sein.“ Mit lässiger Geste winkte er zum Abschied, ehe er wieder in seinen Wagen stieg und zurück nach Kathmandu fuhr.
„Alle Gepäcktücke festhalten“, rief Tensing auf Englisch, als er sich auf unsere Rucksäcke setzte. Wie in einem überfüllten Hühnerkäfig standen, lagen oder hockten einige Dutzend Menschen auf der offenen Ladefläche, als der Truck losfuhr, eine bunt durchmischte Gesellschaft voller Männer, Frauen und Kindern, Reisenden und Händlern, ehrlichen Leuten und Spitzbuben, von denen sich einer mein Fernglas und meinen MP3-Player unter den Nagel gerissen hatte.
Nur wenige Kilometer auf einer rutschigen Piste, aber fast eintausend Höhenmeter trennen die Grenzstation Kodari von Zanghmu, einer Retortenstadt, die die Chinesen wie einen schmutzigen Adlerhorst in einer Höhe von etwa 2.700m in die Abhänge der Berge hineingebaut erbaut hatten. Der Grenzkonvoi aus mehreren Fahrzeugen, der sich wie eine Karawane im Schneckentempo die glitschigen Straßen emporwand, benötigte für diese Strecke fast eine ganze Stunde. Das Kodari Tal mit der baufälligen Freundschaftsbrücke verschwand tief unter uns, und bald sahen wir nur noch die endlose Fahrzeugschlange vor der Grenze wie einen dünnen Faden, der sich im Nebel aufzulösen schien.
Als wir Zanghmu erreichten, herrschte eine Atmosphäre wie in einem Gulag. Regen, Eis und Sturm hatten in Wechsel der Gezeiten den Asphalt von der Straße gerissen, und als wäre das nicht genug, riss ein fanatischer Maschinenführer gleich neben der Grenzstation am Steuerknüppel einer riesenhaften Bulldozermaschine ganze Felsen, Wurzeln und Bäume aus den Eingeweiden des Berges. Wieder goss es wie aus Kübeln, so dass wir eine halbe Stunde im Regen warten mussten, ehe die chinesischen Grenzbeamten sich dazu bequemten, aus ihrem Häuschen zu kommen.
Das Zanghmu Hotel war wie die Stadt, ein Haufen Müll in den Wolken. Die Kabel hingen aus den Wänden, die Teppiche waren feucht, die Matratzen so verwanzt, dass wir sofort unsere Schlafsäcke auspackten. Obwohl es regnete, als stünde das jüngste Gericht unmittelbar bevor, gab es im ganzen Hotel kein fließendes Wasser. In den Toiletten schissen die Gäste einfach auf die Würste ihrer unmittelbaren Vorgänger oder pinkelten in hohem Bogen aus dem Fenster hinaus. Ein unbeschreiblicher Gestank zog durch die Gänge, so dass wir nur das Gepäck deponierten, die Kleidung wechselten und so schnell wie möglich das Hotel verließen.
Aber offenbar ist kein Platz auf der Welt so schäbig, dass es nicht noch etwas zu handeln gäbe. Zu meiner Überraschung existierte in Zanghmu ein überdachter Markt, auf dem Chinesen, Nepali und Tibeter allerlei Elektronik, Textilien und Schmuck austauschten. Wie die Angehörigen unterschiedlicher Spezies wuselten die flinken Nepali und die geschäftstüchtigen Chinesen durcheinander, flankiert von tibetischen Lastenträgern, Tagelöhnern oder Nomaden. die in ihrer abgerissenen Landestracht scheinbar unbeteiligt neben dem Geschehen standen, als wären sie nur Gäste in ihrem eigenen Land. Sogar eine „Bank of China“ hatte in Zanghmu geöffnet - wenigstens theoretisch, denn als wir uns nach den Wechselkursen erkundigten, blieben wir völlig unbeachtet. Die beiden Chinesinnen hinter dem Tresen hatten weitab der Heimat anscheinend eine Menge zu bereden, und als wir es wagten, nach einer höflichen Wartezeit leise zu insistierten, gab es nur ein unfreundliches „Meo“ „Meo“, „Meo“, die Universalauskunft des chinesischen Amtsträgers, die in etwa so viel bedeutet wie „Haben wir nicht“, „Bekommen wir nicht“ und „Können wir auch nicht.“
Nachdem wir vergeblich versucht hatten, in der Bank of Zanghmu irgendein Zahlungsmittel zu wechseln, führten uns Tensing und Mun zum Ortsrand, wo wir Kelsang, Kunga und Topchin kennenlernten, unsere tibetischen Guides, die uns auf dem größten Teil unserer Reise durch Tibet begleiten würden. Alle drei waren bereits einen Tag vorher aus Lhasa kommend in Zanghmu eingetroffen, wo sie wohlweislich kein Hotel bezogen sondern im überdachten Laderaum ihres großen Dongfeng-Lastwagens geschlafen hatten.
Kelsang, eine temperamentvolle junge Tibeterin, begrüßte uns in fließendem Englisch mit einer Tasse heißen Tees, die sie auf einem kleinen Kocher neben den Fahrzeugen zubereitet hatte. Sie hatte ein offenes, sympathisches Gesicht mit den hohen Wangenknochen, die den tibetischen Menschen aus der Perspektive des Europäers ebenso fremdartig wie attraktiv erscheinen lassen. Offenbar kannte sie Tensing bereits, den sie ebenso wie Mun umarmte, und auch unsere geplante Route war ihr bekannt. Dreimal ließ sie sich unsere Namen buchstabieren, wiederholte und modulierte sie zur kindischen Freude aller Anwesenden, bis sie sie beherrschte und stellte uns dann die beiden Fahrer vor. Kunga, ein kleiner, etwas verwachsener Tibeter mit einer Stoppelfrisur und einer Knollennase, war der Fahrer des Jeeps. Er nickte zu allem und jedem, was auch nur irgendwer gerade sagte, verstand aber kein Wort Englisch und sollte während in den folgenden Wochen, egal ob im Schneeregen des Changthang oder im Sumpf der Tschochenpiste, immer nur im gleichen grünbraunen Anzug herumlaufen. Sein ganzes Sinnen und Trachten würde zuerst und vor allem seinem eierschalenfarbenen Jeep gelten, den er in jeder freien Minute reinigen und pflegen würde, bis er schließlich - kurz vor Ende der Reise, als der Wagen schließlich schrottreif gefahren worden war - mit ihm alleine in einem Nonnenkloster zurückbleiben sollte.
Von ganz anderem Kaliber war Topchin, der Fahrer des großen chinesischen Dongfeng-Lastwagens, auf dessen Ladefläche sich bereits unsere gesamte Expeditionsausrüstung befand. Topchin trug einen Hut wie ein Cowboy, er war großgewachsen, breitschultrig und kräftig, hatte ein sympathisches, intelligentes Gesicht und Hände wie Schaufeln, denen man auf den ersten Blick ihr handwerkliches Geschick keineswegs ansah. Topchin war die tibetische Hochlandvariante von Tensing, kräftiger, urwüchsiger und kantiger, aber von der gleichen Kompetenz und Zuverlässigkeit, die ihn mit seinem Dongfeng-Lastwagen schon durch ganz China geführt hatte. Wie wir später erfuhren, hatte Topchin am Beginn seiner Karriere auf fremde Rechnung über die Szechuan-Route Fernsehgeräte zwischen der chinesischen Stadt Chengdu in Szechuan und Lhasa in Tibet geschmuggelt, Grenzbeamte und Banditen in Amdo bestochen, sich mit den Wölfen im Hochland von Kham herumgeschlagen, ehe er mit seinem eigenen Fahrzeug und einigen Gehilfen über den sogenannten „Tibet-Highway“ kostbare Holzarbeiten vom Uigurenmarkt in Kashgar nach Shigatse brachte. Weil die Gewinnspannen im Tourismus zu seiner Überraschung die Profitmargen von Kühlschränken, Fernsehgeräten oder Holzarbeiten noch um ein Beträchtliches überschritten, arbeitete er nun im Tourismus. Schon bei unserer ersten Begrüßung ging etwas Starkes von ihm aus, ohne dass man auf Anhieb hätte sagen können, was es war. Er sprach nicht viel, doch wenn er etwas sagte, stockte das Gespräch und alle hörten zu. Frank und mich sollte er während der ganzen Reise nur ganz selten direkt ansprechen, vielleicht genierte er sich wegen seiner unzureichenden Englischkenntnisse, doch wusste er sich durch wenige, treffende Gesten verständlich zu machen.
Noch bevor es am nächsten Morgen hell wurde, verließen Frank, Tensing, Mun und ich das stinkende Zanghmu Hotel. Der große Lastwagen und der Jeep warteten schon in der Dunkelheit, die Sachen wurden verstaut, dann begann unsere Reise in die Wolken.
Bald lag das unwirtliche Zanghmu hinter uns, und schnell ging es in atemberaubenden Serpentinen in die Höhe. Es dauerte nicht lange, da waren die Bäume verschwunden, die Abhänge wurden kahler, ohne dass deswegen die Straßen rutschsicherer geworden wären. Aus den Tälern, die wir weit unter uns gelassen hatten, folgte uns der feuchte Nebel, der uns bald so vollständig einhüllte, dass sich die Sicht schon in einer Entfernung von wenigen Metern verlor. Ich dachte an die Transamericana im guatemaltekisch-mexikanischen Grenzgebiet, wo die Fernbusse die Wolken durchstießen und immer wieder in die Schluchten stürzten. Aber im Unterschied zu Guatemala waren die Straßen jenseits von Zanghmu weder geteert noch befestigt, und je gefährlicher die Pisten wurden, desto mehr erschwerten Regen, Nebel, Dunst und Unterspülungen die Orientierung. Auch wenn man die schwindelerregenden Abgründe jenseits der unbefestigten Straßenränder wegen des Nebels kaum sehen konnte – ihre gefährliche Nähe war so sicher wie die Präsenz der der chinesischen Kontrollposten an jedem kleinen Pass oder Ortseingang.
Erst in einer Höhe von weit über viertausend Höhenmetern riss endlich der Nebel auf. Der Grenzbereich des südasiatischen Monsuns war erreicht. Unter dunklen Wolkenwänden, gleißenden Himmelspassagen und eiskalten Schattenfronten durchfuhren wir eine unwirkliche Szenerie mit endlosen Geröllfeldern, spärlichem Ginsterbewuchs und wie abrasiert wirkenden Buckelbergen. Ein bitterkalter Wind peitschte über die kargen Ebenen, auf denen die Nomaden ihre Yak-Herden grasen ließen. Windschiefe Jurten standen am Rand der Weiden, wie rasend bellende Hirtenhunde rannten hinter unseren Fahrzeugen her.
„Nyalam“ - „Hölle“ nannte der tibetische Yogi Milarepa das nepalesisch-tibetische Grenzland, in dem er im zwölften Jahrhundert unserer Zeitrechnung einige Jahre meditiert haben soll. Zerlumpte Kinder, denen der Rotz wie eine kleine Moränenlandschaft über Mund und Kinn lief, begannen zu betteln, kaum, dass wir die Fahrzeuge verlassen hatten. Ein Mönch, ein Soldat und ein
Nomade mit einer Ziegenherde standen plötzlich neben unseren Fahrzeugen, und in dieser Begleitung besuchten wir die Meditationshöhle des Milarepa, vor deren Eingang der 5. Dalai Lama im 17. Jahrhundert ein kleines Klostergebäude hatte erbauen lassen.
Das Klostergebäude war geschlossen, doch die Meditationshöhle des Milarepa stand für Besucher offen. Nur wenige Meter genügten, um die klirrende Kälte des Gesteins zu spüren. Mit jedem Schritt wurde es eisiger, weißer Hauch entstieg unseren Mündern, und der Widerschein der Butterkerzen erfüllte die uralte Höhle mit einer gespenstigen Lebendigkeit. Ich dachte an die Säulenheiligen der Spätantike, die unverdrossen in der glühenden Hitze auf ihren Emporen gestanden hatten - Milarepa, der als tantrischer Magier nach Belieben „tummo“, eine durch Yoga erzeugte innere Wärme hervorrufen konnte, repräsentierte offenbar das entgegengesetzte klimatische Kasteiungsprinzip: die Meditation und Versenkung im Permafrost. Kelsang, Kunga und Topchin verbeugten sich vor diversen Felsen und Steinen, auf denen nach der Überlieferung die Fuß- und Handabdrücke des Meisters zu sehen sein sollten. Für sie war der große Yogi keine geschichtlich abgelegte Gestalt, sondern eine gegenwärtige Wesenheit, ein großer buddhistischer Lehrer und Hochlandbarde, der in seinen „Hunderttausend Gesängen“ dem Volk die Feinheiten der buddhistischen Mahayana- Theologie in Gleichnissen und Geschichten verdeutlicht hatte. Milarepa, ein Zeitgenosse der mohammedanischen Sufis und jener christlichen Cluniazenser, die die abendländische Kreuzzugsbewegung ins Werk gesetzt hatten, war aber auch als Missionar erfolgreich gewesen. Vom Westen Tibets und dem heiligen Berg Kailash kommend, hatte Milarepa im frühen 12. Jahrhundert das tibetische Kernland erreicht, um es diesmal entgültig für den Buddhismus zu gewinnen.
Hinter Nyalam, das auf einer Höhe von knapp viertausend Metern lag, führte eine breite steinige Straße zum 5.055m hohen Lalung-Le Pass, auf dessen Scheitelpunkt man bei gutem Wetter dem Himalaja gewissermaßen in den Rücken hätte sehen können. Doch was man im Sommer von Dhulikhel in Nepal aus nicht erspähen kann, wird man auch von der anderen Seite nicht in den Blick bekommen. Wolken in allen Farbschattierungen von schwarzdunkel bis schäfchenhell, hier und da unterbrochen von tiefblauen Himmelsinseln, versperrten den Blick auf die Eisriesen des mittleren Himalaja. Sowohl der Gipfel des über siebentausendfünfhundert Meter hohen Chogsam wie auch die über achttausend Meter hohe Shisha Pagma-Kette verblieben hinter einer tiefschwarzen Wolkenfront. Umtost von eiskalten Winden glich der Lalung-Le Pass einem verwaisten Aussichtspunkt oberhalb der Welt, und die namenlosen Sechs- und Siebentausender, die ihn zur Gänze umgaben, erschienen in dieser Höhe nur als eine Ansammlung einsamer Hügel.
Hinter dem Lalung-Le Pass führte die Straße auf die Hochebene von Tingri, einem weitgezogenen Plateau auf einer Höhe von gut viertausenddreihundert Metern. Wir sahen die ersten Yakherden, eine Jurte, in deren Umgebung eine Herde Ziegen zum Melken zusammengebunden wurde, dann wieder lange Zeit nichts als Steintschörten und eine satt durchfeuchtete Landschaft, über der sich schwarzgraue Wolkendächer wölbten. Mitten hinein in diese Düsterkeit führte der Abzweig nach Rongbuk, einem etwa fünftausend Meter hoch gelegenen Kloster, hinter dem die Profis vom tibetischen Everest Base Camp aus die Besteigung des höchsten Berges der Welt in Angriff nahmen.
An derartige Heldentaten aber war für uns an diesem Tag nicht zu denken - im Gegenteil: der schnelle Anstieg über Zanghmu nach Nyalam und schließlich zum Lalung-Le Pass, der uns in nur einem einzigen Reisetag von 2.700 auf über 5.000 Höhenmetern geführt hatte, begann sich bemerkbar zu machen. Als wir am Abend das Qomolangma Hotel erreichten, plagten uns bereits starke Kopfschmerzen, die ersten und untrüglichen Symptome der Höhenkrankheit. Frank war ebenso bleich wie ich, und zum erstenmal waren wir froh, nicht anfassen zu müssen, als unser Gepäck in die kleinen Zimmer des Qomolangma Hotels verfrachtet wurde.
Von meiner letzten Erkrankung in Bolivien wusste ich, dass eine einmal ausgebrochene Höhenkrankheit zwar nicht mehr aufzuhalten, aber durchaus in ihrem Verlauf zu lindern war, vor allem, wenn man sich an die Erfahrungen der Einheimischen hielt. Auf dem bolivianischen Altiplano bedeutete das: cocahaltigen Mate-Tee trinken und darauf hoffen, dass die Symptome nach einem Tag verschwinden würden. Was in Bolivien mit dem Mate-Tee möglich war, funktionierte in Tibet mit dem Buttertee, einem salzhaltigen dickflüssigen Gebräu aus Yakbutter, das dem europäischen Gaumen etwa so schmeckt wie eine Tasse Lebertran mit drei Esslöffeln Salz. Während Frank und ich im Aufenthaltsraum des Qomolangma Hotels unschlüssig an der warmen, ranzig duftenden Flüssigkeit nippten, kippten Kelsang, Kunga und Topchin ebenso wie Tensing und Mun einen Becher Buttertee nach dem nächsten in sich hinein. Eigentlich war die Stimmung gut, draußen hatte ein Sturm begonnen, drinnen bollerte ein warmer Ofen unter jedem der großen Tische, so dass wir in behaglicher Wärme von Sven Hedins Abentern hätten erzählen können, wenn unser Befinden nicht stündlich schlechter geworden wäre.
Appetitlos und mit schmerzenden Knochen zogen Frank und ich uns schließlich in unsere Zimmer zurück. Doch an Schlafen war nicht zu denken - mehr noch: kaum lagen wir in unseren eiskalten Betten, steigerte sich die Pein zu ungeahnten Höhen. Das untergründige Kopfweh hatte einem stechenden, dolchartigen Schmerz platzgemacht, einem Gefühl, als sei der Kopf in ein Nadelkissen eingeklemmt, aus dem sich tausend winzige Messer in den Schädel bohrten. Keine Pein ist so schlimm, dass sie nicht noch schlimmer werden könnte, heißt es im “Bardo“, im buddhistischen Totenbuch, und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis zu den kaum noch erträglichen Kopfschmerzen ein erschreckendes Herzpumpen hinzukam. Und so sehr ich auch versuchte, durch alle möglichen Atemtechniken, Meditiationsübungen oder Körperhaltungen meine Qualen zu lindern - der einzige Effekt, der sich nach diesen Bemühungen einstellte, war eine unbeschreibliche Übelkeit, die mir zu meiner Überraschung noch quälender erschien als die Kopfschmerzen und das Herzpumpen.
Kurz nach Mitternacht sprang Frank wie von einer Tarantel gestochen auf und öffnete die Türe zum Hof. Augenblicklich erfüllte ein nasskalter Schwall kalter Luft das muffige Zimmer, ein Gewitter tobte über der Hochebene von Tingri, und der Himmel flackerte, als wäre das Ende aller Tage angebrochen. Zwei Hunde jaulten draußen zum Gotterbarmen, und für einen Augenblick fürchtete ich, sie würden uns in unserer Leidenskammer einen Besuch abstatten. Dann hörten wir die Geräusche eines Kampfes auf Leben und Tod, offenbar war ein dritter Hund im Hof erscheinen, der jetzt von den beiden Revierinhabern zerfleischt wurde. „Das ist die Hölle des Milarepa“, dachte ich immer wieder, während ich alle Geräusche der Außenwelt nur wie durch einen heißen Vorhang aus Schmerzen wahrnahm. Irgendwann schlief ich ein.
Als ich im Morgengrauen wieder erwachte, hatte sich mein Herzschlag normalisiert. Kopfschmerzen und Übelkeit waren einer latenten Benommenheit und Schwäche gewichen, doch im Vergleich zu den Unbilden der letzten Nacht waren diese Beeinträchtigungen locker zu ertragen.
Kelsang kam aus ihrer Schlafkammer und klopfte mir aufmunternd auf die Schulter, als ich die ersten wackeligen Schritte im Hof unternahm. Sie reichte uns einen Becher Buttertee, lachte und erzählte von Sir Edmund Hillary, dem Erstbesteiger des Mount Everest, der eine Gruppe neuseeländischer Politiker durch den Himalaja führen wollte und als erster höhenkrank wieder ins Tal geflogen werden musste. Frank, der jeden Extrembergsteiger bewunderte, zog einen Flunsch, ich dagegen fand es nett, dass Kelsang das sagte.
Sofort nach dem Frühstück fuhren wir weiter. Das Wetter klarte auf, und auf unserer Reise nach Norden passierten wir eine schier endlose Kette grün bemooster und wunderlich geformter Berge, hier und da mit zerstörten oder verfalleneren Dzongs an ihren Abhängen. Sonnenstrahlen, Nebel und Schatten illuminierten die Szene mit einem surrealistische Anhauch von Urerde und Vorzeit, doch die in regelmäßigen Abständen postierten chinesischen Straßenkontrollen holten uns schnell wieder in die Wirklichkeit zurück. Einsame jugendliche Figuren mit Hundegesichtern, unglücklich, verbiestert, ungeliebt und fern der Heimat, standen neben ihren Wärterbuden und überwachten den Fernverkehr. Gerade einmal zwanzigjährige Wehrpflichtige, denen man in der Heimat den Hochmut gegen die „rückständigen Tibeter“ überaus erfolgreich eingeimpft hatte, bellten unwirsche Anweisungen, fummelten an unseren Rucksäcken herum, kramten in den Vorräten und verhörten Kelsang in unverschämter Tonlage. Immerhin halten sich die chinesischen Soldaten bei ihren Kontrollen etwas zurück, wenn Touristen anwesend sind, so dass wir ungeschoren davonkamen und nach Shekar weiterfahren konnten.
Wie eine Hochlandoase, von Hochgebirgsbächen und Feldern umgeben, lag der der Dzong von Shekar in einer weiträumigen Tallandschaft. Die gewaltige Befestigungsanlagen der Burg, die allen Belagerungsmaschinen des tibetischen Mittelalters getrotzt haben werden, beschützten heute niemand mehr, stattdessen waren unterhalb des Dzongs in New-Tingri Dorfbewohner und Nomaden aus der gesamten Umgebung zwangsangesiedelt und in landwirtschaftliche Kooperative hineingepresst worden.
Immerhin hatte man sich dazu aufgerafft, das in der Kulturrevolution vollkommen zerstörte Kloster auf dem Burgberg wieder leidlich zu restaurieren. Die Gazellen, die dem Buddha lauschten, und das Rad der Vergeltung hatten wieder ihren Platz über dem Klostereingang gefunden, und die große Staue des Shakyamuni thronte im halberleuchteten Innenraum, als hätte es die verheerenden Überfälle der Roten Garden niemals gegeben.
Von einer Anhöhe oberhalb des Klosters aus war das Toben des Sommermonsuns in den südlichen Bergen gut zu erkennen. Eine schmutzigdunkle Wolkenwand blähte sich auf und komprimierte sich im Minutenwechsel, als bewache eine riesenhafte Zentrifuge aus Wasser und Dampf das Tor nach Tibet. Wir befanden uns in einer Zwischenwelt - noch nicht ganz Tibet, aber auch noch nicht China, nicht mehr Himalaja und noch nicht Transhimalaja, nur Himmel, Regen und Erde prägten diesen wunderlichen Platz. Nach Norden aber wurde es heller, die wirklichen Grenzen Tibets, die Ufer des Tsangpos, waren nahe.
Zunächst aber hieß es den letzten Pass zu überwinden. Während der Auffahrt zum über fünfausendzweihundert Meter hohen Lhakpa-La Pass sahen wir überladene Lastwagen, die wie Ozeandampfer durch tückische Schlammfurten schwankten, rechts und links von Mitfahrern, die an den Seitenplanen hingen, waghalsig ausbalanciert. Hagelstürme setzten ein, und plötzlich befand sich die schwarze Wolkenfront, die ich eben noch im Süden gesehen hatte, genau über uns. Mitten im Tag wurde es unvermittelt dunkel, als wollte die Welt untergehen. Wie Wesen aus einer anderen Welt standen Nomaden auf steinigen Feldern und blickten im Halbdunkel verwundert den Lastwagen hinterher, die sich die Passstraßen herauf- und herunterquälten.
Der Scheitel des Lhakpa La Passes war an diesem Tag nichts weiter als eine Regenfalle. Zerfetzte Wolken in allen dunklen Farbtönen jagten über einen leichengrauen Himmel, Gebetsfahnen flatterten im Sturm, als Topchin aus dem Fahrerhaus seines Lastwagens stieg und sich vor einer improvisierten Tschörte verneigte. Obwohl ein eiskalter Wind über die Anhöhen fegte, verweilten wir ein wenig an der Passhöhe, denn die historische Grenze des Schneelandes war erreicht. Ich kramte Lama Anagarika Govindas Buch „Der Weg der weißen Wolke“ aus meinem Rucksack und las die berühmte Stelle, in der Govinda den ersten Blick auf Tibet beschreibt. Der Wind pfiff mir schneidend kalt den Ärmel hoch, als ich die Stelle fand. „Und dann kam das große Wunder, das mich stets von neuem ergriff, so oft ich die Grenzen Tibets überschritt“, las ich. “Auf dem höchsten Punkt des Passes, auf den die Wolken in dunklen Massen zustürmten, öffnete sich der Himmel wie durch einen Zauberschlag, die Wolken lösten sich auf, und eine Welt leuchtender Farben entstand unter einem tiefblauen Himmel.“
Ganz so war es an diesem Tage leider nicht, aber schon wenige Kilometer hinter dem Lhakpa-La Pass verebbte der Sturm wie abgeschnitten. In steilen Windungen führte die Straße auf nur wenigen Kilometern tausend Höhenmeter tiefer, und die Veränderung, die die Landschaft dabei erfuhr, grenzte ans Wunderbare. Die tristen Bergrücken zeigten sich plötzlich von einem dichten Lebensgrün überzogen, Tschörten, Gebetsfahnen, und Getreidefelder umgaben kleine Siedlungen, knallgelbe Rapsfelder erstreckten sich links und rechts der Straße, bis sich die Hochgebirgskerbe öffnete und das große Tal des Tsangpo vor uns lag.
Mir schlug das Herz, als ich in der Nähe der tibetischen Fährstation Lhatse den Tsangpo zum erstenmal erblickte. Ich habe eine Schwäche für Flüsse, die Nährerinnen aller Kulturen, und wenn ich meine Hand in ihr Wasser halte, glaube ich den Rhythmus des Lebens zu spüren, das an ihren Ufern pulsiert. Ich weiß noch genau, wie lehmig sich der Nil anfühlte und wie seifig der Amazonas. Das Wasser des Tsangpo fühlte sich an wie eiskalter Stein, es war von einer kaum zu übertreffenden Reinheit und Transparenz.
Unter den großen Kulturströmen der Erde ist der Tsangpo der unbekannteste, und doch ist er der einzige, der gleich zwei komplett unterschiedliche Hochkulturen an seinen Ufern hervorgebracht hat, die tibetische an seinem Oberlauf und die bengalische an seiner Mündung. Bevor er sich nach seinem Durchbruch im östlichen Himalaja als Brahmaputra in das Tiefland von Bengalen ergießt, hat er sich im Hochland von Tibet bereits mit Hunderten von Schmelzwasserzuflüssen angereichert und an der Grenze von Himalaja und Transhimalaja eines der größten Erosionstäler der Erde geschaffen. Über Hunderte von Kilometern trennt dieses Tal wie eine gigantische Kerbe Himalaja und Transhimalaja, Süd- und Zentralasien, und wo es in vergleichbaren Höhenlagen wie etwa dem bolivianischen Altiplano nicht anderes gibt als lebensfeindliche Steinwüsten, ermöglichten die Gewässer des Tsangpo seit dem Anfang der geschichtlichen Zeiten nicht nur Getreide-, Gemüse- und Kartoffelanbau auf knapp unter viertausend Höhenmetern sondern auch die Entstehung einer der faszinierendsten Hochkulturen der Erde.
Wie zur Begrüßung auf dem Dach der Welt kam plötzlich die Sonne hinter den Wolken hervor. Der Himmel riss auf über dem großen Fluss, und wir befanden uns mit einem Mal in jenem Zwischenreich aus Wolken, Sonne und Schatten, das Lama Anagarika Govinda in seinem Tibet-Buch beschrieben hat: „Wir traten ein in eine Welt titanischer Felsen, schneebedeckter Gipfel und tiefgrüner Seen, zwischen denen tiefhängende Wolken und plötzliche Sonnendachbrüche ein wechselndes Spiel von Licht und Schatten schufen. Die Landschaft schien sich in einem Zustand dauernder Verwandlung zu befinden, als ob sie von Augenblick zu Augenblick neu erschaffen würde.“
Doch das wunderbare Schattenspiel von Wolken und Licht beleuchtete eine Szene, an der Govinda wenig Freude gehabt hätte. Bemerkenswert an der Stadt Lhatse waren heute nicht mehr ihre Klöster und Gipfeltschörten, sondern die neue Tsangpo-Brücke im Westen und die einzige Tankstelle weit und breit, ihre Herren waren chinesische Soldaten und uigurische Händler. Die Tibeter aber, die wie in allen größeren Siedlungen Tibets bald auch in Lhatse in der Minderheit sein werden, lebten nach wie vor in ihren Lehmhäusern und steckten sich Zweigenbüschel auf die Dächer, die sie vor den bösen Geistern beschützen sollen. Nach dem Glauben der Tibeter würden sich die bösen Geister in diesen Büscheln zerheddern, und sollte es einmal einem besonders perfiden Geist gelingen, diese Schutzvorrichtung zu durchbrechen, würde er an den Yakhörnern scheitern, die die Tibeter vor ihren Türen als ultimativen Abwehrzauber aufgetürmt haben.
Leider hatten den Tibetern diese Zaubermittel gegen die chinesische Okkupation nichts genutzt. Neben den zahlreichen neuen Straßen und Pisten, die die Chinesen zur Sicherung ihrer Macht durch das ganze historische Tibet gezogen hatten, verrotteten nach über zwei Generationen der Fremdherrschaft die überwiegende Mehrzahl der Klöster im Tal des Tsangpo. Ob man sich von Lhatse aus westwärts zum Kailash wandte, südöstlich nach Gyantse oder nordöstlich nach Lhasa - die neuen Herren hatten sich an den Kreuzungen der neuen Straßen häuslich eingerichtet und überwachten jedes Auto, jedes Pferdefuhrwerk oder jeden Wanderer, die sich von irgendwoher nach irgendwohin bewegten. Und erlebte man die schikanöse Langsamkeit, die quälende Arroganz, mit der sich die jugendlichen Angehörigen der Besatzungsarmee als denkbar schlechte Botschafter ihres Volkes erwiesen, konnte man die Kluft ermessen, die die chinesischen Einwanderer und die Tibeter trennte.