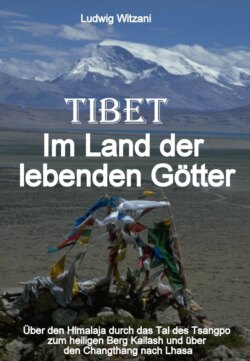Читать книгу Tibet – Im Land der lebenden Götter - Ludwig Witzani - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеV An den Ufern des Tsangpo
Als wir am nächsten Morgen auf der einzigen intakten Fährstation im Umkreis von Hunderten von Kilometern den Tsangpo im Westen der Stadt Lhatse überquerten, war das Wetter wieder umgeschlagen. Konturenlos lag ein schwarzer Himmel über dem Tsangpotal und verschluckte mit seinen herabhängenden dunklen Wolkenfetzen die Berge rund um Lhatse. Im Himalaja hatte der Sommermonsun nun seine volle Kraft entfaltet, und es war möglich, dass die die Straßen, die wir noch vor wenigen Tagen passiert hatten, nun überflutet waren.
Entkommen waren wir dem Sommermonsun aber trotzdem nicht. Denn obwohl die höchsten Kämme des Himalaja das Hochland von Tibet vor den Regenmassen des indischen Monsuns bewahrten, erreichten seine Ausläufer das Tal des Tsangpo. Hier sorgte seine Wärme nicht nur für einen ergiebigen Sommerregen und für eine erstaunliche Vegetation auf einer Höhe von immerhin viertausend Metern, sondern spätestens ab Juli für den Beginn der Schneeschmelze im Transhimalaja. Alle Zuflüsse, sogar die in Winter und Frühjahr oft gänzlich ausgetrockneten Wadis, schwollen dann an: Rinnsale verwandelten sich in reißende Gebirgsbäche, ehe sie zu veritablen Flüssen wurden, die spätestens im August den normalen Reiseverkehr im Tal des Tsangpo regelmäßig fast völlig zum Erliegen brachten.
Wie weit die Schneeschmelze schon fortschritten war, mussten wir schon wenige Stunden hinter Lhatse erkennen. Gelbbraune Wassermassen schossen mit bedrohlicher Kraft durch Landengen und Schluchten, und die Schotterpisten, die meist nur ein bis zwei Meter über dem Pegelstand des Wassers am Rande eines Bergrückens entlangführten, waren an den verschiedenen Senken bereits überschwemmt. Als wir an der erste Straßenüberflutung, die sich im Rückblick als die harmloseste erweisen sollte, eintrafen, glaubte ich allen Ernstes, die Reise sei zuende. Deprimiert ergriff ich meinen Rucksack, verließ den Wagen und nahm auf einer Anhöhe Platz. Wie Xerxes vom Ufer aus den Untergang seiner Flotte vor Salamis beobachten musste, so wollte auch ich das Absaufen von Lastwagen und Jeep mit ansehen, ein skurriler Gedanke, der mir die ganze Unwirklichkeit unserer Planung bewusst machte. Wie hatten wir nur ernsthaft erwarten können, durch diese amphibische Wasserwelt nach Westen vorzustoßen? Sogar Frank hatte den MP3-Player ausgestellt und saß mit blassen Gesicht neben mir.
Doch zu unserer maßlosen Überraschung gelang es Jeep und Lastwagen mühelos, die überfluteten Vertiefungen zu passieren. Ich sah die Räder der Fahrzeuge im Wasser versinken, der Jeep schwankte in der Gegenströmung ein wenig, doch er kam genauso problemlos durch das Wasser wie der Lastwagen. Auch wenn die ersten erfolgreichen Wasserpassagen dieser Art unsere Stimmung wieder etwas hoben, merkten wir doch bald, dass die Hauptstraßen, denen wir eine knappe Woche lang nach Westen folgen wollten, wirklich eindeutig nur auf der Landkarte zu erkennen war. In unserer tibetischen Wirklichkeit aber waren sie nichts weiter als ein Sammelsurium kümmerlicher Schlammpisten inmitten mäandernder Flussläufe oder ein Schotterstraßenwirrwarr in weitauseinandergezogenen Tallandschaften. Sogar für Topchin und Kelsang, die die Route zum Kailash bereits mehrfach gemeistert hatten, war die Orientierung schwierig, denn die Landschaft wurde, je weiter wir nach Westen fuhren, immer mehr zu einer sich auflösenden Welt aus erstarrtem Schlamminseln und Hügeln, zwischen denen unzählige Wasserrinnsale nach Osten flossen, ein Landschaftsbild, das in wenigen Wochen unter den Fluten der Schneeschmelze ganz einfach versinken würde, um am Ende des Sommers in vollkommen anderer Gestalt wiederzuentstehen.
Aber auch schon vor dem Höhepunkt der Schneeschmelze wurden die Wasserläufe, die wir durchqueren mussten, immer beängstigender. Bald waren es nicht mehr nur abgesunkene Schotterpisten, die zwischen Flussläufen und Bergrücken zu meistern waren, sondern richtige kleine Flüsse, die uns die Weiterfahrt versperrten. Topchin, der mit dem großen Lastwagen immer zuerst die Furt überquerte, aber schien nie auch nur eine Sekunde zu zögern. Zwanzig bis dreißig Meter breite Zuflüsse durchfuhr er locker und ohne erkennbare Schwierigkeit, um, auf der anderen Seite angelangt, zu stoppen und Kunga einige Zeichen zu geben, damit er mit dem Jeep nachkommen konnte. Mehr als einmal hätte ich, während der Überfahrt im Jeep sitzend, mit der Hand aus dem Fenster das Schmelzwasser berühren können - einmetertief preschte das allradangetriebene Fahrzeug durch das Wasser, doch das einzige, was dabei nass wurde, waren die Umschläge von Kungas graugrüner Anzughose. Über die Mühelosigkeit, mit der wir an diesem Tag auch die furchterregendsten Wasserbarrieren überwanden, konnte ich mich nicht genug wundern. War es möglich, dass die Naturgesetze in viertausend Höhenmetern nicht mehr galten, so dass selbst voll beladene Fahrzeuge scheinbar schwerelos ganze Flüsse durchqueren konnten? Waren die Fahrzeuge im Hochland leichter als im Tiefland? War das Wasser permeabler oder der Boden härter? Doch die Lösung war viel einfacher. „Es ist nicht die Menge des Wassers, die Probleme bereitet“, erklärte Kelsang, „sondern der Schlamm, der mit der Schneeschmelze herunterkommt und sich am Flussgrund absetzt. Solange die Fahrzeuge im Wasser über Kies und Steine fahren, kommen sie voran. Erst wenn sich ein bis zwei Wochen nach Beginn der Schneeschmelze eine Schlammfurt in der Mitte der Flüsse gebildet hat, wird es gefährlich.“
Es war eine schier endlose Zickzackreise durch Mulden und Riesenpfützen, durch Flüsse und Wasserarme, vorüber an den Spuren verrutschter Hügel, die manche Schotterpisten für immer unter sich begraben hatten, und vorbei an kleinen Seen, die wie erloschene Diamanten unter einem trüben Himmel lagen. Bald verließen wir den unmittelbaren Einzugsbereich des Flusses und durchfuhren eine Landschaft voller fleckig bemooster Hügel, die sich bis zum Horizont erstreckte. Kegel, Würfel, Rauten, eine archaische Felsengeometrie, von einer launigen Hochlandnatur geschaffen, wechselten ab mit sanft begrünten Buckelbergen. Schließlich wurden die Täler breiter, die Berge flacher und begrünter, bis wir die Kreuzung von Raka erreichte, wo sich die Nord- und Südrouten des tibetischen Fernverkehrs trafen. Überladene Lastwagen, deren Begleitpersonen wieder wie lebende Stabilisatoren links und rechts an die Planen hingen, schaukelten durch die schlammigen Furten, tibetische Nomaden standen am Wegesrand und grüßten die Fahrzeuge wie rätselhaften Boten aus einer unbekannten Welt, und der neblige Dunst links und rechts der Straße verzerrte die Umrisse von Yaks, als führte die Reise mitten hinein in ein Reich voller Gespenster.
Es begann zu regnen, als wir der Nähe einer chinesischen Versorgungsstation unsere Zelte aufbauten. Die schwarzen Wolkenfetzen schienen die Wagen- und Zeltdächer zu berühren, und eine Stimmung melancholischer Weltverlorenheit machte sich breit. Sogar die Mitglieder der chinesischen Straßenarbeiterbrigade, die mit uns in der Versorgungsstation übernachteten, saßen mit langen Gesichtern vor ihren Nudelsuppen und rauchten eine Zigarette nach der anderen. Die heißen Quellen, der Stolz des Ortes, wirkten wie schmutzige Ausflüsse aus der Unterwelt. Zigarettenschachteln und Dosen schwammen im modrig-warmen Wasser, so dass wir auf ein Bad verzichteten und uns so schnell wie möglich in unsere Zelte zurückzogen.
In dieser Nacht wachte ich auf und hörte, dass sich der abendliche Regen zu einem regelrechten Sturm entwickelt hatte. Es krachte und donnerte, der Wind zerrte an den Zeltwänden, und der Boden unter unseren Isomatten war bereits vollkommen durchnässt. Zum ersten Mal auf einer Reise empfand Furcht - Furcht vor der Landschaft, die fremdartiger war als alles, was ich bisher kennen gelernt hatte, Furcht aber auch vor den Unwägbarkeiten der Reise, die mit der zunehmenden Schneeschmelze immer riskanter wurde.
Am nächsten Tag regnete es ohne Unterlass in einer Weise, in der ich es noch niemals erlebt hatte. Ich kannte den Regen Afrikas, der wie ein feuchtes Kissen war, eine Epiphanie der Fülle, in der man sich getrost verlieren konnte, ich kannte den Regen des Nordens, der ein geduldig-gnadenloser Regen war ohne jeden Trost, ein Regen, der das Herz auswusch und alle Farben zum Verschwinden brachte, so dass man fast vergessen könnte, dass es eine Sonne gab - einen Regen wie in Tibet jedoch hatte ich noch nie erlebt. Der Regen fiel in langen Fäden und bildete einen Vorhang aus purer Nässe, hinter dem man die Umrisse der umgebenden Berge nur noch ahnen konnte. Der Regen war weder so warm wie in Afrika, noch so kalt wie im Norden, sondern beides - er beinhaltete die Ahnung des Eises, in das er sich verwandeln würde, wenn es nur wenige Grade kälter wäre, und die Ahnung von Dampf und Nebel, in den er sich verlieren würde, sobald es der Sonne auch nur für kurze Zeit gelänge, die Wolkenwände zu durchbrechen. Es war fast so, als käme das Wasser von allen Seiten, es kam aus den Bergen die abschüssigen Bachläufe herabgeschossen, es suchte seinen Weg in der Ebene, es spritze hoch, wenn wir zum hundertstenmal die Riesenpfützen und Furten durchfuhren, und es kam ohne Unterlass aus einem trüben Himmel, der sich wie eine nasse, schwarze Wolkendecke über dem tibetischen Westen ausgebreitet hatte. Stunde um Stunde war von der Umgebung außer den Umrissen der Berge und der undeutlichen Straßenführung kaum etwas zu erkennen. Nur einmal passierten wir eine weitere chinesische Straßenarbeiterbrigade, diesmal jedoch nicht an einer Raststation sondern auf freiem Feld. Der Nässe und der Kälte anheimgegeben arbeiteten die Söhne der Han auch in diesem abgelegenen Winkel Tibets an einer der rätselhaftesten chinesischen Obsessionen, nämlich der Besessenheit, jeden Winkel ihres Riesenreiches, sei es Hochland, Wüste oder Feuchtland, mit Straßen zu durchziehen und damit zu zähmen. Waren die chinesischen Wanderarbeiter, die für einen Spitzenlohn nach Tibet gingen, mit jenen römischen Kolonisten vergleichbar, die einst an den Grenzen des Römischen Reiches zuerst die Straßen bauten, ehe sie sich niederließen? Oder glichen ihre Bemühungen einer Sisyphusarbeit, weil im Tal des Tsangpo eine Straße niemals ganz vollendet werden kann? Auf jeden Fall sahen die Chinesen wie Verbannte aus, verloren und heimwehkrank nach den Tälern von Yünnan oder den Gärten von Suzhou blickten sie unseren Wagen hinterher.
Die große Überraschung erwartete uns am Nachmittag. Übergangslos, von einer Minute zur nächsten, war der Himmel aufgerissen, und unter der plötzlichen Wärme der Hochlandsonne begann das ganze Tal zu dampfen. Alle Felsen, Bergrücken, Häuser oder Felder schienen plötzlich von einem durchsichtig-nebligen Film umgeben zu sein, während zwei prachtvolle Regenbogen den Himmel wie ein Weltentor überspannten. Von der vollgesogenen feuchten Erde stiegen feine weiße Nebel auf und klumpten sich wie kompakte Dampfinseln zusammen, so dass die Hochlandwiesen plötzlich wirkten, als wären der Erde tausend kleine Gebetsfahnen zu Ehren Buddhas entsprungen.
Nach einer kurzen Fahrt durch eine aufklarende Landschaft aus weißem Nebel und Licht erreichten wir hinter Saka wieder den großen Strom, der nun wie ein riesenhafter See das ganze Tal erfüllte. Majestätisch war der Schwung seiner Linien, manchmal waren Fischer zu sehen, Ziegenherden weideten an seinen Ufern, und für einen Augenblick hätte man fast vergessen können, dass man sich nicht im Tiefland sondern auf dem Dach der Welt befand. Aber eben nur für einen Augenblick, denn so unvermittelt wie Licht und Wärme gekommen waren, verschwanden sie auch wieder. Kaum hatten wir den gesichtslosen Ort hinter uns gelassen, waren die flammenden Farben des späten Nachmittags erloschen und einer bittergrauen Kälte gewichen, die sich wie ein unsichtbarer Raureif über alles legte, was sich im Tal bewegte. Bitterkalt war es, als wir hinter Saka unsere Zelte auf einer Hochlandwiese aufschlugen, bitterkalt war es, als wir unsere Nudeln im Küchenzelt aßen, und es dauerte eine ganze Weile, ehe es im Daunenschlafsack warm wurde. Ich dachte an Lama Govinda, der nicht nur die unglaublichen Wetterumschwünge im Hochland von Tibet beschrieben sondern auch ihre Auswirkungen auf das menschliche Träumen untersucht hatte. Govinda war aufgefallen, dass er nach überraschenden Wetterumschwüngen sehr intensiv und plastisch von weit zurückliegenden Kindheitsphasen geträumt hatte, ein Phänomen, das er damit erklärte, dass unser Bewusstsein möglicherweise auf atmosphärischen Druck reagierte, so dass mit zunehmender Druckintensität immer tiefere Schichten unseres Bewusstseins in den Bereich unserer Traumwahrnehmung gelangten. In Tibets großen Höhen, so Govinda, sei der Organismus für derartige Zusammenhänge offenbar besonders sensibilisiert, so dass es kein Fehler sei, auf die Traumgesichter zu achten, die uns in Tibet erscheinen. Mit diesen Gedanken fiel ich in einen tiefen Erschöpfungsschlaf. Leider konnte ich mich am nächsten Morgen trotz intensiven Bemühens an keinerlei Traumfragment erinnern. Als ich Frank beim Frühstück fragte, wovon er in der letzten Nacht geträumt hatte, antwortete er: “Von meiner Eigentumswohnung in Stuttgart. Ich habe die Heizung auf die höchste Stufe gestellt.“
Am diesem Tag wurde die Landschaft noch verzauberter. Risse, Schluchten, aufgeborstene Abhänge, ineinander verschobene Hügel, isolierte Seen und Sumpflandschaften wechselten einander ab oder kombinierten sich zu kuriosen Vexierbildern aus allen Weltteilen. Mal kam es uns vor, als durchführen wir eine Urzeit vor der Erschaffung des Menschen mit nichts anderem als Feuchtigkeit, Felsen und Wolken. Dann erinnerten die mächtig angeschwollenen Uferpassagen des Tsangpo an die üppigen Szenerien Südwestchinas, nur das gänzliche Fehlen von Bäumen zeigte, dass wir uns auf einer Höhenlage von über viertausend Metern befanden. Nur wenige Kilometer vom Ufer des Tsangpo entfernt war dann wieder alles lebensfeindlich, eiskalt und steinig - geradeso wie man sich die Antarktis vorstellen mochte, wenn der Schnee am Südpol jemals schmelzen sollte. Am unwirklichsten wurde es schließlich, als wir inmitten dieser eng verklammerten Welt von Feuchtigkeit und Dürre an kleinen Miniaturwüsten vorüberfuhren, an gelbweißen Sicheldünen von imponierenden Ausmaßen neben fetten, von den Gewässern des Tsangpo gespeisten Weiden und vor dem tiefdunklen Horizont des südasiatischen Monsuns.
Außer Raka, Saka, Donghba und Barga existierten auf einer Strecke von vielen hundert Kilometern nur winzige Siedlungen, und selbst diese Ortschaften wirkten auf der Durchreise wie schreckliche Orte der Verbannung, in denen den ansässigen Chinesen kein anderer Trost zu bleiben schien als exzessiver Alkoholgenuss. Die Chinesen am Oberlauf Tsangpo waren bedauernswerte Wesen, denn wenn sie nicht gerade ihren Sold vertranken, weil sie vor Heimweh schier vergingen, mussten sie Häuser ausbessern und Straßen bauen.
Für die Tibeter aber hätten die trostlosen und isolierten chinesischen Stützpunkte im Tsangpotal auch auf dem Mond liegen können, denn sie hatten mit dem Leben der Einheimischen nichts zu tun. Westtibet war Nomadenland, eine Welt der Hirten, die vor allem um drei Zentren kreiste: die Tschörte, das Yak und die Jurte. Tschörten werden dem Reisenden in Tibet begegnen, wo immer er sich auch befand, und auch wir passierten auf unserer Reise nach Westen Hunderte jener großen und kleinen, alten und modernen, prachtvollen, verfallenen oder oft auch nur mit einigen Steinen angedeuteten Gebilden, die wie Elemente einer kuriosen Straßenverkehrsordnung alle Regionen Tibets prägen. Die immer gleich konzipierten, breitbäuchigen und nach oben spitz zulaufenden Bauten erschienen mir vor den fantastischen Kulissen des Tsangpotales mitunter so fremd wie jene berühmte Metallplatte, die am Beginn der Menschheitsgeschichte die Menschenaffen in Stanley Kubricks „Odyssee im Weltall 2001“ verblüffte - und dann wieder wie eine natürliche Ergänzung und humane Überhöhung der Natur durch die Religion. So wie nach der gemeinsamen hinduistisch-buddhistischen Überlieferung die Urgebirge und Urozeane den Urkontinent Jampudiwa umgaben, so wie die Gläubigen in Tibet den heiligen Berg Kailash, die irdische Repräsentation des Weltzentrums, umkreisten, so begriffen die Tibeter die Verehrung und Umrundung der allgegenwärtigen Tschörten als tagtägliche Verankerung ihrer selbst in die harmonische Ganzheit des Universums. Ob sich wirklich in jeder Tschörte, wie Kelsang erklärte, ein heiliger Gegenstand, die Reliquie eines tibetischen Yogis oder gar die Überreste eines Tulkus befand, mochte man glauben oder nicht – auf jeden Fall glichen sie als Schnittpunkte von Immanenz und Transzendenz einem Netz spiritueller Energiespender, die das Leben der Tibeter mehr aufhellten als es jeder Elektrizität vermocht hätte.
Zur harmonischen Ganzheit des Universums gehörte für die Tibeter auch das Yak, die Wollkuh oder der Grunzochse, der in seiner wilden und in seiner domestizierten Variante das Überleben der Tibeter im Tsangpotal sicherte. Das Yak war sensibel und störrisch, hässlich und ergiebig - kurz: nicht nur ein Symbol des Lebens, sondern der größte denkbare irdische Kontrast zur Welt der Tschörten, zwischen denen es seine Weiden fand. Yaks waren lebende Vorratskammer ihrer Hirten, denn es gab praktisch nichts am Yak, was sich nicht im geordneten Haushalt des tibetischen Nomaden verwenden ließe: kein Buttertee ohne das Yak, kein Überleben im Winter ohne das Yakfleisch, keine warme Kleidung ohne das Yakfell, keine Boote ohne Yakhaut - unzählig waren die Möglichkeiten, Haut, Fell, Fleisch, Milch, Sehnen, Innereien und Knochen im Dienste des Hirtenlebens zu verwenden. „Das Yak ist das Gegenteil des Touristen“, scherzte Kelsang. „Der Tourist ist anspruchsvoll und über viertausend Höhenmetern kaum noch zu ertragen“, fuhr sie fort, „das Yak dagegen ist anspruchslos und fühlt sich erst ab einer Höhe von viertausend Höhenmetern so richtig wohl“.
Das dritte Zentrum der Nomadenwelt neben Tschörte und Yak ist die tibetische Jurte, ein überraschend windsicheres, leicht auf- und abbaubares Zelt mit einem warmen Ofen in der Mitte, an dem sich jeder Reisende gerne ein wenig aufwärmte. Schon bei unserem ersten Besuch lernten wir, dass für die Visite in der einer tibetischen Jurte offenbar keinerlei Anmeldung erforderlich war - wer vorbeikam, war willkommen, wenn er nur kein Chinese war und nicht vergaß, zum Abschied ein Gastgeschenk zu hinterlassen, das in etwa dem Wert der Bewirtung, die der Gast erfahren hatte, entsprach. Bei den Nomaden des Tsangpotales schien es sich auch keineswegs um sonderlich arme Familien zu handeln – uigurische Sofas, Holzschränke, kostbare Butterteekannen aus verziertem Holz schmückten das Interieur, und es hätte mich nicht gewundert, in irgendeiner Jurtenecke ein Fernsehgerät mit Satellitenschüssel zu entdecken. Doch so weit war es gottlob noch nicht gekommen, stattdessen flatterten über den Nomadenzelten die Wimpel und Zweige zu Ehren des Buddha im Wind. Wie viel Köpfe jeweils zur Familie zählten, war allerdings auf Anhieb nur schwer abzuschätzen, weil sich - kaum dass wir an einer Jurte gehalten hatten - die Zahl der Kinder und Erwachsenen, die uns staunend betrachteten, exponentiell erhöhte, geradeso als existierte ein geheimes Kuriersystem, das jedweden Besuch von Fremden sogleich in die Nachbarjurten meldete, sodass sich in kürzester Zeit die Einwohnerschaft eines ganzen Tales um den unerwarteten Besuch versammeln konnte. Immer wieder wurden uns Babys in den Schoß gelegt, damit wir uns in Ruhe den Nachwuchs ansehen konnten. Wie üblich bei Kleinkindern in Tibet waren sie fest wie Pakete verschnürt, ohne deswegen zu weinen oder zu greinen, vielmehr blickten sie mit großen staunenden Augen auf die Besucher, ehe sie uns wieder abgenommen, der kleinen Schwester übergeben oder zum Aufwärmen neben den Jurtenofen gelegt wurden.
Obgleich die Bildnisse des Dalai Lama in Tibet nicht mehr gezeigt werden durften, entdeckten wir gleich bei unserem ersten Jurtenbesuch ein großes Portraitfoto des jugendlichen Priesterkönigs auf einem Tisch an der Kopfseite des Zeltes. Topchin, Kelsang und Kunga verbeugten sich vor dem kleinen Altar, um sich gleich anschließend auf bequemen Kissen niederzulassen und vom Tsampa zu kosten, das uns in allen Zelten angeboten wurde. Ich wusste, dass Tsampa, ein sehr trockener aber nahrhafter Mehlbrei ist, den man mit bloßer Hand aus einer Schale isst. Für den verwöhnten europäischen Gaumen ist der erste Tsampagenuss immer ein Schock, mich erinnerte mein erster Kau- und Schluckversuch an ein uraltes Brot, das ich einmal in Kairo gegessen hatte und das ein unredlicher Bäcker mit Sägespänen gestreckt hatte. Auch Frank verzog nach dem ersten Kosten das Gesicht und gab seine Ration an Kunga und Mun weiter.
Die Hausfrau, eine alterslose Nomadin mit einem runden Gesicht und dickgeflochtenen Zöpfen, die ihr die Schulter herabhingen, hatte sich zusammen mit ihrem Mann auf einem großen Kissen niedergelassen. Sie blickte freundlich in die Runde, verscheuchte hin und wieder einige Kinder, die sich allzu vorwitzig vom Zelteingang aus in das Innere vorgewagt hatten und nickte immerfort jedem zu, der etwas sagte.
Auch ich nickte ihr freundlich zu und erkannte, dass sie ein großes Pflaster auf der Wange trug.
„Was ist mit der Frau?“ fragte ich Kelsang. „Hat sie sich verletzt?“
„Kann sein“, antwortete Kelsang. „Vielleicht ist es aber auch nur Show.“
„Show - hier? “ fragte Frank. „Für wen?“
Kelsang blickte noch einmal genauer hin und antwortete: “Wahrscheinlich hat die Frau keine Verletzung. Viele Nomadenfrauen kleben sich Pflaster wie Schmuck auf die Wange. Das sieht dann so aus, als hätten sie gerade einen Arztbesuch hinter sich, und das ist so ziemlich der größte Luxus, den sich ein Nomade am Tsangpo vorstellen kann.“
„Schade, dass wir so wenig Pflaster mitgenommen haben“, meinte Frank trocken. “Sonst könnten wir die Damenwelt rund um den Kailash glücklich machen.“
In einem der zahlreichen Täler, die wir an dritten Tag unser Tsangpo-Reise durchfuhren, befand sich das Kloster Tagelung, in dem vor 1959 immerhin fast fünfzig Mönche gelebt haben sollen, ehe es in den Sechziger Jahren von der chinesischen Besatzungsmacht aufgelöst und zerstört worden war. Erst lange nach dem Ende der Kulturrevolution hatten die überlebenden Mönche zurückkehren und das Kloster mit tatkräftiger Unterstützung der Bewohner des Tsangpotales wieder aufbauen dürfen, sodass es heute wieder, als wäre nichts geschehen, wie eine Festung des Lamaismus am Abhang eines Berges lag.
Ein würdiger Klosterabt empfing uns am Eingang. Er hatte eine Glatze, riesige Ohren, eine tiefe, rauhe Stimme und erstaunlich gütige Augen, die von einem Fresko von Lachfältchen umgeben waren. Allzu oft schien er in seinem Kloster keinen Besuch zu empfangen, und neugierig fragte er uns nach dem Ziel unserer Reise. Als Kelsang ihm erzählte, dass wir zum heiligen Berg Kailash wollten, schien er hocherfreut und ließ es sich nicht nehmen, uns persönlich durch das Kloster zu führen. Offensichtlich gehörte der Abt selbst noch zu jenen Mönchen, die bei der Zerstörung des Klosters in den Sechziger Jahren nur mit knapper Not der Ermordung durch die Roten Garden hatten entkommen können. Als Nomade hatte er in der Umgebung von Saka überlebt, bis vor etwa fünfzehn Jahren mit der Restauration des Tagelung Klosters begonnen wurde. Heute regiert er schon wieder über eine stattliche Anzahl junger Klosternovizen, die aus allen Teilen des tibetischen Südens von ihren Familien in das Kloster gebracht wurden – übrigens eine Übung, die nicht nur religiösen, sondern auch uralten ökologischen Regeln folgte. Denn dieses karge Land, das sofort überfordert wäre, wenn sich die Bevölkerungszahl auch nur unwesentlich erhöhen würde, war auf die Institution des zölibatären Mönchtums angewiesen. Nur wenn große Teile der zeugungsfähigen männlichen Bevölkerung ins Kloster gingen und auf Nachkommen verzichteten, blieb das Nahrungsangebot bei konstanter Bevölkerungszahl ausreichend.
Ob den jungen Novizen, die uns bei unserem Klosterrundgang ungeniert zuzwinkerten, dieser Zusammenhang bekannt war und ob es sie überhaupt interessieren würde, blieb unbekannt. Stattdessen präsentierte uns der Abt mit Enthusiasmus und Begeisterung den Versammlungsraum des Klosters, seine kleine Klosterbibliothek und die neuen Wandmalereien, die erst vor kurzem von bedeutenden Meistern aus Tsethang am Yarlung fertiggestellt worden waren. Chenresi-Avalokiteshvara, der höchste tibetische Bodhisattva des Mitgefühls, der Gelbmützen-Reformator Tsongkhapa, Buddha Shakyamuni und Padmasambhava, der Missionar Tibets, fungierten wie überall in Tibet auch im Kloster Tagelung als Hauptdarsteller klösterlicher Bilderzyklen. Ganz besonders leuchteten die Augen des Abtes, als er von Padmasambhava erzählte, dem indischen Magier, der im achten Jahrhundert missionierend durch Tibet gezogen sein soll und den die Gläubigen in Tibet noch heute wie einen zweiten Buddha verehrten. Für den Abt war Padmasmbhava keine nur geschichtliche Erscheinung, er war eine spirituelle Gegenwärtigkeit, gerade so, als sei er gerade erst durch das Tsangpotal gezogen und könne schon morgen wiederkommen. Govinda berichtet, dass die Tibeter, als ihnen christliche Missionare vom Opfertod Jesu erzählten, ohne Zögern ausgerufen haben sollen: „Das war Padmasambhava!“ - vollkommen überzeugt davon, dass Jesus und Padmasambhava ein und dieselbe Person seien. Nicht zuletzt aus diesem Grund musste übrigens die christliche Mission unter den Tibetern vollkommen erfolglos bleiben, nicht weil sich die Tibeter gegen die Erzählungen sträubten, sondern weil sie in Christi Taten eine Bestätigung und Wiederholung all der Taten sahen, derentwegen sie Buddha, Milarepa oder Padmasambhava rühmten.
Als die Erzählungen des Abtes ein wenig auszuufern schienen und sich immer mehr Novizen um den Abt versammelten, drängte Kelsang zum Aufbruch. Freundlich unterbrach der Abt seine Erzählungen, um uns über den Klosterhof zurück wieder bis zum Parkplatz zu geleiten. Sei es aus Zufall, sei es als Strafe für unsere Ungeduld – als wir im Jeep saßen und starten wollten, versagte die Zündung. Kunga drehte noch einmal den Schlüssel um, trat auf das Gaspedal, doch nichts geschah.
Topchin, der während des ganzen Klosterbesuches geschwiegen hatte, blickte kurz aus dem Fahrerhaus seines Lastwagens. Dass der Jeep nicht starten konnte, schien ihn nicht zu überraschen. Er verließ sein Fahrerhaus, sprach kurz mit Kunga und kam dann zu mir,
„Wir müssen dem Abt ein Geschenk überreichen“, sagte er in seinem gebrochenen Englisch.
„Was denn?“ fragte ich. „Was können sie denn gebrauchen?“
Ratlosigkeit. Batterien, Tonbandkassetten, Haarwaschzeug. Was braucht man in einem tibetischen Kloster?
Frank kramte in seiner Tasche und holte eine Schachtel Aspirin heraus. „Hier, gib ihnen das“, sagte er.
Kelsang nahm die Tabletten und ging auf den Abt und die Gruppe der Mönche zu, die in einigem Abstand auf unseren Aufbruch warteten. Sie senkte den Kopf vor dem Klostervorsteher und überreichte die Tabletten. Der Abt dankte mit einem Kopfnicken und hob kurz die Hand, während Kelsang ihre Verneigung beibehielt.
Sofort danach stiegen wir wieder in unsere Fahrzeuge, Kunga startete den Jeep, die Zündung sprang an, und wir fuhren davon.
Nach einigen Minuten beugte sich Frank vor und fragte: „Warum sind wir nicht noch ein wenig länger im Kloster geblieben?“
Kelsang, die auf dem Vordersitz des Jeep neben Kunga saß, antwortete: “Es tut mir leid, dass ich so abrupt zum Aufbruch gedrängt habe. Vielleicht war das nicht höflich, aber wir haben keine Zeit.“
„Wieso das?“ fragte ich. „Wir liegen doch genau in der Planung.“
„Ja“ antwortete Kelsang, “aber nur wenn es uns gelingt, noch heute Abend den Paryang zu durchqueren. Wenn wir das geschafft haben, werden wir den Kailash ganz sicher erreichen.“
Als sie unsere etwas ratlosen Mienen im Rückspiegel sah, drehte sie sich um fügte sie hinzu: „Der Paryang ist nicht nur ein Wasserarm, er ist ein richtiger Fluss. Vielleicht haben ihn die Schlammfurten schon unpassierbar gemacht. Vielleicht aber haben wir Glück.“
„Hast Du ihn schon einmal durchquert?“ fragte Frank.
„Ja, aber nicht so spät im Jahr. Er muss schon ganz schön viel Wasser führen.“
So war es. Als wir nach zwei Stunden den Paryang erreichten, war der Himmel völlig aufgeklart, aber die Nachmittagssonne beleuchtete ein Desaster. Vor uns lag ein etwa fünfzig Meter breiter, rasch dahinfließender Strom, und in seiner Mitte steckte bereits ein Lastwagen fest. Ein anderer Lastwagen stand am Ufer, zwei Fahrer hantierten mit Stahlseilen, während etwa fünfzehn Männer und Frauen aufgeregt und ratlos hin und her liefen.
Wie es sich herausstellte, handelte es sich um eine italienische Touristengruppe, deren Mitglieder sich in Lhasa ein Permit für den Besuch des Kailash besorgt und dazu kurzerhand zwei chinesische Lastwagenfahrer angeheuert hatten, die sie für einen erklecklichen Dollarbetrag nach Westtibet fahren sollten. Möglicherweise hatten die chinesischen Fahrer, vom guten Verdienst verlockt, die Schwierigkeiten der Strecke zu dieser Jahreszeit unterschätzt, vielleicht kannten sie die Route auch gar nicht, jedenfalls steckte nun einer der beiden Lastwagen fest, und das Abschleppseil, mit dem die beiden Fahrer herumhantierten, erwies sich als viel zu kurz.
Topchin stieg aus, kramte im Laderaum des Lastwagens herum und förderte ein langes Stahlabschleppseil zutage, das er zu den Chinesen brachte. Mit diesem Seil sollte das Herausziehen des Lastwagens zurück an das östliche Ufer gelingen.
Was aber war mit uns? War auch für uns das Ende der Reise gekommen? Ich sah an Topchins Gesicht, dass es schwer werden würde, doch immerhin hatte er den Paryang schon mehrfach gemeistert. Wenn ich ihn richtig verstand, kannte er eine nicht verschlammte Furt durch den Fluss, die allerdings zuerst mit dem Jeep ausgetestet werden musste.
So fuhr Kunga schließlich, von Topchin genau instruiert, alleine und vorsichtig mit dem Jeep in den Paryang hinein, hielt sich zuerst fast parallel zum Ufer, um dann auf Topchins Anweisung hin das Steuer scharf nach rechts herumzuwerfen und mitten in den Fluss hineinzufahren. Es war beängstigend, wie tief der Wagen einsank, das Wasser erreichte Lenkradhöhe, doch unglaublicherweise fuhr der Jeep weiter und weiter. Er hatte schon mehr als die Hälfte der Distanz zum westlichen Ufer zurückgelegt, als es plötzlich ein lautes Gurgeln erschallte und der Motor ausging. Der Jeep steckte fest.
Nun musste Topchin ran. Er ging einige Schritte in den Paryang, testete mit Händen und Füßen den Grund in Ufernähe, wiegte den Kopf hin und her und trocknete sich anschließend die Hände ab. Dann setzte er seinen Cowboyhut auf, bestieg das Fahrerhaus und fuhr auf der gleichen Route in den Fluss wie Kunga. Es dauerte aber nur wenige Sekunden, da sackte der Lastwagen mit dem linken Vorderreifen ein, ein jaulendes Röhren war zu hören, als Topchin Gas gab und den Wagen wieder freibekam. Allerdings fuhr er sofort wieder aus dem Fluss heraus, wendete den Truck um dann rückwärts erneut in den Fluss zu hineinzufahren. Diesmal wählte er eine andere Furt und fuhr direkt auf den Jeep zu. Gerade als er ihn erreicht hatte, sackte der große Lastwagen plötzlich ein. Mir krampfte sich der Magen zusammen. Jaulen, Röhren, Motorgeräusche, dann Stille Nun saß auch der Lastwagen fest. Einträchtig vereint standen Jeep und Lastwagen mitten im Paryang im Schlamm.
Nun musste alles sehr schnell gehen. Weil niemand wissen konnte, wie weich und nachgiebig die Schlammfurt auf dem Grund des Paryang war, mussten die wichtigsten Sachen aus dem Laderaum des Lastwagens geholt werden. Kelsang und Tensing sprangen in den eiskalten Fluss, gefolgt von Kunga und Mun, während Frank mich unschlüssig anblickte. Ich verspürte nicht die geringste Lust, mich ins kalte Hochlandwasser zu stürzen, doch ich dachte an die Bücher von Hedin, David-Neél, Harrer und Govinda, meine Reisebibliothek, die ich auf keinen Fall verlieren wollte. So schnell wir konnten, zogen wir uns die Hosen aus und folgten der Crew ins Wasser. Es war so kalt, dass ich dachte, mir würden die Beine auf der Stelle abfrieren, und ich musste den Impuls bekämpfen, auf der Stelle wieder ans Ufer zurückzulaufen. Schon kamen Topchin, Tensing, Kunga und die anderen mit Zeltplanen, Essen, Kochgeräten und Schlafsäcken zurück. Auch ich sprang auf den Laderaum und krallte mir zitternd meine Bücher, dazu einige Kartoffelsäcke und Konserven. An die Bergung der vollen Benzintonnen war natürlich nicht zu denken. Wenn wir sie verlieren sollten, war die Reise in jedem Fall zuende.
Während wir in immer hektischeren Anläufen einen Teil der Ladung an das östliche Ufer brachten, wurde es langsam dunkel. Schon längst hatte die Nachmittagssonne ihre Kraft verloren, und nach nur wenigen Ausflügen ins eiskalte Wasser standen alle bibbernd am Ufer. Kunga, der sich aus lauter Angst um seinen eierfarbenen Jeep besonders hervorgetan hatte, zeigte Zeichen von Unterkühlung. Er wurde in eine dicke Decke eingewickelt und von Topchin abgerubbelt.
Immerhin war etwa hundert Meter weiter die Bergung des zweiten chinesischen Lastwagens gelungen. Soweit man erkennen konnte, entwickelte sich nun ein gehöriger Krach zwischen Fahrern und Touristen, denn die Chinesen hatten ganz offensichtlich die Lust zur Weiterfahrt verloren. Wir sahen, wie sie abwehrend die Hände in die Luft hoben und immer wieder auf unsere Fahrzeuge wiesen. Seht, so geht es den Leuten, die es wider jede Vernunft trotzdem versuchen, schienen sie sagen zu wollen.
Hatten sie Recht? Ich blickte auf Lastwagen und Jeep in der Flussmitte, sah, wie sich die Wellen an den Karossen kräuselten, und konnte mir in diesem Augenblick beim besten Willen nicht vorstellen, wie wir aus diesem Schlammassel jemals wieder herauskommen sollten. Auch Kelsangs Gesicht war ernst, als wir im notdürftig aufgebauten Küchenzelt zusammensaßen. Was würde geschehen, wenn die Strömung stärker werden würde und unsere Fahrzeuge umkippten?
Topchin, der noch während des Essens zur Nachbargruppe gegangen war, kam mit einem wütenden Gesicht zurück. Er trug das Abschleppseil über die Schulter geworfen und schüttelte den Kopf.
Er sagte etwas zu Kelsang, die überrascht aufblickte, ehe ihr Gesicht auch einen verärgerten Ausdruck annahm. Auch die anderen Mitglieder der Crew hatten Topchins Nachricht verstanden und blickten plötzlich sehr betroffen drein. .
„Die Chinesen wissen nicht, ob sie uns helfen sollen“, sagte Kelsang.
„Warum nicht? Wir haben ihnen doch auch das Seil geliehen.“ empörte sich Frank.
„Ganz egal“, antwortete Kelsang..“Sie wollen für ihre Hilfe beim Herausziehen einhundert amerikanische Dollar sehen.“
Nach einer kurzen Pause schaute sie Frank und mich an und sagte: „Wir haben aber keine einhundert Dollar. Wir haben nur Yüan, und die wollen die Chinesen nicht.“
Schweigen. Frank zischte mir auf Deutsch zu: “Keinen Pfennig zahle ich! So Etwas müssen die im Budget haben. Wer weiß, vielleicht wollen die nur Kohle machen.“
Ich schüttelte den Kopf und kramt ein meiner Brusttasche. Um unseren Wagen wieder aus dem Fluss zu ziehen, hätte ich auch den doppelten Preis ohne Zögern bezahlt.
„Mach das Geld locker“, sagte ich. „Wir können froh sein, wenn wir für einhundert Dollar hier wegkommen.“
„Du kannst ja löhnen“, sagte Frank wieder auf Deutsch. “Ich zahle nichts.“
Ich blickte ihn überrascht an, sagte aber nichts.
„Was ist los?“ fragte Kelsang befremdet. “Habt Ihr die Dollars? Topchin muss zu den Chinesen zurück und ihnen Bescheid geben.“
„Hier ist mein Anteil sagte ich“, und gab Kelsang fünfzig Dollar.
Alle blickten Frank an, der unglücklich dreinblickte. Dann griff auch er in die Brusttasche, förderte eine fünfzig Dollarnote zutage und überreichte sie wortlos an Kelsang.
Nachdem Kelsang und Topchin den chinesischen Fahrern das Geld überbracht hatten, begann die Bergung. Topchin und Kunga stapften wieder in den eiskalten Fluss, um die Abschleppseile zu befestigen. Dann zogen die beiden Lastwagen wie Ochsen vor einer winzigen Kutsche den Jeep nahezu mühelos aus dem Schlamm. Bei der Bergung des Lastwagens knackte und knirschte es bedenklich, dann gab es einen Ruck, der Truck kam frei und wurde an Land gezogen.
Wahrscheinlich war es ganz gut, dass es inzwischen dunkel geworden war, denn das, was wir im fahlen Mondlicht von unseren Wagen sehen konnten, war wenig erbaulich. Vor allem der Jeep bot einen traurigen Anblick, aus allen Wagenöffnungen floss das Wasser wie aus einer defekten Kaffeekanne, der Auspuff war verschlammt und Teile der Polsterung ruiniert. Ob der Jeep jemals auch nur einen einzigen Meter weiterfahren würde, war mehr als fraglich.
Topchin und Kunga arbeiteten die ganze Nacht. Das Rascheln, Klappern, Knirschen und Schaben begleitete mich durch einen unruhigen Schlaf. Frank dagegen lag wie tot in seinem Schlafsack und schlief wie ein Bär. Kurz bevor er in seinen Schlafsack gestiegen war, hatte er aus einer Schachtel, die er immer bei sich trug, eine Tablette zu sich genommen und war auf der Stelle eingeschlafen. Ich dagegen quälte mich im Halbschlaf durch die Nacht, mal träumte ich, dass unser Lastwagen in einem unübersehbar breiten Fluss versinken würde, dann wieder saß ich mit Kelsang und Topchin in meinem häuslichen Arbeitszimmer in Deutschland über einer großen Tibet-Karte.
Auch der ganze nächste Tag stand im Zeichen eines verbissenen Kampfes mit dem Wasser in all seinen Erscheinungsformen - als Feuchtigkeit an Motorteilen, als Regen, der am Morgen in mehreren Schauern auf uns niederging und als kompakter Fluss, der uns an der Weiterfahrt hinderte. Kunga und Topchin hatten bereits den halben Jeepmotor ausgebaut, säuberten und putzten jedes einzelne Teil, das sich entfernen ließ und leerten die letzten überlaufenen Kammern vom Wasser. Glücklicherweise stellten sich die Schäden am Lastwagen als weniger schwerwiegend heraus, als zunächst gedacht. Die Zündung war noch intakt, der Motorraum nur wenig verschlammt, und nach einigen Stunden Arbeit an Vergaser und Auspuff schien der Lastwagen wieder startklar zu sein.
Inzwischen hatte es sich die Lage bei unserer Nachbargruppe weiter zugespitzt. Die Vorstellung, so kurz vor dem Kailash noch zu scheitern, trieb einige der Italiener schier zur Raserei. Sie brüllten, tobten, diskutierten und redeten auf die beiden chinesischen Lastwagenfahrer wie auf törichte Lasttiere ein – doch ohne Erfolg. Erst als eine allgemeine Gruppenkollekte einen fetten Dollarbetrag erbrachte, ließen sich die Chinesen erweichen. Man beschloss, den leistungsfähigeren der beiden Lastwagen noch einmal in den Paryang zu schicken Wenn er es schaffen würde, sollte die Gruppe mit einer abgespeckten Ausrüstung nur mit diesem einen Lastwagen zum Kailash weiterfahren. Sollte die Durchquerung scheitern, stände immer noch der zweite Lastwagen zur Bergung bereit.
Es war ein sehenswertes Schauspiel, als der kleinere der beiden Lastwagen an einer neuen und sorgfältig ausgesuchten Stelle mit voller Kraft in den Paryang fuhr. Topchin und Kunga, die über der offenen Motorhaube unseres Lastwagens letzte Hand anlegten, blickten auf. Auch Tensing und Mun unterbrachen das Kartoffelschälen und gingen näher an den Fluss, wo schon Frank und ich auf zwei Campingstühlen platzgenommen hatten, um nur kein Detail des Spektakels zu versäumen.
Kelsang trat heran und schüttelte den Kopf „Sie werden es nicht schaffen“, sagte sie.
Tatsächlich war die Stelle, die der chinesische Lastwagen durchqueren wollte, zwar die schmalste Stelle weit und breit, doch die östliche Uferböschung war uneben, fast steil, und man konnte bezweifeln, ob der Wagen am Ende der Furt noch über genügend Schwung verfügen würde, diese Anhöhe zu meistern.
Doch so weit sollte es gar nicht kommen. Etwa fünf oder sechs Meter vor dem östlichen Ufer und unmittelbar vor dem Anstieg der Böschung sackte der Lastwagen plötzlich auf der rechten Seite dramatisch ein. Einen Augenblick sah es so aus, als sollte der Truck von den Fluten verschlungen werden. Doch er stabilisierte sich und blieb mit vergurgelndem Motor wie ein auf die Spitze gestellter Würfel im Schlamm liegen.
Entsetzen und Hoffnung bei den Italienern. Bis zum andere Ufer waren es nur wenige Meter, das musste doch zu schaffen sein. Andererseits: was würde geschehen, wenn die stärker werdende Flut den ohnehin schon gefährlich schräg im Wasser liegenden Lastwagen ganz umkippen würde?
Tensing und Mun hatten sich wieder in das Kochzelt verzogen und bereiteten das Essen vor, Topchin und Kunga hatten gerade die Motorhaube wieder zugeklappt, als der zweite chinesische Lastwagenfahrer zu uns herübergelaufen kam. Er war ein korpulenter verschwitzter Mann, dem die Haare wie fettige Zotteln vom Kopf heruntergingen. Was er wollte, konnte ich nicht verstehen, doch Kelsang schüttelte den Kopf.
Nun riss der Chinese die Augen auf, als hätte er eine Ungeheuerlichkeit vernommen. Er ballte die Faust, ging einige Schritte auf und ab und wiederholte seine Aufforderung.
„Sie wollen das Abschleppseil“, sagte Frank.“ Ich bin mal gespannt, was jetzt geschieht.“
Topchin hatte sich die Hände im Fluss gewaschen. Während er sich mit dem Handtuch abtrocknete, trat er zu Kelsang und dem Chinesen, sprach ganz kurz einige Worte und ging wieder zum Jeep.
Kelsang lächelte. Der Chinese blickte empört, sagte aber nichts mehr sondern ging wieder zurück zu seiner Gruppe.
So kam es, dass wir unsere einhundert Dollar zurückerhielten. Topchin hatte für die erneute Ausleihe des stählernen Abschleppseiles die gleiche Gebühr erhoben wie vorher die beiden Chinesen für ihre Dienstleistung zu unseren Gunsten. Er beteiligte sich aber auch an der Bergung, ging noch einmal in den Fluss, fixierte die Seile und startete sogar unseren gerade wieder flottgemachten Lastwagen, um das chinesische Fahrzeug beim Herausziehen zu unterstützen. Immerhin mussten beide Lastwagen alle PS, die sie unter der Haube hatten, aufwenden, ehe sich der abgesoffene Lastwagen mit einem Ruck aus dem Schlammloch löste und wieder ans Land gezogen werden konnte. .
Während Topchin in aller Ruhe seine Stahlseile löste und wieder zu uns herüberkam, brach in seinem Rücken das Chaos aus. Italienische, englische und chinesische Schimpfworte flogen hin und her, die Lastwagenfahrer ballten die Fäuste, ein Italiener kreischte, dass man auf dem in Lhasa geschlossenen Vertrag bestehen und auf jeden Fall die Polizei benachrichtigen würde, und es hätte nicht viel gefehlt, dass die Reise zum heiligen Berg für unsere Nachbargruppe mit einer großen Keilerei zu Ende gegangen wäre.
„Sie müssen zurück“, sagte Kelsang, während Mun auf einem Tablett die Zutaten für unser Abendessen bereitstellte. Es gab einen Kartoffel-Gemüseauflauf mit Ananas aus der Dose zum Nachtisch. „Die Fahrer haben gesagt, dass sie morgen in aller Frühe früh nach Lhasa zurückfahren wollen. Sie meinen, dass jeder weitere Tag, den sie noch verlieren würden, die Rückreise unmöglich machen würde. “
Ich kostete am Kartoffelauflauf und fand ihn gut. Mun war nicht unbedingt ein großer Arbeiter, aber als Koch war er sein Geld wert.
„Was ist mit uns?“ fragte Frank, während er im Auflauf herumstocherte.“ Müssen wir auch zurück?“
„Hier kommen wir jedenfalls nicht weiter“, antwortete Kelsang. „Das Wasser steht schon zu hoch, und der Schlamm hat sich bereits über den ganzen Grund verteilt. Außerdem wird die Strömung immer stärker.“
Es stimmte. Man konnte förmlich sehen, wie der Fluss stündlich wuchs. Wir würden nur unsere Fahrzeuge und unsere Ausrüstung riskieren, wenn wir es noch einen Versuch wagen würden.
War damit die Reise auch für uns zuende? Mussten wir die ganze Strecke wieder zurück? Ich dachte an die beachtlichen Wasserfurten, die wir auf den ersten Tagen unserer Reise nach Westen durchquert hatten. Die würden inzwischen noch weiter angeschwollen sein. Konnten wir überhaupt noch zurück?
Während wir diesen Gedanken nachhingen und eine offene Aussprache vermieden, brach die magische Stunde an, die Zeit, in der das letzte Licht des vergehenden Tages Nuancen und Farben zur Erscheinung brachte, von denen man nicht hätte glauben mögen, dass sie in Felsen, Wiesen, Abhängen und Gewässern schlummerten. Keine Wolke war am Himmel zu sehen, und der Paryang-River, der uns soviel Schwierigkeiten bereitet hatte, floss wie ein blaues Himmelsband durch die Landschaft. Die Wiesen, auf denen unsere Zelte standen, hatten ein kaltes, fluoreszierendes Grün angenommen, wie ich es noch niemals gesehen hatte, flammend rot glühten unserer Zelte, und das schmutzigbraune Paryangufer chargierte ins Goldgelbe. Die Transparenz der Luft war bestürzend, die eisbedeckten Hügelketten des Himalaja, die uns wie ein Wegweiser seit dem Beginn unserer Westreise am südlichen Horizont begleitetet hatten, erschienen so nahe, als könnte ich sie mit der Hand berühren.
Dann wurde es übergangslos bitterkalt. Ohne eine schützende Wolkendecke entwich die spärliche Wärme des Tages schnell in die höheren Schichten der Atmosphäre und auf dem Boden fielen die Temperaturen schnell in den Minusbereich.
Wir lagen schon in den Schlafsäcken, als Kelsang noch einmal als Zelt klopfte.
„Der Jeep ist nun auch wieder startklar. Wir fahren morgen weiter. Wohin aber weiß ich noch nicht.“ sagte sie.
Das war eine gute Nachricht, aber was nützte sie uns, wenn uns der Paryang die Weiterreise versperrte? Nun schliefen wir schon die zweite Nacht am Fluss, ohne einen Meter weitergekommen zu sein. Ich hörte noch, wie der Jeep gestartet wurde, dann schlief ich ein.
Als ich am nächsten Morgen aus dem Zelt trat, hatten wir einen Gast. Ein dick vermummter Tibeter mit einer Yakfellmütze saß teetrinkend mit Kelsang an einem kleinen Feuer, Mun schlief noch auf der Ladefläche des Lastwagens. Kunga und Topchin machten sich an ihren Fahrzeugen zu schaffen, während Tensing mit der Zubereitung des Frühstücks beschäftigt war.
Wie es sich herausstellte, hatte Kelsang in der vergangenen Nacht zusammen mit Kunga die Jurten der Umgebung abgefahren und nach ortskundigen Nomaden gesucht, die uns vielleicht weiter Flussaufwärts einen Weg über den Paryang zeigen konnten. Offensichtlich waren sie fündig geworden und hatten den Fährtenweiser gleich mitgebracht. Ich setzte mich neben Kelsang und den Tibeter und schüttete mir einen Becher Tee ein. Von unserer Nachbargruppe war nicht mehr zu sehen, offenbar waren sie schon in aller Frühe wieder nach Lhasa aufgebrochen.
„Er heißt Gedün“, erkläre Kelsang, während auch sie sich einen Tee einschenkte. „Er behauptet eine passierbare Furt eine halbe Tagesreise im Norden zu kennen.“
Ich nickte dem Tibeter zu. Sein Gesicht war wie ein ausgetrockneter Flusslauf von unzähligen Falten durchzogen, und er streckte die Zunge heraus, als er mich anlachte. Ich erinnere mich, dass Sven Hedin das Herausstrecken der Zungen beschrieben hatte. Es war eine uralte und höfliche Form des Grußes, auch wenn sie auf den Unkundigen wie eine Veräppelung wirkte.
„Und? Glaubst du ihm?“ fragte ich.
Kelsang zuckte mit der Schulter. „Ich meine, wir sollten es versuchen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht.“
Gleich nach dem Frühstück packten wir unsere Sachen zusammen und verließen den Ort unseres kläglichen Scheiterns. Gedün hatte im Fond des Lastwagens neben Topchin, Tensing und Mun platzgenommen, Kunga, Kelsang, Frank und ich folgten mit dem Jeep. Das Motorgeräusch des Jeeps hörte sich allerdings ungesund an, alles knirschte und knackte, es gab Fehlzündungen, und ganz offensichtlich war das Gas nicht richtig eingestellt. Kunga saß verkrampft hinter dem Steuer und zuckte bei jeder Bodenunebenheit und Fehlzündung zusammen, auch ich machte mir Sorgen, denn für die Querfeldeinfahrt, die uns jetzt bevorstand, hätten die Wagen optimal in Schuss sein müssen. Tatsächlich hatten wir bald die kümmerlichen Pisten, denen wir in den letzen Tagen durch das Tsangpotal gefolgt waren, verlassen, um in eine hügelige, von Wind und Sturm glattgeschmirgelte Hügelwelt hineinzufahren, die sachte aber deutlich erkennbar höher und höher führte. Wir durchquerten kilometerlange Kiessteinflächen, und umkurvten mächtige Findlinge, die uns umso häufiger begegneten, je höher wir kamen. Zerklüftete Bergformationen mit Abhängen, die einer Ansammlung aneinandergereihter Orgelpfeifen glichen, folgten auf Sanddünen und weidenden Yaks, die zur Kennzeichnung ihrer Herdenzugehörigkeit mit bunten Stofftüchern an ihrem buschigen Schwänzen versehen waren.
Inzwischen hatte sich das Wetter verschlechtert, eine pechschwarze Wolkenwand stieg im Nordosten über der Transhimalaja Kette empor.
„Wir müssen uns beeilen“, meinte Kelsang, „Wenn gleich ein Wolkenbruch herunterkommt, kann es gefährlich werden.“
Ich wusste, was sie meinte. Wenn auch der schroffe Kontrast des blauem Hochlandhimmels und der schwarzen Wolkenfront die tibetischen Landschaft förmlich verzauberte, war ein Wolkenbruch zu diesem Zeitpunkt das Unnötigste, was wir brauchen konnten. Nicht nur, dass der Paryang weiter anschwellen würde - der harte Hochlandboden würde die Wassermassen nicht aufnehmen können und sie als Flutwelle bergabwärts schicken - genau in unsere Richtung.
Aber die Wolken blieben wie festgenagelt über den nordöstlichen Bergen stehen, während wir Stunde um Stunde unseren Weg nach Norden suchten. Schließlich erblickten wir von einer Anhöhe aus wieder den Paryang, aber in gänzlich veränderter Gestalt. Der nur eine halbe Tagesreise südlich unüberwindbare Fluss war hier in ein halbes Dutzend wild mäandernder Wasserarme aufgespalten, die ein geräumiges Tal durchflossen. Keiner der Flussläufe, die wir sahen, war furchterregender als die Dutzende von Furten, die wir bislang durchfahren hatten, außerdem befanden sich Kiesinseln zwischen den Flussarmen, so dass es mit etwas Glück und Geschick möglich sein musste, in diesem Tal den Paryang zu überlisten.
Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit, unter den vielen Möglichkeiten wirklich die am besten geeignete Stelle für die Flussdurchquerung zu finden. Auch die Flut der zahlreichen Seitenarme erwies sich als unerwartet stark, doch der Untergrund war nicht verschlammt, so dass Topchin und Kunga mit ihren Fahrzeugen ohne besondere Zwischenfälle einen Wasserarm nach dem anderen passierten, sich auf jeder Kiesinseln neu berieten, ehe nach einer bangen Stunde der Fluss hinter uns lag.
Nachdem wir am Abend den Nomaden Gedün entlohnt und verabschiedet hatten, fielen die Mitglieder unserer Crew todmüde auf ihre Isomatten. Der ununterbrochene Stress von Flussdurchquerung, Bergung, Reparatur und Suche nach einer optimaleren Furt hatte alle gezeichnet. Aber auch der Zusammenhang unserer Gruppe war durch gestärkt worden. Alle Mitglieder unserer Crew, insbesondere Kelsang und Topchin, hatten erstaunliches Durchhaltevermögen bewiesen. Auch Frank nickte mir zufrieden zu, bevor er in seinen Dauenschlafsack kroch, eine Pille einwarf und den Reißverschluss hochzog.
Die Verwandlung der Landschaft, die uns am nächsten Tag erwartete, war frappierend. Als hätten wir auf einen Schlag mit der Passage des Paryangflusses Südasien verlassen und Zentralasien erreicht, waren alle Formen der Feuchtigkeit, die uns die ersten Tage unserer Tsangpo Reise gequält hatten, verschwunden. Die schwarze Wolkenfront über dem nordöstlichen Transhimalaja war einem strahlend blauen Hochlandhimmel gewichen. Nur was die Sonne beschien, war weniger erfreulich: eine bedrückend öde Welt aus Stein soweit das Auge reichte. Mich beschlich beim Anblick der trostlosen Abwesenheit jeglichen Lebens ein Gefühl der Verlassenheit. An das Verschwinden von Bäumen hatten wir uns seit unserem Aufbruch in Lhatse gewöhnen müssen, dass nun auch jegliches Grün verschwunden war, machte mir mehr zu schaffen, als ich gedacht hätte.
In dieser Zone von Einsamkeit und Lebensleere befindet sich eine Tagesreise südlich der Ebene von Schamsang das Quellgebiet des Tsangpo, das zuerst von Sven Hedin im Juli 1907 erforscht worden war. Nachdem Hedin bereits mehrere Zuflüsse des Tsangpo und zahlreiche Gletscher untersucht hatte, war es ihm endlich gelungen, zum Kubi Gangri Massiv vorzudringen. „Aus den blendend weißen Schneefeldern stehen rabenschwarze Felsspitzen, Vorsprünge und Rücken hervor, und zwischen kolossalen Propyläen treten die Gletscherzungen heraus“, notierte Hedin, um euphorisch fortzufahren: „Hier ist es, hier an der Front dreier Gletscherzungen, wo der heilige Fluss seinen knapp dreitausend Kilometer langen Lauf durch das großartigste Bergland der Erde beginnt.“
Für die Tibeter ist das natürlich Unsinn. Für sie befindet sich die wahre Quelle aller großen südasiatischen Ströme, des Karnali, des Sutlej, des Indus und natürlich auch des Tsangpo im Manasarovar-See zu Füßen des Kailash, und seine unterirdischen Gewässer sind es, die alle Flüsse des Hochlandes speisen.
Wir erreichten den Manasarovar-See den letzten Minuten vor dem Sonnenuntergang. Wie eine silberne Leiste glitzerten seine Gewässer über den gesamten Horizont - an den Rändern bereits umschattet von der hereinbrechenden Dämmerung und flankiert von den Umrissen des Gurla Mandatha im Süden. Der Kailash selbst war nur zu ahnen, seine Konturen verbargen sich hinter einem breiten Wolkenstreifen im Nordwesten. „Bei diesem Anblick sprangen alle unsere Leute aus dem Sattel und warfen sich mit der Stirn auf die Erde nieder,“ hatte Sven Hedin am 21. Juli 1907 über seine Ankunft an eben diesem Aussichtspunkt notiert, und als wäre ein ganzes Jahrhundert im Rhythmus des Göttlichen nur ein Wimpernschlag, so warfen sich auch Topchin, Kunga, Tensing, Mun und Kelsang im Angesicht des Sees zu Boden und verharren in minutenlanger Andacht. Der „Nabel der Welt“ war erreicht, und obgleich mir beim Anblick des mattsilbernen Gewässers der Atem stockte, fühlte ich mich zugleich eifersüchtig und verloren – fast ein wenig wie ein einsames Kind, das zusehen muss, wie andere Kinder eine geliebte Mutter liebkosen.