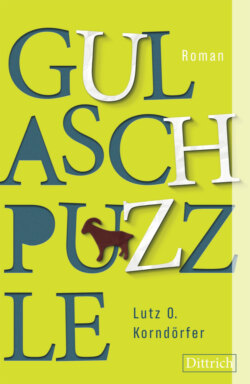Читать книгу Gulaschpuzzle - Lutz O. Korndörfer - Страница 6
2. Startup Relation Management
ОглавлениеNach einer knappen halben Stunde erreichte ich den Bürokomplex, in dem die Love Land-Partnerschafts-Agentur ihre Räumlichkeiten besaß, und betrat die verschwenderisch proportionierte Empfangshalle. Es war sehr viel grauer Marmor verbaut worden, der dem ganzen Ambiente eine protzige Atmosphäre verlieh. Vorder- und Rückseite waren vollverglast, so dass es innen relativ hell war. In der Mitte, gegenüber den beiden Aufzügen, stand ein wuchtiger Tresen, hinter dem recht verloren eine einzelne Person saß. Ich fragte nach Norbert Pawliczek.
Die nette Empfangsdame hatte einen viel zu engen Pulli an, und um zu vermeiden, dass ich dies unter Umständen hätte übersehen können, strich sie mit der freien Hand ihre üppigen Konturen nach, während sie nach Pawliczek telefonierte.
»Fahren Sie mit dem Fahrstuhl in den siebten Stock, Herr Pawliczek holt Sie dort ab«, säuselte sie mir zu.
»Danke, Frau Hennich«, sagte ich nach einem verstohlenen Blick zum Namensschild auf der mir zugewandten Erhebung ihres Pullis.
»Frollein Hennich«, flötete sie.
Ich lächelte beschwichtigend und suchte umgehend das Weite.
Als ich den siebten Stock erreichte, war Pawliczek noch nicht da. Ich setzte mich auf einen unbequemen Designerstuhl und blickte durch die Scheiben der Großraumbüros. Es ging gemächlich zu bei der Love Land-Partnerschafts-Agentur, zumindest an diesem Montagmorgen. Und bis Norbert Pawliczek auftauchte. Pawliczek redete schon von ferne lauthals auf mich ein, obwohl noch zwei Glastüren zwischen uns lagen. Er fuchtelte mit den Händen und schien sich enorm zu freuen, mich zu sehen. Die Mitarbeiter, an denen er vorbeidröhnte, blickten teils irritiert, teils gelangweilt auf, um sich kurz darauf wieder ihrer Arbeit zu widmen.
»Ick hätte ja nich jedacht, dass du kommst!«, schrie er mich an, während er mir die Hand schüttelte. Nur ganz allmählich pegelte er seine Lautstärke auf die geringe physische Distanz zwischen uns ein.
»Sach Norbert zu mir. Det tun hier alle.«
»Thomas«, sagte ich, »Tom nennen mich die meisten.«
»Denn kommste mal mit in mein Büro.«
Norberts Büro war aufregend wie zwei Seiten Steuererklärung. Ein Schreibtisch, drei Stühle, ein Aktenschrank und drei Bilder, die aus verschiedenen Blickwinkeln ein und dasselbe Segelboot zeigten.
»Det is meine Lisa«, erklärte Norbert. »Schon mal gesegelt?«
»Äh, nein«, sagte ich schnell und schluckte die Bemerkung hinunter, dass Segeln in meinen Augen die absolut langweiligste aller Sportarten war. Neben Angeln. Und dass Anhänger beider Freizeitbetätigungen wohl einen argen Sprung im Genom …
»Det und Angeln, det entspannt!«, brüllte Norbert und stieß sich somit selbst polternd vom Sockel des Messias herab.
»Ach«, grinste ich verlegen und fragte mich, ob Segel-Norbert meine Gedanken erraten konnte.
»Det machen wir denn mal im Sommer zusammen«, drohte Pawliczek, und ich sah mich schon beim ersten Betriebsausflug auf der Lisa mit einem gemütlich angelnden Agenturchef, während ich keuchend die Segel setzte, Essen kochte und mir die Seele aus dem Leib kotzte. Ich versuchte, mich zu entspannen und das Gespräch auf die Arbeitsinhalte zu lenken.
»Was soll ich denn nun hier machen?«, wollte ich wissen.
»Weeßte Tom«, er beugte sich über den Schreibtisch, als wolle er mir ein Geheimnis anvertrauen, senkte aber seine Lautstärke keineswegs, »wat wir hier machen, is ja nix Neuet. Früher jabs die jute Kontaktanzeige inne Zeitung. Und jetze, schau dir ma um!«
Ich blickte auf weiße Wände und die drei Bilder.
»Äh, angeln?«, fragte ich verwirrt.
»Jenau!«, schrie Norbert. »Heute fischen doch alle im Netz, im Internetz.« Er lachte glucksend über seinen Witz. »Det is det neuje Jahrtausend. Verstehste?« Seine Stimme war kurz davor zu kollabieren. »Et jibt doch Millionen von den Seiten im Internet. Jeder kann sich heute seinen Traumpartner virtuell zusammenbasteln. Aber wer will det? Willst du dir 10.000 Bilda ankieken? Sieste! Det überfordart die armen Menschen. Deswejen heißt det Zaubawort immer noch: Vermittlung! Wir sieben det persönlich aus und helfen den Leutchen zueinander. Dann passt det ooch!«
Mit deutlich leiserer Stimme fuhr er fort: »Und noch ’n Zaubawort: Spezialisierung! Wir arbeeten altersklassenübergreifend. Junger Kerl, altes Mädchen. Junges Mädchen, alter Kerl. Die Agentur für die großen Unterschiede. Zumindest beim Alta, hahaha. Und wie du dir sicher denken kannst, jibts da auf der Junge-Kerle-Seite einige Defizite. Und da kommst du ins Spiel.«
Ich blickte ihn verstört an.
»Na, jetzt schau nich wie ’n Elch! Du bist unser Startup-Relation-Manager«, rief er und schlug bei jedem Wort auf die Tischplatte.
Na super, schon wieder so eine übertemperierte Tätigkeitsbeschreibung! Vermutlich sollte ich abends die Geschäftsräume feucht durchwischen.
»Also. Du jehst mit ’n Mädels weg, bist nett, damit se wissen, det se bei uns richtig sind. Und du sagst uns denn, wie die so ticken, Hobbys, Interessen, tralala, damit wir sie an den Richtigen vermitteln können. Also easy money, Kolleje. Bisschen wegjehn, quatschen, trinken, wat essen, tralala. Aber«, er hob die Augenbrauen, »nix Versautet.« Nix Versautet. Aha. Pawliczek machte mir Angst. Da holte er mich aus weiter Ferne und gab mir reichlich Geld dafür, damit ich das Gleiche machen sollte wie die letzten 20 Jahre in Duisburg: weggehen, quatschen und trinken. Und im Nix-Versautes-Machen hatte ich in letzter Zeit auch einige Übung. Wie viele »Mädels« waren wohl bei der Agentur gemeldet? Musste ich jeden Abend professionell trinken? Und wer bezahlte mir danach den Entzug?
»So wie du arbeeten noch paar andere.« Pawliczek schien meine Zweifel erraten zu haben. »Allet so schicke Jungens wie du, haha. Kolleginnen jibt es och«, zwinkerte er mir zu.
»Und dafür zahlen Sie, äh, deine Firma, mir 3.800 Euro im Monat …?« Zögerlich wollte ich mich nochmals vergewissern, dass es wirklich Geld für diese Tätigkeit gäbe.
»Plus Spesen!«, jubelte Pawliczek. »Natürlich sollten es nicht mehr als vier, fünf Bierchen am Abend werden.«
»Natürlich«, murmelte ich. Langsam erschien Pawliczek wieder im Glanz des Messias. In Gedanken rutschte ich vor ihm auf den Knien und huldigte seiner Gabe, mich gegen fetteste Bezahlung zum Weggehen und Trinken zu nötigen. Diese kleine Segel- und Angelbagatelle konnte dem im Nachhinein nichts anhaben. Gar nichts. Norbert Pawliczek war der Messias.
Es folgte ein Rundgang durch die heiligen Hallen der Love Land-Gemeinde. Überwiegend bestand die Belegschaft aus Programmierern, die sich um den »Content« und den »Workflow« der Website kümmerten. Typische Computer-Nerds, die, statt Industrie-Großrechner zu hacken oder World of Warcraft zu spielen, vermutlich ebenfalls mit hoch dotierten Arbeitsverträgen aus ihren mit Pizzakartons vermüllten Muffbuden rausgelockt wurden. Ich musste an unsere Wohnung denken. Neben der üblichen Buchhaltungs- und Personalbelegschaft gab es noch die Abteilung »Relationship & Statistics«. Hier wurden die Mitgliedsdaten verwaltet und das Kerngeschäft »Partnervermittlung« betreut und optimiert. Hier also sollte zusammenfinden, was zusammengehörte.
Pawliczek verstand es, Belangloses als absolute Weltsensation zu verkaufen. Entsprechend beeindruckt stand ich im Flur, in dem zwischen jeder Tür pausbäckige weiße Gipsengel mit Pfeil und Bogen auf Holzplatten geklebt an der Wand hingen. Gar nicht kitschig. Pawliczek schien einen speziellen Sinn für Romantik zu haben.
Er gab mir noch einen Stapel Unterlagen und den Hinweis mit auf den Weg, die Sache nicht allzu publik zu machen. Er murmelte etwas von »Konkurrenz schläft nicht« und ließ mich dann allein in der Empfangshalle zurück.
Wobei Konkurrenz ein gutes Stichwort war. Eigentlich hatte ich noch gar keine Vergleichsangebote eingeholt. Vielleicht gab es da ja noch viel mehr Kuppelagenturen, die nur darauf warteten, meiner gegen jegliche Art der Gegenleistung habhaft zu werden. Möglicherweise folgten diesem Auftrag bereits gut dotierte Jobs im Ausland: »Blue Banana – die Agentur mit Niveau auf den Bahamas« (6.500 Euro plus Spesen). So waren meinen Einsatzorten auf lange Sicht keine Grenzen gesetzt. Ich beschloss jedoch, nicht gleich vollständig abzuheben und erst einmal für Love Land mein Bestes zu geben.
Zweimal in der Woche, montags und donnerstags, sollte ich in die Love Land-Räume einschweben, um meine Arbeit zu dokumentieren und mit den übrigen Kolleginnen und Kollegen das weitere Vorgehen (Zechgelage) zu koordinieren.
Um 12 Uhr saß ich wieder in der U-Bahn und fuhr nach Hause. Meine Laune war bestens, und ich rief Helen an, um ein kleines Danke-für-den-Reiseführer-Treffen zu arrangieren. Außerdem musste ich jemandem diese ganze Love Land-Geschichte erzählen, und die Meinung einer Frau, die schon lange in dem Irrenhaus Großstadt lebte, konnte hier keinesfalls schaden.
Helen war im Stress, denn sie hatte noch zwei Sendungen vorzubereiten. Sie arbeitete und moderierte bei einem dieser neuen Internet-Fernsehsender. Art und Umfang der Inhalte standen unter dem Motto: billig, trashig und schnell. Es gab unter anderem Talk-, Kopfgeldjäger-, Baumarkt- und Autotuningshows. Wir verabredeten uns lose für den nächsten Abend und beendeten das Gespräch sehr abrupt. Schnelle Show, schnelle Gespräche.
Zuhause angekommen, begann ich die Sachen unseres Messi-Vormieters aus dem Flur in den Kellerverschlag zu räumen. Zumindest jene, die man ohne fremde Hilfe von der Stelle bewegen konnte. Am liebsten hätte ich den ganzen Krempel angezündet, oder in Nachnahme-Paketen jedes Einzelteil dem Vermieterarsch geschickt, oder den Kram einfach aus dem Fenster geschmissen, aber ich wollte es mir mit meinen schönen neuen Mitberlinern nicht gleich verscherzen. Ich merkte schnell, dass unser Flur deutlich größer war als der Keller. Nach 25 Treppengängen war die Wohnung zwar wieder einigermaßen begehbar, aber die alten Aktenschränke und der Rasenmäher waren nicht gerade aus dem Designerladen. Das eintönige Geschleppe machte mich richtig fertig. Ich legte mich auf mein Bett, um ein wenig zu entspannen.
Ich erwachte von einem dumpfen Schlag aus der Wohnung über mir. Es war stockdunkel, und eine geraume Zeit lang wusste ich nicht, wo ich mich befand. Ich hatte wüstes Zeug geträumt und schleppte mich träge durch den Flur. Es war halb neun. Beim Betreten des Badezimmers fiel mir die mangelnde Warmwasserversorgung wieder ein. Ich drehte den Hahn auf, in der Hoffnung, das Problem wäre durch schlichte Ignoranz einfach wieder verschwunden. Aber nichts dergleichen. Kaltes Wasser platschte in die Badewanne. Furchtbar, furchtbar. Es wurde Zeit, hier zivilisierten Wohnstandard in Form von stufenlos temperierbarem Wasser einkehren zu lassen, was auch meinem optischen Standard durchaus zugutekommen würde. Eine Kernsäuberung meiner Körperhülle war dringend notwendig. Also machte ich mich auf die Suche nach dem Hausmeister.
Hausmeister wohnen immer im Erdgeschoss, sind schlecht gelaunt und haben Feinripp-Unterhemden an, sagte ich mir, als ich die Treppen nach unten schlurfte. Und ich hoffte inständig, mich jetzt nicht mit einem übellaunigen Feinrippträger herumärgern zu müssen.
Im Erdgeschoss gab es drei Wohnungen. Ich klingelte an allen Eingangstüren, aber nur eine wurde geöffnet. Eine ältere Frau, freundlich und ohne Feinripp. Sie entpuppte sich zwar nicht als Hausmeisterin, erteilte mir aber die gewünschte Auskunft.
»Da müssen Sie vorne in die Gaststätte gehen, zu Giovanni. Der kümmert sich hier um alles.«
Ich bedankte mich und trat aus dem Seiteneingang in den Hof, dann durch das große Tor auf die Straße, um über den Gehsteig das Vorderhaus zu betreten. Ehrlich gesagt, war mir der Laden noch gar nicht aufgefallen. Ein unscheinbares italienisches Geschäft, wo es allerhand Essenszutaten, Öle, Weine und Nudeln gab. Mich wunderte, dass der Kollege noch geöffnet hatte, es musste schon nach 21 Uhr sein. In dem Laden sah ich neben der ganzen Palette an italienischen Lebensmitteln einige Tische, an denen ein paar Leute aßen, und grüßte freundlich.
Am Tresen stand einer, der wie ein Giovanni aussah. Ich fragte ihn.
»Hallo, ich bin Tom, sind Sie Giovanni?«
»Scusi, ich bin Rafaele, Giovanni ist hinten.« Er deutete auf den angrenzenden Raum. »Giovanni, komm bitte, Besuch!«, rief er nach hinten und fragte mich: »Wollen eine Grappa?«
»Si«, willigte ich ein.
Mit dem Grappa kam Giovanni, ein kräftiger, charmant grinsender Rasse-Italiener, um die 45 Jahre, die Haare von der Farbe und Struktur des berühmten Ebenholzes. Strahlend begrüßte er mich. Ich schilderte ihm mein Problem in kurzen Worten.
»Ahh, du wohnst in die dritte Stock. Is scheiss Wasser schon wieder kaputt?«
Ich nickte.
»Hast du schon was gegessen?«, fragte er, anstatt weiter auf das technische Problem einzugehen. Ich schüttelte den Kopf. Seit dem trockenen Müsli heute Morgen hatte ich nichts wirklich Nahrhaftes zu mir genommen. Giovanni pfiff schrill und machte einige wilde Handbewegungen, und schon saß ich an einem der Tische und wurde mit Salat, Brot, Nudeln und Wein ausgestattet.
Es schmeckte vorzüglich. Aber leider, immer noch in Sorge um meine Reinlichkeit, sah ich Giovanni lediglich mit der Weinflasche von Tisch zu Tisch eilen, nicht jedoch mit der Rohrzange in unsere Wohnung. Egal. Ich genoss das Essen und ließ meine Blicke schweifen. Es mochten sich etwa acht Personen in dem kleinen Laden aufhalten. Es gab fünf Tische und den von meinem Tisch aus nicht einsehbaren Raum, aus dem Giovanni gekommen war. Vermutlich saßen dort weitere Gäste. Mir gegenüber, an einem anderen Tisch, hockte ein hagerer Mann mit langen blonden Haaren und bemalte vor ihm liegende Glasscheiben. Bei der Art und Weise, wie er das tat, hoffte ich, dass er nicht davon leben müsse. Mit merkwürdig ungelenken Bewegungen schwang er den Pinsel über das Glas und genehmigte sich in regelmäßigen Intervallen einen großen Schluck Wein. Auch Rafaele, als er dem Gast nachfüllte, schien mit dessen Kunst nicht zufrieden:
»Was soll das sein, eh? Eine Thunfisch im Gras?«
»Ach Rafaele, du hast keine Ahnung von Kunst. Ich werde das am Wochenende verkaufen«, sagte der Freak trotzig.
Amüsiert sah ich mich schon als Beobachter der Berliner Kunstszene in erster Reihe. Diese Verrückten hatten mir in Duisburg gefehlt. Da gab es auch Verrückte. Aber nicht solche.
»Wie findest du das?«, fragte er mich unvermittelt.
Ich zuckte zusammen. Das ›Bild‹ sah aus wie eine grüne Wiese mit Bäumen.
»Nu ja, äh, wird das ein Weihnachtsgeschenk?«
Etwas Dämlicheres war mir nicht eingefallen. Ob meines mangelnden Kunstsachverstandes blickte der Freak mich verständnislos an. Da musste ich nachlegen:
»Weißt du, die grünen Schattierungen sind sehr ausdrucksstark, aber der fehlende Kontrast zum Hintergrund verleiht dem Ganzen eine eher entmutigende Note.«
Das saß. Ich spülte einen Happen Penne mit einem großen Schluck Wein herunter und beobachtete die zerstörerische Wirkung meiner sinnfreien Worte. Der Freak blickte minutenlang schweigend auf sein Werk, und gerade, als ich bei Giovanni neuen Wein orderte, warf er es ohne Vorwarnung gegen die Wand. Die Gäste erschraken, als die Scherben klirrend zu Boden fielen.
»Du hast Recht«, sagte er nur und trank seinen Wein aus. Giovanni und ich blickten uns kurz entgeistert an, bevor wir gleichzeitig in lautes Gelächter ausbrachen.
»Du bist neu in der Stadt?«, fragte Giovanni und setzte sich mit einer neuen Flasche Wein zu mir.
Wir becherten fröhlich, und als ich zwei Stunden später gut abgedichtet die beschwerliche Heimreise in den dritten Stock antrat, rief er mir noch zu:
»Ich komme morgen früh zu dir hoch. Du machst Frühstück, ich repariere Wasser.«
»Alles klaro!«, röhrte ich.
Mit einem tiefen Grunzen und nahezu vollständig bekleidet fiel ich auf mein Bett, nicht ohne meinen ersten Arbeitstag erschöpft, aber bestimmt zu resümieren:
»Giovannis Pasteria – volle Punktzahl!«
Das Geräusch der Türklingel war fürchterlich. Außerdem schien sie direkt an der Innenseite meiner Schädeldecke angeschlossen zu sein. Ein lupenreiner Fall von »Der hat doch nur Saft getrunken«. Betäubt vor Schmerz torkelte ich zum Eingang und öffnete. Giovanni. Au shit, der Herr über Warmwasser und Wein! Er grinste mich an. Erst jetzt bemerkte ich mein wenig gesellschaftstaugliches Äußeres: körpergebügelte Klamotten und eine aus Nicht-geduscht-Haben und reichlich Ethanolzufuhr resultierende Körperausdünstung.
»Na, kennst meinen Vino noch nicht?!«
»Jetzt schon«, stöhnte ich und tastete hilfesuchend nach Kaffee im Küchenschrank. Da war natürlich keiner, ich hatte ja noch kein bisschen eingekauft.
»Giovanni, ich habe nix zu frühstücken«, murmelte ich verlegen.
»Waas? Muss ich rufe Padrone, kriegst du Beton an die Füß’, und ab in die Spree, incredibile!«
Er schnappte sich sein Handy und wählte. Mich durchfuhr ein fürchterlicher Schreck. Da ich nach einem »Der hat doch nur Saft getrunken«-Ereignis immer einen ganz kleinlauten Kreislauf hatte, fing ich an zu zittern und rang nach Luft.
Giovanni, selbst überrascht von der Wirkung seines Spaßes, brüllte vor Lachen.
»Nix dich wolle versenke, rufe nur meine Frau an, die bringt uns was Leckeres.«
Ich war restlos fertig, aber immerhin wach.
Polternd lief Giovanni mit einem Eimer voll Werkzeug ins Bad. Ich sah auf die Uhr: 8 Uhr 15. Wie konnte jemand so viel saufen und jetzt schon wieder Wasserleitungen reparieren? Vielleicht hätte Giovanni meinen Job übernehmen sollen. In seinem Blaumann und mit der Mütze, unter der fast nur der riesige Schnauzbart hervorschaute, erinnerte er mich irgendwie an Mario, den furchtlosen Klempner aus dem Videospiel. Amüsiert stand ich hinter ihm im Bad und wartete darauf, dass er sich gleich mit drei Saltos die Rohre hinaufschwingen würde.
Die Türklingel fräste erneut an meiner Hirnrinde, und Super-Mario rief: »Is meine Frau, mach mal auf!«
Es waren Giovannis Frau und Rafaele, die mit Kaffee, Brot und passenden Aufstrichen meine Küche aufhübschten.
»Maria«, stellte sie sich vor. »Wie sieht’s denn hier aus!?«
Sie war klein, drall und auch schwarzhaarig, ein richtiges italienisches Energiebündel. Ehe ich etwas Entschuldigendes erwidern konnte, hatte sie von irgendwoher einen Putzlappen gezaubert und wischte los, während Rafaele die Frühstückszutaten kredenzte.
Wieder ging die Türklingel. Ich kam mir schon vor wie in einer schlechten TV-Soap und schlurfte erneut zur Tür. Es war Boris.
»Wie siehst du denn aus? Kein Wasser? Oder ’ne Leiche in der Badewanne?«
»Jaja, witzig«, nörgelte ich.
»Kommste ausladen?«
»Och Boris, nööö, nich jetzt. Ich hab echt ’n harten Tag hinter mir. Geh erst mal in die Küche und schnapp dir ’n Saft!«
Rafaele entkorkte bereits die erste Weinflasche. In meiner Wohnung war ein Lärm, wie zwei Norbert Pawliczeks zusammen ihn nicht hätten veranstalten können. Giovanni hämmerte an den Rohren, Maria hatte mittlerweile einen Staubsauger entdeckt, und Boris und Rafaele prosteten sich zu. Ich nahm mir einen Kaffee und etwas Gebäck, setzte mich an den kleinen Klapptisch am Küchenfenster und sah hinaus. Jetzt wartete ich nur noch darauf, dass der Freak erschien, mit dem Anliegen, meine Fenster zu bemalen, um dann bei jedem misslungenen Versuch mit dem Kopf eine Scheibe zu zertrümmern. Allmählich machte ich mir Sorgen im Hinblick auf meinen Tagesablauf. Ich hatte eine Verabredung, ich musste einkaufen, ich musste duschen … und eigentlich musste ich auch noch schlafen.
Ich beschloss, mit dem Anstrengendsten anzufangen, und verabschiedete mich kurz von meinen Gästen, um meine Besorgungen zu erledigen. Auf der Treppe kam mir eine ältere Frau entgegen und fragte ein klein wenig echauffiert und mit schneidender Stimme:
»Junger Mann, haben Sie nasse Gartenabfälle in die Altpapiertonne getan?«
»Aber nein, gute Frau, wer macht denn so was?«, entrüstete ich mich solidarisch.
»Sie waren’s also nicht?«
Sie trat bis auf wenige Zentimeter an mich heran. Ich schüttelte den Kopf. Die Dame beäugte mich argwöhnisch.
»Dann wars der Smolarek, die Sau!«, stieß sie plötzlich hervor.
Die Lady machte mir ein bisschen Angst.
»Ich habe auch gar keinen Garten!«, rief ich ihr nach, um jeglichen Verdacht von mir abzuschütteln, und flüchtete auf die Straße. Den Rasenmäher verschwieg ich.
Als ich eineinhalb Stunden später zurück in meine Küche kam, die Maria wirklich auf Hochglanz gebracht hatte, waren bereits zwei Flaschen Wein geleert. Giovanni, der wohl meine Abwesenheit als willkommenen Anlass genommen hatte, eine Kunstpause einzulegen, verschwand in Richtung Keller, auf der Suche nach warmem Wasser in den unendlichen Weiten des Rohrnetzes. Langsam wurde ich nervös. Ohne zu duschen, würde ich zu meiner heutigen Verabredung nur in reichlich derangiertem Zustand erscheinen können.
»Und? Wie is der Job?«, wollte Boris wissen.
»Oh super«, sagte ich »muss viel weggehen und quatschen und trinken.«
Ich wusste nicht, wie viel ich von meiner neuen Tätigkeit erzählen durfte.
Die Eingangstür stand noch offen. Plötzlich lugte ein jüngerer Kerl herein und fragte: »Hallo, ich wohne im Vierten, ist hier auch kein Wasser?«
»Problem ist gleich behoben, trink so lange einen«, erklärte ich ihm die Lage. Er hieß Paul, war Medizinstudent im elften Semester, ziemlich groß, ziemlich blond, und fühlte sich sofort wohl in unserer Küche. Ich warf sämtliche Tagespläne erst einmal über den Haufen und putschte mich mit Kaffee auf.
Als ein Außendienstmitarbeiter des Stromversorgers wegen unserer gewünschten Energienutzung eintraf, war die Kapazität der Küche weitgehend ausgereizt und der Flur musste in den Bereich der Verköstigungszone aufgenommen werden. Giovanni kam zum dritten Mal fluchend aus dem Keller, hatte aber dieses Mal in weiser Voraussicht drei neue Weinflaschen mitgebracht.
»Wieso ist der Strom aus regenerativen Quellen immer noch so viel teurer als Atomstrom? Hab ich früher nur demonstriert, damit ich jetzt arm werde?«, regte ich mich auf, als mir der Strommann die Tarifgruppen erläuterte. Vor lauter Ärger trank ich einen Schluck Wein aus seinem Glas.
»Eigentlich ist Atomstrom ja mittlerweile sehr sicher«, versuchte er mich zu beruhigen, »nehmen Sie doch einen Mix mit zehn Prozent Wasser- und Windenergie.«
»Wissen Sie, was wirklich sicher ist?«, fragte Boris geheimnisvoll, der sich gerade von der Küche zur Toilette durchkämpfte.
»Sich-Erhängen«, prustete er, den Ernst der weltweiten klima- und umwelttechnischen Lage mit Füßen tretend. Ich fing nun doch an, Wein zu trinken.
15 Uhr
Boris und Paul waren einem »Der hat doch nur Saft getrunken«-Zustand schon bedrohlich nahe, Maria und Rafaele räumten ihr Werkzeug zusammen, da sie in den Laden mussten. Giovanni und zwei Männer vom städtischen Wasserwerk versuchten, die zwischenzeitlich komplett zusammengebrochene Wasserversorgung des Hauses wieder in Gang zu bringen. Ich selber diskutierte angeregt mit dem Strommann über Tarif 2G10+ und versuchte, mit Hilfe von weiterer Alkoholzufuhr einen geeigneten Rabatt für uns herauszuschlagen. Natürlich unter Wahrung der ökologischen Ressourcen unseres Planeten. Mein Handy klingelte: Pawliczek!
Der hatte mir noch gefehlt.
»Sach ma Tom, ick hab ja noch was verjessen. ’Ne Frage. Du bist ja nich vorbestraft oder so wat?«
»Ich? Nö. Nich, dass ich wüsste.«
»Det ist jut, Tom. Det waret schon.«
Vorbestraft? Was sollte das? Ich war schon zu angetrunken, um mir diese Frage zu beantworten.
Der Stromverkäufer hatte jetzt den maßgeschneiderten Tarif für uns. Single, zwei Herdplatten, ohne Spülmaschine, und Wochenendheimfahrer – was wir einfach mal so annahmen, in der Tat brauchte ich gerade an Wochenenden kaum Licht. 80 Prozent regenerativ, zehn Prozent Kohle und zehn Prozent Atom. Atom nur, weil mir der mittlerweile erheblich alkoholisierte Strommann hinsichtlich der armen, von der Arbeitslosigkeit bedrohten litauischen Atomkraftwerkmitarbeiter und Familienväter ein schlechtes Gewissen eingeredet hatte. Meine früheren Freunde konnten mich ja zum Glück nicht sehen oder erhielten gar Vertragseinsicht, sonst hätten sie mir sicherlich nachträglich den zwei Quadratmeter großen Atomkraft – Nein danke!-Aufkleber vom VW-Bus gerissen, mich darin eingewickelt und direkt in eine Brennkammer geschoben. Die zehn Prozent Kohle, naja, ein Onkel war Kumpel gewesen, und so musste man in unserer Familie immer was für den Bergbau tun. Und außerdem verschafften uns Giovannis Wein und weitere, unschlagbar einleuchtende Argumente von Boris einen saftigen 20-Prozent-Rabatt, also zahlten wir die Kohle und den Atomanteil im Prinzip gar nicht.
Um kurz nach 17 Uhr 30 dann Jubelschreie aus dem Bad. Giovanni und mittlerweile drei städtische Monteure fielen sich in die Arme und stießen mit 40-Millimeter-Abschlussmuffen an, die mehrmals mit Prosecco befüllt wurden. Wie die Ewings um eine neue Ölquelle, standen wir nun im Bad um den Brausekopf und bejubelten ausgelassen die ersten warmen Wassertropfen. In der Küche wurde mittlerweile Pizza gereicht, ich schnappte mir frische Klamotten und sprang in die Dusche. Kurz darauf klopfte Super-Mario an der Tür.
»Hier is Signorina, will zu dir. Scheene Signorina!«
Er entfernte sich brabbelnd. Na, Helen würde ja einen tollen Eindruck bekommen. Hastig sprang ich in die Klamotten und trat in den Flur. Die Feierlichkeiten hatten sich jetzt bereits bis in mein Flaschenzimmer ausgedehnt. Mittendrin stand Helen. Sie schien das alles zu amüsieren und sie redete mit Paul. Sie war immer noch ziemlich rothaarig und hübsch, nur etwas kräftiger als früher, vielleicht waren es aber auch nur die Klamotten.
»Da bist du ja. Kaum hier und schon Party, ist ja wie früher«, lachte sie mich an.
»Nö, eigentlich war nur mein Warmwasser kaputt. Sind sehr hilfsbereite Menschen hier.«
»So, und die gehen jetzt alle mit mir runter zu meinem Auto«, frohlockte Boris. Er konnte zwar kaum noch stehen, hatte aber immerhin noch den lichten Moment, alle Beteiligten zum Schleppen zu verhaften.
»Na kommt, zusammen geht’s schnell, packen wir’s!«, rief Helen, sprang auf und klatschte in die Hände. Boris grinste zufrieden und torkelte zur Treppe. Die anderen waren nicht ganz so begeistert, wollten sich aber nicht als Spielverderber outen. Nur Giovanni kam zu mir und sagte:
»Ich muss runter in die Laden, kriege Krach mit Maria. Kommstu später runter mit Signorina und esst was Gutes!?«
Er dampfte ab, während sich der Rest unter Helens Anleitung als Menschenkette auf der Treppe und im Hof postierte. In der Tat war die Sache piff-paff erledigt. Die Helfer hatten zwar nicht mehr das motorisch-sensorische Feingefühl, um wirklich alles festzuhalten, aber es gab durchaus Gegenstände, die heil nach oben gelangten. Je mehr Sachen die Treppe hinunterpolterten, desto lustiger wurde die ganze Angelegenheit. Ein paar Hausbewohner blickten verwundert und genervt aus ihren Türen. Einige stießen aber sogar zu uns, um zu helfen.