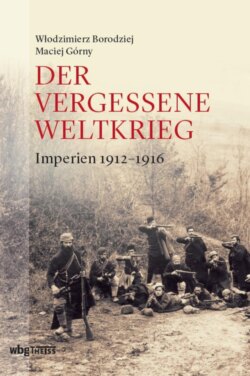Читать книгу Der vergessene Weltkrieg - Maciej Górny - Страница 10
Kapitel 2
Präludium – der Balkan 1912–1913
ОглавлениеIm Sommer 1914 lag der letzte große Krieg in Europa mehr als vierzig Jahre zurück. Es war eine Zeit nie da gewesenen ökonomischen und kulturellen Fortschritts. Der lange Frieden begünstigte Wohlstand, technische Entwicklung und sozialen Wandel. Zwischen der französischen Niederlage im Krieg mit Preußen 1871 und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden in den europäischen Städten Straßenbahnen eingeführt, in den größeren – London, Paris, Berlin oder Budapest – sogar U-Bahnen. Es entstanden neue Fabriken, deren Arbeiter als Gruppe so stark wurden, dass die Politik sie zu umwerben begann. Die Großmächte führten zwar überseeische Feldzüge, deren Präsenz im Alltag der Europäer sich aber auf die Schlagzeilen der Tageszeitungen beschränkte. Nicht nur in Westeuropa herrschten Frieden und Fortschritt. Auch aus dem Erfahrungshorizont der meisten Bewohner Ostmitteleuropas war der Krieg verschwunden. Wenn er doch darin auftauchte, war er zeitlich und geografisch weit entfernt. Zwischen Warschau und der Mandschurei, wo Anfang 1905 die russische Niederlage im Krieg mit Japan besiegelt wurde, liegen mehr als 8000 Kilometer.
Für die Länder südlich der Donau hingegen war dieser Zeitabschnitt eine Abfolge von Kriegen, Aufständen, Rebellionen und Umstürzen. Selbst wenn wir ‚gewöhnliche‘ Staatsstreiche und Königsmorde außer Acht lassen, war die Dynamik gewaltsamer Veränderungen außergewöhnlich stark. 1876 brach der bulgarische Aufstand gegen die Osmanen aus, dem sich auch Serben und Montenegriner anschlossen. Daraus wurde ein zweijähriger Krieg, in dem Russland den unterdrückten „slawischen Brüdern“ zu Hilfe eilte und an dessen Ende die russische Armee vor den Toren Konstantinopels stand. Der Berliner Kongress beruhigte die Lage nur kurz. 1883 erhoben sich die serbischen Bauern gegen ihren Staat. Sie rebellierten gegen die erdrückende Steuerlast, doch unmittelbarer Anlass der Revolte war die Konfiskation von privaten Waffen. Es folgte eine Reihe von Bauernaufständen auf dem Balkan bis hin zum größten 1907 in der rumänischen Moldau, wo bei Auseinandersetzungen mit der Armee rund 10.000 Menschen starben, das heißt proportional mehr als während der Russischen Revolution der Jahre 1906–07. 1885 annektierte Bulgarien die autonome osmanische Provinz Ostrumelien, worauf Serbien mit einem unerwarteten Angriff reagierte. Die Bulgaren schlugen die Attacke bei Slivnica zurück. 1893 entstand die Innere Makedonische Revolutionäre Organisation (IMRO), die zunächst politisch, bald aber mit Terrorakten für die Autonomie der makedonischen Vilajets (Provinzen) des Osmanischen Reiches kämpfte. Drei Jahre später führte ein Aufstand der griechisch-orthodoxen Bevölkerungsmehrheit gegen die osmanische Herrschaft auf Kreta zum Türkisch-Griechischen Krieg; trotz der griechischen Niederlage musste der Sultan unter dem Druck der Großmächte der Insel eine weitgehende Autonomie unter Kontrolle westeuropäischer Truppen gewähren.
Die ständigen Konflikte waren eine der Ursachen für die schleppende Modernisierung des Balkans. Kriege kosten Geld und die Region litt an chronischem Kapitalmangel. Nur die rumänische Ölindustrie zog schon vor dem Ersten Weltkrieg in nennenswertem Umfang ausländische Investoren an. Abgesehen davon, war Rumänien wie die übrigen Länder auch auf Kredite aus Frankreich, Deutschland oder Österreich-Ungarn angewiesen, um Investitionen zu finanzieren, ohne die ein modernes Staatswesen nicht auskam: Schulen, Krankenhäuser, vor allem aber die Armee. Die Gesellschaften auf dem Balkan waren überwiegend agrarisch geprägt und konservativ. Nur in Griechenland lebten mehr als 20 Prozent der Bevölkerung in Städten. Als größte Stadt der Region hatte Bukarest – das „Paris des Ostens“ – am Ende des ersten Jahrzehnts etwas über 300.000 Einwohner, etwa halb so viel wie Lodz. Die Hauptstadt Serbiens war mit weniger als 100.000 Einwohnern fünfmal kleiner als Riga.
Obwohl Europa den jungen Balkanstaaten enteilte, war ihre kurze Geschichte von zivilisatorischen und territorialen Erfolgen geprägt, letztere immer auf Kosten des Osmanischen Reiches. Die ständigen Demütigungen durch die Nachbarstaaten und die sie unterstützenden Großmächte sowie ausbleibende Reformen führten 1908 zu einem Aufstand innerhalb der osmanischen Armee, der den Auftakt zur Jungtürkischen Revolution bildete. Abgesehen von der allgemeinen Forderung nach Reformen, hatte die Bewegung keine festen Strukturen und kein konkretes politisches Programm. Erster Schritt war die Wiedereinführung der liberalen Verfassung aus dem Jahr 1876 (eigentlich handelte es sich um eine Einführung, da sie zuvor nicht in Kraft getreten war), 1909 musste der erzkonservative Sultan Abdülhamid II. abdanken. Anfangs genossen die jungen Offiziere, die das Fundament der Revolution bildeten, die Unterstützung der nationalen Minderheiten, zumal der Albaner. Bald aber zeigten sich die autoritären Züge des neuen Regimes. Die neu entstandenen Parteien und politischen Organisationen wurden für illegal erklärt. Die Empörung war dort am größten, wo die Revolution die größte gesellschaftliche Energie freigesetzt hatte – in Albanien. Der Widerstand der Albaner mündete in einen Aufstand gegen die erdrückende Steuerlast und die Zentralisierungspolitik. Der Armee gelang es nicht, ihn zu unterdrücken. Das Gelände war bergig, die Bevölkerung kampfbereit. Die Montenegriner lieferten den Aufständischen heimlich Waffen. Die größte Gefahr für die osmanische Herrschaft lag aber woanders. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten neben ethnischen Türken und Kurden die muslimischen Albaner das größte Kontingent der osmanischen Armee gestellt, viele von ihnen hatten militärisch Karriere gemacht. Noch während der Balkankriege sollten sich einige Armee- und Korpskommandeure der osmanischen Truppen auf ihre albanische Abstammung berufen. Die Eruption des albanischen Nationalismus deutete an, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern würde. Unterdessen wurde die Position der Hohen Pforte mit jedem Monat schwächer. Zu allem Überfluss startete im Herbst 1911 Italien eine stark verspätete Aufholjagd im Wettlauf mit den Kolonialmächten. Als Kolonie erkor es sich das osmanische Libyen aus und griff Tripolis an. Die vom Landesinneren abgeschnittenen osmanischen Garnisonen schlugen sich wacker und nichts deutete auf eine schnelle Kapitulation Istanbuls hin. Italienische Aktivitäten abseits der Hauptkriegsschauplätze sorgten aber für eine dramatische Verschlechterung der Situation. Die italienische Flotte blockierte die Dardanellen, legte den Seehandel lahm und beschoss auch Beirut. Und schlimmer noch, sie versorgte die rebellierenden Albaner mit Waffen und Geld.