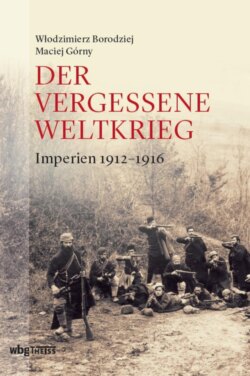Читать книгу Der vergessene Weltkrieg - Maciej Górny - Страница 13
Der Zweite Balkankrieg
ОглавлениеUnter dem Druck der Großmächte kehrten die Kriegsparteien in London an den Verhandlungstisch zurück. Ende Mai unterzeichneten sie einen Vertrag, der aber niemanden zufriedenstellte. Die Türken verloren fast alle europäischen Besitzungen des Sultans – mehr als vier Fünftel des Territoriums und über zwei Drittel der dortigen Bevölkerung. Das von den Großmächten geschaffene Albanien erhielt Gebiete, auf die Montenegro, Serbien und Griechenland Anspruch erhoben, jedoch nicht alle Gebiete, die von Albanern bewohnt wurden. Serbien und Griechenland vertraten die Auffassung, ihnen stünden als Ausgleich für einen Teil Albaniens entsprechende Territorien in Makedonien zu, die sie de facto besetzt hatten. Das wiederum war für Bulgarien inakzeptabel, das eben wegen Makedonien einen neuen Krieg begann. Sofia forderte einen Anteil an der Kriegsbeute, der der Kampfbeteiligung und den erlittenen Verlusten entsprach.
Unterdessen mischte sich ein neuer Akteur in den Streit der Verbündeten ein. Rumänien beanspruchte ein territoriales Äquivalent in der Dobrudscha. Das Land hatte sich zwar nicht am Krieg gegen das Osmanische Reich beteiligt, doch es sah im übermäßigen Zuwachs Bulgariens eine Gefahr für das Gleichgewicht auf dem Balkan. In der bitteren Satire Caracterul naţional al măgarilor (Der Nationalcharakter der Esel) verhöhnt der liberale rumänische Ökonom Ştefan Zeletin die damalige Haltung vieler seiner Landsleute – eine Figur im Eselsparlament stimmt dieses Lied an:
Höre gut zu, schmutziger Bulgare,
Wage nicht länger, uns zu verlachen!
Für das, was du mit dem Schwert erobert,
Während wir hinter dem Ofen schliefen,
Indes du große Schlachten schlugest,
Sollst du uns ein Trinkgeld geben!
Unsere Faulheit – dein Profit,
Als du dem Schicksal die Stirn botest,
Die Wut der Heiden besiegtest.
Und jetzt, da wir einen Knochen wollen,
Trittst du uns, statt uns zu danken?
Du sollst uns ein Trinkgeld geben!12
Damit artikulierte Zeletin nicht nur seinen Standpunkt in dieser Frage, sondern traf offenbar auch die Position der bulgarischen Regierung, die über die Dreistigkeit der Nachbarn empört war.
Die multilateralen Verhandlungen stockten nicht nur wegen Rumänien. Die Bulgaren waren zu keinerlei Zugeständnissen bereit, die Verbündeten verzögerten den Abzug aus Gebieten, die Sofia als seinen Teil Makedoniens ansah. Griechenland und Serbien betrachteten die Provinz schon als dauerhaften Besitz. Die Politik des nationalen „Proselytismus“ war in voller Fahrt. Die bulgarischen Lehrer in Makedonien mussten sich entscheiden: Entweder künftig in serbischer oder griechischer Sprache unterrichten oder – im besten Fall – nach Bulgarien übersiedeln. Ansonsten drohten ihnen die überfüllten Gefängnisse von Skopje oder Thessaloniki. Es kam vor, dass lokale Funktionäre und Geistliche „spurlos verschwanden“. Meist aber zwang man die Einheimischen zur „freiwilligen“ Annahme der dominierenden Nationalität. Die Experten des Carnegie Endowment for International Peace, die nach Kriegsende eine Untersuchung zu den Kriegsverbrechen aller Parteien durchführten, zitieren in ihrem Bericht folgende Schilderung aus dem griechischen Teil Makedoniens:
Die griechischen Soldaten und Offiziere stellen zuerst fest, ob die Bevölkerung griechisch oder bulgarisch war. Wenn es sich um Bulgaren handelte, befahlen sie den Bauern, wieder Griechen zu werden und in Frieden weiterzuleben.13
Die bulgarische Presse empörte sich über die tatsächlichen und imaginierten Grausamkeiten der einstigen Verbündeten. Man schrieb über makedonische Kinder, die angeblich von griechischen und serbischen Soldaten ermordet wurden, weil sie auf die Frage: „Wer bist du?“ geantwortet hätten: „Ein kleiner Bulgare.“ Mitte des Jahres war das Land von einer regelrechten Makedonien-Obsession befallen. Im Juni hieß es in der Sofiaer Tageszeitung Mir:
Sich mit dem Bruder aus dem einzigen Grunde verbünden, ihn zu betrügen, zu bestehlen und ihm zu nehmen, was der eigentliche Gegenstand des Bundes war […], nachdem er die schwersten Verluste erlitt und die blutigsten Schlachten gewann – das ist ein unter den Völkern unerhörtes Verbrechen, und mit eben diesem Verbrechen hat sich nun Serbien befleckt.14
Ein neuer Krieg, wenngleich noch unausgesprochen, hing in der Luft.
Der Ausbruch erfolgte unter einigermaßen verblüffenden Umständen. Noch im Mai hatten Griechenland und Serbien ein gegen Sofia gerichtetes Geheimabkommen unterzeichnet. Doch in der Nacht vom 29. auf den 30. Juni 1913 attackierte Bulgarien serbische und griechische Einheiten in Makedonien. Der Befehl kam vom Zaren, Teile der Regierung und des Militärs waren nicht informiert. Es kam zu einem Führungschaos, infolge dessen die Offensive nach ersten Erfolgen gestoppt wurde, was den Gegnern Zeit zur Neuordnung und zum Gegenschlag gab. Die bulgarische Regierung wollte den Konflikt mit den einstigen Verbündeten abwenden. Doch Serben und Griechen warteten den Ausgang des innerbulgarischen Machtkampfs nicht ab. Der Krieg kam ihnen gelegen, sie waren vorbereitet und, weil die Bulgaren ihn begonnen hatten, trugen nicht sie die Verantwortung für den Bruch des Bündnisses. Der serbische König Peter I. konnte in der Kriegserklärung guten Gewissens verkünden:
Die Bulgaren, unsere bluts- und glaubensverwandten Brüder, unsere Bundesgenossen, haben in unmenschlicher Weise Verwundete ermordet, den Vertrag mit dem Schwerte zerstört, Freundschaft und Brüderlichkeit vernichtet. Die Bulgaren haben der serbischen Hilfe vergessen und dem Slawentum und der ganzen Welt ein Beispiel von Undankbarkeit und Habsucht gegeben. Dieser traurige Krieg ist mir aufgezwungen worden.15
Die zurückweichenden Bulgaren wurden mit Artillerie beschossen, die gut ausgestatteten gegnerischen Truppen setzten ihnen nach. Rasch verlagerten sich die Kampfhandlungen von Makedonien auf bulgarisches Kerngebiet. Sofia drohte von den Serben besetzt zu werden.
Doch die bulgarische Armee fing sich und bewies, dass sie im Ersten Balkankrieg nicht zu Unrecht als leistungsfähigste Armee der Region gegolten hatte. Anfang Juli attackierten von Sofia kontrollierte Partisaneneinheiten der IMRO im Rücken der serbischen Armee. Mitte des Monats schlug General Michail Sawow, einer der brillantesten Generäle des vorigen Kriegs, bei Kalimantsi eine serbische Offensive zurück, anschließend verlagerte er seine Truppen nach Süden, wo er Ende des Monats bei Kresna Gorge die griechische Armee fast komplett einkreiste. Unter den Eingekesselten befand sich auch der Oberkommandierende König Konstantin, der seinem wenige Monate zuvor ermordeten Vater auf den Thron gefolgt war. Die Diplomatie rettete die Griechen vor der völligen Katastrophe. Die neue bulgarische Regierung, die nicht an einen militärischen Sieg glaubte, bat um einen Waffenstillstand.
Zwei Ereignisse brachten Bulgarien dazu, die Kampfhandlungen einzustellen. Am 10. Juli beschloss Rumänien, sich auf eigene Faust das ihm zustehende „Trinkgeld“ zu sichern. Ein Heer von mehreren Hunderttausend Soldaten überschritt die Grenze und marschierte ungehindert von den schwachen bulgarischen Einheiten auf Sofia zu. Es gab so gut wie keine Kämpfe und die mehreren Tausend Opfer auf rumänischer Seite starben nicht durch Kugeln, sondern an Krankheiten. Die Rumänen erwiesen sich überdies als vergleichsweise zivilisierte Besatzer, zumal im Vergleich mit den übrigen Beteiligten der Balkankriege. Rumänische Flugzeuge flogen zwar Angriffe auf Sofia, warfen aber nur Flugblätter ab. Trotz des drohenden Verlusts der Hauptstadt gingen die Kämpfe in Makedonien weiter. Entschieden wurden sie erst mit dem Kriegseintritt des Osmanischen Reiches. Der jungtürkische Anführer Enver Pascha besetzte mit einer mehr als 200.000 Mann starken Armee fast widerstandslos zunächst die bulgarischen Stellungen bei Çatalca und anschließend Edirne. Es war der erste türkische Erfolg nach einer langen Reihe militärischer Blamagen und diplomatischer Fehlschläge.
Der Zweite Balkankrieg dauerte nur einen Monat, doch er war blutiger als der Erste. Vor allem die bulgarischen Verluste waren hoch – dieses Mal waren die Gegner zahlenmäßig überlegen. Auch die Friedensverhandlungen fanden unter anderen Bedingungen statt. Die Delegierten der Balkanstaaten trafen sich in Bukarest. Der Einfluss der Großmächte wurde auf ein Minimum begrenzt. Bulgarien musste einen großen Teil seiner jüngsten Eroberungen abtreten und darüber hinaus Rumänien einen Teil der Dobrudscha und die Festung Tutrakan überlassen. Die bulgarisch-türkischen Verhandlungen fanden nicht in Bukarest, sondern in Istanbul statt. Im Herbst erhielt das Osmanische Reich den größeren Teil Ostthrakiens mit den blutigsten Schlachtfeldern des Ersten Balkankriegs sowie Edirne zurück. Der Friede auf dem Balkan sollte ein Jahr halten.
* * *
Richard C. Hall bezeichnet die Balkankriege als „Präludium des Ersten Weltkriegs“. Aus heutiger Sicht kann man dieser Sicht kaum widersprechen. Die Kriege der Jahre 1912 und 1913 waren Konflikte desselben Typs wie der Erste Weltkrieg. Man benutzte ähnliche Waffen (auf dem Balkan gab es fast keine Rüstungsindustrie, die Kriegsparteien bezogen ihre Waffen von denselben Produzenten wie die Armeen der Großmächte). Die Kommandierenden wandten die gleiche Taktik an, die 1914 im Westen und im Osten scheitern sollte. Die Türken wurden Opfer ihrer Doktrin der Offensive um jeden Preis. Die Serie ihrer Niederlagen endete erst, als sie zur verzweifelten Verteidigung der letzten Stellungen vor Istanbul gezwungen waren. Ihr Versuch, „die Initiative zurückzugewinnen“, endete im Februar 1913 in einem erfolglosen Blutbad. Die Kämpfe in Thrakien, wo auf recht ebenem Terrain große Massen von Infanterie aufeinandertrafen, wiesen auf die bevorstehenden Ereignisse in Flandern voraus. Die wellenartigen Bajonettangriffe der bulgarischen Fußtruppen „im japanischen Stil“ (das heißt nicht verstreut, sondern in kompakter Formation) verpufften bei Çatalca im Feuer der türkischen Maschinengewehre und Kanonen. Der Sanitätsdienst aller Parteien erwies sich als völlig unzureichend, was im Fall des osmanischen Heeres nicht überraschte, weil er dort praktisch überhaupt nicht existierte. Doch selbst die bulgarischen Lazarette, die in der europäischen Presse gelobt wurden und die auf die Unterstützung freiwilliger Ärzte aus dem Ausland zurückgreifen konnten, waren mit der Versorgung einer derart großen Anzahl von Verwundeten überfordert. Die Kämpfe auf dem Balkan hätten auch Zweifel am Nutzen großer Festungen wie Edirne wecken können. Sie erwiesen sich als zu groß und schwer zu halten, zumal dort neben Tausenden Verteidigern auch Zivilisten lebten. In den entscheidenden Schlachten fehlten den Türken die Soldaten und Geschütze, die an Orten wie Edirne, Ioannina oder Shkodra gebunden waren. Trotzdem hielt letztlich keine dieser Festungen der Belagerung stand.
Die Balkankriege waren „modern“ auch in Hinsicht auf das Schicksal der Zivilbevölkerung, die auf allen Seiten Gewalt und Kriegsverbrechen ausgesetzt war. Zudem waren alle Kriegsparteien, wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß, mit dem Problem der Unterbringung und Versorgung ziviler Kriegsflüchtlinge konfrontiert; von medizinischer Hilfe war praktisch nicht die Rede. Bis 1914 wuchs die Anzahl der muslimischen Flüchtlinge in Anatolien auf über 400.000. 170.000 Griechen flohen aus Kleinasien und Bulgarien. Nach Bulgarien kamen 150.000 Menschen ohne Dach über dem Kopf und Lebensunterhalt. Die Gesamtzahl der Entwurzelten wird auf rund 900.000 geschätzt.16 Um das durch die erste massenhafte Zwangsmigration im Europa des 20. Jahrhunderts ausgelöste politische, soziale und ökonomische Drama zu verstehen, muss man diese Zahl in den Kontext anderer Kennziffern der Region stellen: In Uniform nahmen an beiden Kriegen rund 750.000 Menschen teil. Griechenland hatte nach zwei Siegen knapp fünf Millionen Einwohner, Bulgarien 4,7 Millionen und Serbien 4,5 Millionen. Keiner der Staaten war darauf vorbereitet, die Integration von Hunderttausenden Flüchtlingen zu finanzieren und zu organisieren, ihnen Wohnungen und Arbeit zu beschaffen. So verhalfen diese sich mitunter selbst zu ihrem Recht, indem sie an ihren provisorischen Aufenthaltsorten die jeweils „anderen“ attackierten: In Griechenland kam es zu Pogromen orthodoxer Christen gegen Muslime, in Ostthrakien zu Pogromen von Muslimen gegen Orthodoxe. Die örtliche Polizei half dabei mitunter ebenso mit wie die „alten“ Einwohner der jeweiligen Orte, die auf diese Weise ohne großen Aufwand die traditionelle Konkurrenz in Handel oder Handwerk ausschalteten.
Knapp zwei Jahre nach dem Bukarester Friedensschluss sollten sich noch größere Massen von Polen, Juden, Deutschen, Weißrussen, Letten, Litauern, Ukrainern und Russen in Bewegung setzten – auf der Flucht vor der deutsch-österreichisch-ungarischen Offensive oder infolge von Zwangsevakuierungen. Die Millionen von Obdachlosen, Hungernden, Arbeitslosen und Verzweifelten gelten zu Recht als eine der Ursachen der russischen Revolutionen des Jahres 1917.
Doch zurück ins Rumelien der Jahre 1912 und 1913. Obwohl die europäische Presse ausführlich über die Balkankriege berichtete, zogen weder Politiker noch Militärs die entsprechenden Schlussfolgerungen. Sie begriffen nicht, dass Infektionskrankheiten für ihre Armeen fast ebenso gefährlich waren wie die Kugeln des Feindes. Sie begriffen nicht, dass es sinnlos war, Massen von Infanteristen ins Maschinengewehrfeuer zu schicken. Die Strategen beharrten darauf, es zählten „Initiative“ und „Moral“, die am schönsten bei einem Bajonettangriff aufblühten. Man baute und rüstete mächtige Festungen mit großen Besatzungen. Man unterschätzte sowohl die zu erwartenden Verluste als auch den Bedarf an medizinischer Versorgung. Man tat kaum etwas zum Schutz der Zivilbevölkerung in den Kampfgebieten.
Was war die Ursache dieser schockierenden Kurzsichtigkeit? Immerhin zogen einige Personen durchaus die richtigen Schlüsse aus den Lehren der Balkankriege. Das Problem war nur, dass diese Personen keinen Einfluss auf das Militär hatten. Die Experten von Carnegie Endowment erreichten das Gewissen eines Teils der westeuropäischen Öffentlichkeit, drangen aber – wie Bloch ein Jahrzehnt zuvor – nicht zur Generalität durch. Auch der große polnische Linguist Jan Baudouin de Courtenay zweifelte ebenso wenig wie der Warschauer Bankier daran, dass der moderne Krieg zu einem wilden Gemetzel geworden sei und sich am Horizont eine Neuauflage in bedeutend größerem Maßstab abzeichne. Anhand eines Vergleichs der Bevölkerungszahlen der kriegführenden Staaten und der Anzahl der Gefallenen und Verwundeten rechnete er vor, welche Verluste die europäischen Großmächte in einem künftigen Krieg erleiden würden. Er kam den tatsächlichen Zahlen recht nahe.17 Die Antwort der Militärexperten auf derartige Prognosen war simpel:
Die Greueltaten, deren sich die Parteien während des Krieges gegenseitig beschuldigten, erklären sich aus den erbitterten nationalen Gegensätzen, aus der lang verhaltenden Abneigung, zum Teil aber auch aus der Halbkultur, unter deren Wirkung manche Stämme der Balkanhalbinsel auch bei milder Beurteilung dieser Frage noch heute stehen. Aber keine Tatsache hat erwiesen, daß der Zukunftskrieg blutiger und vernichtender als der Krieg der jüngsten Vergangenheit sein wird. Es ist daher ein verwerfliches Unterfangen, wenn aus dem Balkankrieg gefolgert wird, daß der Zukunftskrieg der Vernichtungskampf alles Bestehenden sein wird. Bei hoher Achtung vor den Friedensbestrebungen zeigt uns gerade der Balkankrieg die eiserne Notwendigkeit, daß ein Volk nur dann daseinberechtigt bleibt, wenn es die kriegerischen Eigenschaften pflegt.18
Die Militärs ignorierten die Erfahrungen der Balkankriege vor allem deshalb, weil es sich um den Balkan handelte. Diese Geringschätzung sollte die Armeen der Großmächte teuer zu stehen kommen. Ein knappes Jahr später fügten die „halbwilden“ Serben der deutlich besser ausgerüsteten Armee Österreich-Ungarns eine blamable Niederlage bei. Wenig später zwangen die in den Jahren 1912 und 1913 gedemütigten Türken die Briten zur Einstellung ihrer Operation in Gallipoli. Die Bulgaren wiederum stoppten fast im Alleingang mehrere Angriffsversuche der Alliierten an der Saloniki-Front.
Die Balkankriege waren für Europa noch aus einem anderen Grund wichtig, der bisher unerwähnt blieb, weil er in den Jahren des Ersten Weltkriegs kaum eine Rolle spielte (auf dem Balkan wurde er erst nach 1918 wieder aktuell, ab 1939 beeinflusste er die gesamte europäische Politik). Die Hauptakteure der Balkankriege waren davon überzeugt, dass die neuen Staatsgrenzen eine Umsiedlung der Menschen erforderten, die plötzlich zu Minderheiten geworden waren. Diese religiösen, ethnischen oder auch zugleich religiösen und ethnischen „Minderheiten“ hatten seit Jahrhunderten am selben Ort gelebt; das Osmanische Reich hatte viele Formen des Zusammenlebens entwickelt und wäre nie auf die Idee gekommen, Fremde aus seinen Grenzen auszusiedeln, die schon seit der Eroberung Konstantinopels und des Balkans Untertanen der Hohen Pforte waren. Die Jungtürken sahen das völlig anders – ähnlich wie die zeitgenössischen Bulgaren, Serben und Griechen.
Der moderne Nationalismus des 20. Jahrhunderts betrachtete die infolge der Grenzverschiebungen entstandenen Minderheiten als Ballast auf dem Weg zur Errichtung eines normalen Staats – wie etwa Deutschland oder Großbritannien, wo niemand sich (allzu sehr) den Kopf über Polen oder Iren zerbrach. Auf dem Balkan gab es freilich im Verhältnis ein Vielfaches an „Fremden“, das heißt Angehörigen einer anderen als der erträumten Staatsnation. Selbst wenn viele von ihnen im Verlauf des Krieges bereits geflüchtet waren, war das Problem längst nicht gelöst und verlangte nach modernen Ansätzen jenseits der Tradition, des tief verwurzelten Gewohnheits- und des im Entstehen begriffenen Völkerrechts, die alle den Begriff der grenzüberschreitenden Umsiedlungen nicht kannten. 1913 begannen Bulgarien und das Osmanische Reich mit Verhandlungen über einen „Bevölkerungsaustausch“. Im September 1913 wurde in Istanbul ein Abkommen unterzeichnet, das den Austausch der Bevölkerung entlang eines 15 Kilometer langen Grenzstreifens vorsah und somit de facto die Flucht von Zehntausenden Menschen in den vergangenen zwei Jahren sanktionierte. Außerdem garantierte es – sechs Jahre vor dem Versailler Minderheitenschutzvertrag – den vollständigen Schutz der Rechte der auf dem Territorium des anderen Staates verbleibenden Minderheiten. Ein halbes Jahr später begannen griechische und türkische Diplomaten mit den Verhandlungen. Zu dem Ergebnis schreibt Philipp Ther treffend:
Für die griechische und osmanische Staatsführung war der Bevölkerungsaustausch ein technisches Problem, kein menschliches oder moralisches. […] Überhaupt fällt bei den Verhandlungen von 1914 der rationale Duktus auf, während das Leid der Betroffenen allenfalls am Rand erwähnt wurde. Auch wenn ein äußerlich emotionsloser Zugang zu den Grundlagen der Diplomatie gehört, erzeugten die Verhandlungen in Kombination mit bevölkerungstechnischen Utopien eine aus heutiger Sicht erschreckende Dynamik. Während am Anfang der griechisch-türkischen Konsultationen nur Thrakien und überschaubare Gruppen behandelt wurden, betrafen die Gespräche einige Monate später etwa die Hälfte Griechenlands und den gesamten Westen der heutigen Türkei. Es ging damit um das Schicksal von weit über einer Million Menschen. Sie waren jedoch nicht geflohen, sondern lebten noch größtenteils in ihrer Heimat. Es handelte sich mithin nicht um eine Bestätigung eines kriegsbedingten Status quo, sondern um eine zukunftsgerichtete Maßnahme.19
Der fundamentale Wandel im Verständnis der Regeln des Zusammenlebens von menschlichen Gruppen und der individuellen Menschenrechte fand im „zivilisierten Europa“ vorerst wenig Beachtung. Für die Völker und Staaten der Balkanhalbinsel indes prägten die Lösung des Konflikts und die Akzeptanz der Idee des Bevölkerungsaustauschs die Politik der nächsten Jahre. Die Leichtigkeit, mit der man 1913 und 1914 die Umsiedlungen ausgehandelt hatte, weckte die Hoffnung, dass sich nach einem siegreichen neuen Krieg die eroberten Territorien wieder leicht würden säubern lassen. Serbien, dem man einen Zugang zur Adria in Albanien verweigert hatte, verlegte sein Expansionsstreben zunehmend auf Österreich-Ungarn. Griechenlands territorialer Appetit, der in Makedonien mehr als gestillt worden war, richtete sich nun auf Kleinasien, wo man die Megali Idea verwirklichen wollte. Das „gekreuzigte“ und von ausnahmslos allen Nachbarn „verratene“ Bulgarien lauerte auf eine Gelegenheit zur Veränderung des Status quo. Die tiefgreifendsten Veränderungen bewirkte der Krieg freilich im Osmanischen Reich. Bei Kriegsausbruch war es ein multiethnisches Gebilde auf der Suche nach einer die heterogenen Provinzen einenden Idee, es reichte vom heutigen Albanien bis zum heutigen Israel, Jordanien und Irak. Bei Kriegsende zeichnete sich schon der türkische Nationalstaat ab, in dem nur drei „Fragen“ zu lösen waren: die arabische, die armenische und die griechische (die kurdische spielte noch keine Rolle). Ömer Seyfeddins Erzählzyklus Primo, der türkische Junge dokumentiert auf faszinierende Weise den mentalen Wandel, den die Türkei in dieser Zeit durchlief. Der erste, unter dem Eindruck der italienischen Invasion in Libyen entstandene Teil schildert das Zerbrechen der Ehe eines aufgeklärten türkischen Ingenieurs und einer Italienerin in Thessaloniki. Ihr Sohn Primo weigert sich, mit der Mutter nach Italien zu gehen, und entdeckt seine türkische Identität. Nach der Besetzung Thessalonikis durch die Griechen beschließt der Junge, der die Demütigung seines Vaterlandes nicht erträgt, sich das Leben zu nehmen. In der Nacht zuvor träumt er einen Traum, in dem sich die Hoffnungen der türkischen Nationalisten manifestieren:
Bulgarische Witwe mit Kind in Thrakien.
Er ging durch weite Täler, die voll waren von heißem roten Blut und den Leibern von Millionen getöteter Feinde […]. Da erstrahlte von Osten, von Turan her, ein leuchtender Halbmond am blauen Himmel … Zwischen seinen Spitzen flackerte ein kleiner Stern … Primo schaute, von Entsetzen gepackt … Seine Füße waren nass … er beugte sich vor und sah, dass er bis zu den Knien in Blut stand … Es war das Blut der Feinde der Türkei … Das Blut bildete einen großen See … Eine endlose, karminrote Fläche … die Mond und Stern spiegelte … Ach, unser Banner wird geboren; unsere wahre Flagge, die Verkörperung unserer heiligen Flagge.20
Als Seyfeddin seine nationalistischen Parabeln veröffentlichte, waren die „blutigen Täler“ auf dem Balkan längst mehr als bloße Fantasie. Bald sollten ähnliche Bilder für ganz Europa Wirklichkeit werden.