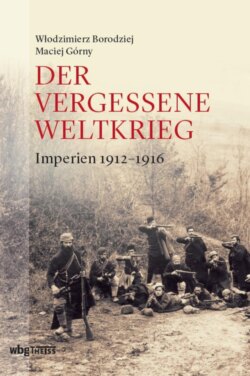Читать книгу Der vergessene Weltkrieg - Maciej Górny - Страница 9
Juli 1914
ОглавлениеMit der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand beginnt für die Imperien der Monat der Schande. Vier Wochen lang beraten ununterbrochen die Kabinette, Außenministerien und Generalstäbe verfassen im Gleichschritt Memoranden. In den Monarchien bespricht man sich mit den Herrschern. Im Hintergrund erscheinen hier und da einflussreiche Bankiers, Industrielle und Chefredakteure, mitunter Fraktionsvorsitzende. Die beiden ersten Gruppen spielen keine große Rolle, es geht nicht um Geld, sondern ums Prestige, um den Großmachtstatus. Auch Zeitungsherausgeber und Politiker außerhalb der Regierung haben de facto nicht viel zu sagen, doch sie werden gebraucht, um die Öffentlichkeit auf den Krieg einzustimmen.
In allen Staaten entscheiden Gruppen von einem bis mehreren Dutzend Männern, die meisten im mittleren Alter (wenngleich auch einige Ältere darunter sind). Der Kreis ist aufgrund der Jahreszeit reduziert. Wilhelm II. verbringt die entscheidenden Wochen auf seiner Jacht. Sein Kriegsminister General Erich von Falkenhayn erholt sich währenddessen auf einer Insel in der Nordsee. Helmuth von Moltke (der Jüngere) trifft am Tag des Attentats zur jährlichen Sommerfrische in Karlsbad ein. Der Tod des Erzherzogs beeindruckt ihn offensichtlich nicht. Erst aufgrund der Nachricht vom österreichisch-ungarischen Ultimatum an Serbien bricht er den Urlaub ab und kehrt am 25. Juli nach Berlin zurück. Die Deutschen sind keine Ausnahme: Serbiens Generalfeldmarschall Radomir Putnik hätte um ein Haar gar nicht am Krieg teilgenommen. Er verbringt den Sommer 1914 in einem Sanatorium im österreichischen Bad Gleichenberg. Auf der Heimreise wird er in Budapest von der ungarischen Gendarmerie festgenommen. Auf persönliche Anordnung Franz Josephs I. kommt er frei; die Verhaftung eines Feindes, der als Kurgast ins Land gekommen ist, passt offenbar nicht ins Weltbild des Kaisers.
Den anderen Entscheidungsträgern bleiben vergleichbare Aufregungen erspart. Langsam finden sie sich Ende des Monats in ihren Büros ein. Es kümmert sie wenig, dass die Börsenkurse gerade zum Sturzflug ansetzen. Bloch lebt nicht mehr, seine Kollegen in den Banken erleben die von ihm vorhergesagte Wirtschaftskatastrophe am eigenen Leib; bald werden auch die Kleinsparer betroffen sein. Obwohl die Zeitungen aufgeregt von Krieg schreiben, sind die Militärs nicht sonderlich präsent. Die Politiker – und mehr noch die Öffentlichkeit – glauben ihren Versprechen der letzten Jahre, dass ein Krieg sich schnell gewinnen lasse. Die Entscheider sind in der Regel erbärmlich informiert. Die grundlegenden Nachrichten liefern Pressedepeschen und diplomatische Berichte, das heißt Quellen, die oft einen veralteten Stand der Dinge berichten. Die französische Delegation mit Präsident und Premierminister, von der gleich noch die Rede sein wird, kehrt mit dem Schiff von ihrem Besuch in Russland zurück. Die Reise dauert sechs Tage. Die Deutschen stören erfolgreich die Kommunikation, der Austausch von Depeschen läuft in den entscheidenden Tagen der Krise noch langsamer als sonst. Das Telefon spielt eine untergeordnete Rolle, es dient vor allem für Inlandsgespräche; Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es noch keine gesicherten Verbindungen, doch auch sie hätten wohl kaum etwas geändert.
In diesem Spiel glauben nur wenige Teilnehmer, dass sie etwas zu verlieren hätten. Großbritannien hat allenfalls seine Position zu wahren, deren Stützen ohnehin nicht in Europa liegen. London wird erst durch die Provokationen Deutschlands, das seit gut zwanzig Jahren seine Sonderstellung infrage stellt, zur Intervention gezwungen. Dass die Deutschen eine mächtige Kriegsmarine aufbauen, ist seit Langem ein Streitpunkt – nichts stört die Beziehungen zwischen den beiden Ländern so sehr wie das größenwahnsinnige wilhelminische Projekt, Großbritannien auf See Konkurrenz zu machen. Während des Kriegs schlägt die deutsche Flotte eine große Schlacht gegen die Briten, die sie halb gewinnt, doch auch so sollte sie es nicht aus ihren Häfen an Nord- und Ostsee herausschaffen. Die deutsche Revolution von 1918 beginnt in den Basen der Kriegsmarine.
Das Deutsche Reich ist de facto die einzige Großmacht, die den europäischen Status quo infrage stellt. Historiker haben auf Tausenden von Seiten versucht, zwei auf den ersten Blick gegensätzliche Sichtweisen in Übereinstimmung zu bringen. Einerseits entwickelt sich das Deutsche Reich seit Jahren weitaus dynamischer als Großbritannien. 1913 ist klar: Wenn der Frieden hält, wird sich seine Position als ökonomisch stärkster Staat festigen. Deutschland hat keine Aussicht auf territorialen Zuwachs, aber es braucht ihn auch nicht. Im Westen wäre er nur auf Kosten der Niederlande, Belgiens oder Frankreichs zu erreichen, was sich niemand vorstellen kann. Im Osten nur auf Kosten Russlands, was faktisch die Eingliederung von Millionen Polen ins Reich bedeuten würde. Das ist keine sonderlich verlockende Aussicht. Der liberale Abgeordnete Heinrich zu Schönaich-Carolath fragt 1914 im Reichstag: „Und was könnten wir von Rußland haben wollen? Etwa Warschau und Polen? Ich dächte, wir hätten genug davon.“11
Andererseits rasselt gerade das Deutsche Reich – und zwar unabhängig von der streitsüchtigen Persönlichkeit des Kaisers – am häufigsten und am lautesten mit dem Säbel. Damals und später findet man dafür unterschiedliche Erklärungen: Die „verspätete“ Nationsbildung der Deutschen (erst 1871); die Tradition des preußischen Militarismus; die Interessen des Großkapitals (eine absurde Annahme, denn Industrielle und Bankiers wissen auch ohne Kenntnis von Blochs Werk, dass ihnen der Friede mehr als der Krieg nutzt); den Wunsch, mit einem Schlag die vermeintlich wachsenden inneren Spannungen zu lösen; den Nationalismus. All dies spielt eine Rolle, erklärt aber nicht, warum Deutschland im Juli 1914 mehr als die anderen Großmächte eine konfrontative, aggressive Haltung einnimmt. Die Öffentlichkeit glaubt – mit Ausnahme der Sozialdemokraten, die sich der kriegsfreudigen Stimmung nur widerwillig anschließen –, Deutschland sei von einer feindlichen Koalition eingekreist. So scheinen sich etwa die deutschen Studenten noch bereitwilliger als ihre britischen Kommilitonen rekrutieren zu lassen, weil sie meinen, sie müssten als Hüter der einzig wahren europäischen Kultur das Vaterland gegen das Bündnis von barbarischem Osten und materialistischem Westen verteidigen.
Auch Briten, Franzosen und Russen fühlen sich moralisch überlegen: Die einen verteidigen Europa, die anderen ihre slawischen Brüder vor preußischem Militarismus und deutschem Hochmut. Ohne die freudige Erregung der Massen auf den Straßen, vor den Redaktionen und Kirchen, und ohne die Unterstützung der sozialistischen Parteien, die ihre Wähler aufrufen, in der ersten Reihe der Vaterlandsverteidiger mitzuschreiten, ist der schändliche Juli des Jahres 1914 kaum vorstellbar. Zugleich wissen wir, dass Millionen Bauern – in Mittel- und Südosteuropa stellen sie die große Bevölkerungsmehrheit – sich zwar gehorsam rekrutieren und an die Front schicken lassen, doch wenig Begeisterung zeigen. In Russland kommt es bei der Mobilisierung hier und da zu Unruhen, oft in Zusammenhang mit massenhaftem Alkoholkonsum. Maßloses Trinken gehörte zum Ritual der Einberufung, doch nun geht es für die jungen Männer nicht in die Kaserne, sondern an die Front. Das alles scheint vorerst unbedeutsam, ähnlich wie die Tatsache, dass nur in zwei Ländern die Parteien der Sozialistischen Internationale den von den europäischen Sozialisten propagierten Prinzipien treu bleiben und offen gegen den Krieg agitieren – die Bolschewiki und Menschewiki in Russland sowie ihre Genossen in Serbien.
Das kollektive Gedächtnis der westeuropäischen Gesellschaften bewahrt die Erinnerung an die fiebrigen, kriegshungrigen Menschenmengen in den Städten. Es kommt zu einer Rückkopplung: Die Massen lassen sich leicht aufbringen und die Politiker wie Journalisten, deren Kriegsrhetorik die Stimmung anheizt, sehen darin einen weiteren Beweis, dass sie im Einklang mit den Interessen und dem Willen des Volkes handeln. Der Schulterschluss der Nation angesichts der Gefahr, das Gefühl der moralischen Überlegenheit über den Feind und der Glaube an einen schnellen Sieg – der Sommer 1914 wirkt schön und erhaben.
Entschieden wird freilich in den Kabinetten, nicht auf der Straße. Und man liest diese Geschichte bis heute mit Verwunderung – selten ließen die europäischen Eliten einen solchen Mangel an Verstand erkennen. Am 28. Juni erschießt ein junger österreichisch-ungarischer Bürger serbischer Nationalität eher zufällig den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und dessen Gemahlin.
Franz Ferdinand von Österreich-Este
Der Neffe Franz Josephs I. war der seit Langem umstrittenste Thronfolger in Wien. Er war bekannt für sein Talent, Menschen zu kränken, für seine Apodiktik und seine Arroganz. Zum Thronfolger wurde er 1896 nach dem Tod seines Vaters, dem jüngeren Bruder des Kaisers. Er verfügte über eine solide militärische Ausbildung und über Erfahrung als Offizier. Er sah das Potenzial der modernen Militärtechnik und unterstützte die ähnlich denkenden Generalstäbler. Auf zahlreichen exotischen Reisen sammelte er unzählige Jagdtrophäen. Am tschechischen Sitz der Familie in Konopište ist bis heute eine kleine Auswahl der Überreste seiner schätzungsweise mehr als 250.000 Opfer zu sehen. Gegen den Willen des Hofes heiratete er die schöne Sophie Herzogin von Hohenberg, die als Person niederen Standes (alles ist relativ …) nicht zu offiziellen Feierlichkeiten eingeladen wurde; ihre Kinder wurden von der Thronfolge ausgeschlossen. Der Hof und große Teile des Establishments waren ihm verhasst.
Bis zu einem gewissen Grad aber trog der Schein. Franz Ferdinand war mehr als ein arroganter Großherzog, wie es sie in allen Herrscherfamilien zuhauf gab. Er sah den Zustand des Staates kritisch und hielt radikale Reformen für nötig. „Juden, Freimaurer, Sozialisten und Ungarn“12 waren für ihn Feinde der Monarchie. Die Ungarn, die ihre – theoretisch schwächere – Position in der Doppelmonarchie, in der keine Seite ohne die andere existieren konnte, rücksichtslos und effizient ausnutzten, betrachtete er als Schandfleck des Habsburgerreiches. Zudem hatte er eine originelle Idee zur Lösung der südslawischen Frage. Hierbei ging es um das seit 1903 verfeindete Serbien, das 1908 annektierte Bosnien-Herzegowina, die in Cisleithanien lebenden Slowenen sowie das zu Ungarn gehörende Königreich Kroatien. Serbien propagierte die Vereinigung der Brudervölker unter seiner Führung. Franz Ferdinand plädierte für die Schaffung eines südslawischen Königreichs als drittem Glied der Habsburgermonarchie. Die Ungarn wollten davon nichts wissen, ebenso wenig die Deutsch-Österreicher und auch Polen und Tschechen lehnten den Vorschlag ab, denn ihnen schwebte ein Modell vor, in dem sie die Rolle des dritten Gliedes einnehmen wollten. Der Thronfolger spann seine Pläne im schönen Wiener Belvedere ohne Rücksicht auf das zornige Murren fast der gesamten politischen Klasse Österreich-Ungarns. In Europa galt Franz Ferdinand als Anführer der Wiener „Falken“, zu Unrecht, denn er war gegen einen Präventivkrieg. Obwohl er insgesamt den zackigen Stabschef Conrad von Hötzendorf stützte – die zwei verband unter anderem der Glaube an die Armee als Stütze der Monarchie –, stritt er sich unentwegt mit ihm: Der Thronfolger hielt einen militärischen Konflikt für zu riskant.
Gegen alle Warnungen reiste er nach Sarajevo. Wir werden nie erfahren, ob am 28. Juni 1914 ein politischer Visionär starb oder ein Hochstapler.
Europa ist empört. Man weiß, dass es ohne den jahrelangen Konflikt zwischen Österreich und Serbien nicht zu diesem Attentat gekommen wäre. Deshalb ist man überzeugt, dass die Fäden des Komplotts in Belgrad zusammenlaufen. Zwar gibt es keine Beweise, doch mit der bereitwillig dargebrachten Sympathie, Solidarität und Anteilnahme Europas erhält Wien einen erstklassigen Vorwand, um endlich gegen die „Schweinehirten“ jenseits der Südgrenze vorzugehen.
Die österreichischen Militärs drängen auf Krieg. Problemlos erhalten sie uneingeschränkte Rückendeckung aus Berlin, wo Conrads Pendant von Moltke seit Langem auf seine Gelegenheit wartet. Niemand stört es, dass Deutschland und Österreich-Ungarn gegensätzliche Kriegspläne verfolgen. Berlin will sieben Achtel seines Heeres gegen Frankreich einsetzen, was eine Verletzung der Neutralität Luxemburgs und Belgiens einschließt. Erst nach der Überwindung des westlichen Nachbarn will es das Gros seiner Landstreitkräfte an die russische Front verlegen. Ein Krieg gegen Russland mit in den ersten Wochen geringer Unterstützung durch Deutschland ist keine verlockende Aussicht, doch Conrad mag das Risiko und verachtet die Russen (von den Serben ganz zu schweigen). In den Berliner Gesprächen eine Woche nach dem Attentat von Sarajevo sichert Deutschland Österreich-Ungarn für den Fall eines Angriffs auf Serbien volle Unterstützung zu.
In Wien dauert der komplizierte Entscheidungsprozess an. Der ungarische Premier Graf István Tisza fürchtet einen Angriff auf Serbien. Er argumentiert in Bezug auf die Serben ähnlich wie Prinz Schönaich-Carolath in Bezug auf Polen: Wozu braucht die Monarchie noch mehr Slawen? Nach einwöchiger Diskussion lässt er sich überzeugen. Die Geschichte ist bisweilen grausam: Der einzige mitteleuropäische Politiker, der sich für einige Tage erfolgreich gegen die Katastrophe stemmte, wird im Oktober 1918 von Attentätern als Kriegsverantwortlicher erschossen.
Nach Tiszas Kapitulation wartet Wien. Der französische Präsident und Premierminister halten sich zu einem Besuch in Russland auf und man will nicht handeln, solange die potenziellen Gegner sich unmittelbar, ohne Vermittlung von Telegrafen und Diplomaten, beraten können. Am 23. Juli reisen die Franzosen aus St. Petersburg ab. Am selben Tag stellt Wien Belgrad ein Ultimatum. Es ist bewusst so abgefasst, dass ein souveräner Staat es unmöglich akzeptieren kann. Es enthält unter anderem die Forderung nach der Beteiligung von k. u. k. Beamten an den Ermittlungen der serbischen Behörden zum Mord in Sarajevo sowie an der Bekämpfung von Bewegungen gegen die territoriale Einheit Österreich-Ungarns; in beiden Fällen geht es um offizielle Aktivitäten fremder Behörden auf serbischem Hoheitsgebiet, die sich gegen serbische Staatsbürger richten. Die Antwort erwartet Wien binnen 48 Stunden.
Am 25. Juli verpflichtet sich Belgrad zur Erfüllung fast aller Forderungen Wiens – mit Ausnahme der zwei genannten, die allzu offensichtlich dem Souveränitätsprinzip widersprechen. Mit seiner geschickten Antwort, die unter anderem die Einstellung der antihabsburgischen Propaganda und die Bestrafung der für das Attentat Verantwortlichen verspricht, verblüfft Serbien sogar Wilhelm II.: Belgrad habe sich öffentlich demütigen lassen, sodass es keinen Anlass gebe, einen Krieg zu beginnen, schreibt der Kaiser enttäuscht. Trotzdem nutzt Wien die Gelegenheit – zwei Bedingungen des Ultimatums wurden schließlich nicht erfüllt – und erklärt Serbien am 28. Juli den Krieg.
Im Lauf dieses Monats wurden Berlin und Wien oft gewarnt, Russland werde sich keinen erneuten Gesichtsverlust erlauben und Serbien zur Seite springen, der Automatismus des russisch-französischen Bündnisses werde greifen, auf Italien werde man sich nicht verlassen können, wohingegen Großbritannien wohl eher nicht tatenlos zusehen werde. Alles vergebens. Am 30. ruft Russland die Mobilmachung aus, einen Tag später Österreich-Ungarn und Belgien. Am 1. August folgen Deutschland und Frankreich. Deutschland erklärt Russland den Krieg. Tags darauf besetzt Deutschland Luxemburg und stellt Belgien ein Ultimatum. Am 3. August erklärt Deutschland Frankreich den Krieg und erhält ein Ultimatum Großbritanniens. Tags darauf greift Deutschland Belgien an und Großbritannien tritt in den Krieg ein. Am 6. August erklärt Österreich-Ungarn Russland den Krieg. Einen Tag später landen die ersten Einheiten des britischen Expeditionskorps in Frankreich, am 12. August greift die österreichisch-ungarische Armee Serbien an, drei Tage später marschieren die Russen in Ostpreußen ein. Montenegro hat sich schon früher Serbien angeschlossen; das Osmanische Reich tritt im Oktober als Verbündeter der Mittelmächte in den Krieg ein. Auf dem Balkan bleiben Bulgarien, Rumänien und Griechenland vorerst neutral.
* * *
Die Mitte und der Osten des Alten Kontinents wurden von verblendeten Großmächten in den Krieg gezogen. Am wenigsten gilt dies für Deutschland und die Deutschen. In Mittel- und Osteuropa war nur das Deutsche Reich Großmacht und moderner Nationalstaat, seine Politiker und Militärs dachten imperial und national. Dennoch waren sie ebenso verblendet wie alle anderen, indem sie sich und ihren Landsleuten einredeten, Deutschland sei von Feinden umgeben und nur ein großer Präventivschlag im Westen und Osten könne den sich zusammenziehenden Kordon der Nachbarn zerschlagen, bevor es zu spät sei. Österreich-Ungarn wollte eigentlich nur Serbien bestrafen, mit zunehmendem Kriegsfieber dann unschädlich machen. Russland zog einzig und allein in den Krieg, um seinen angekratzten Großmachtstatus zu retten. Keine der Großmächte verfolgte eines der traditionellen Kriegsziele – regionale Hegemonie, die Annexion strittiger Provinzen oder die Platzierung eines Verbündeten auf einem fremden Thron. Christopher Clark nennt die imperialen Entscheidungsträger treffend „Schlafwandler“.13
Einige Wochen nachdem der im Juli ausgelöste Dominoeffekt die europäische Ordnung schon unwiderruflich zerstört hatte, bezeichnete der russische Premierminister Sergei Witte den Krieg als schieren Wahnsinn: „Was können wir von ihm erwarten? Territorialen Zuwachs? Das Land seiner Hoheit des Zaren ist doch ohnehin schon groß genug …“14
Hätte auch nur einer der verantwortlichen Politiker im Sommer 1914 geahnt, in was er sein Land hineinführt – er hätte sicher nicht sein Scherflein zum Untergang des Europas des 19. Jahrhunderts und zur Welt der Imperien beigetragen.