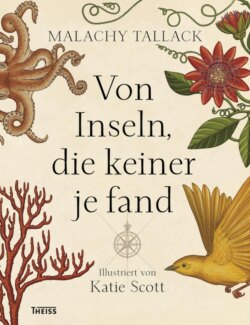Читать книгу Von Inseln, die keiner je fand - Malachy Tallack - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеGut kann ich mich an das Motto am Eingang der Anderson High School in Lerwick auf den Shetlandinseln erinnern: „Dö weel and persevere“, ein Rat, den einst der Schulgründer, der von der Insel stammende Reedereigründer und Philanthrop Arthur Anderson, als junger Mann erhalten hatte. Genau genommen war dieses „Tue Gutes und sei beharrlich“ ja kein ganz so spektakulärer Ratschlag, aber Andersons Aufstieg aus ärmlichen Verhältnissen zu einer Position, die ihm seine philanthropische Tätigkeit erlaubte, war Teil der Insel- und Schulgeschichte und sollte junge Shetländer inspirieren und ihnen vor Augen halten, dass auch sie alles erreichen konnten.
Das Motto war begleitet von drei Wikinger-Wahrzeichen – einer Axt, einem Langschiff und einer brennenden Fackel – und einer anderen, weniger eindeutigen Inschrift. Auf einem gelben Spruchband, das über die Mitte des Wappens verlief, standen drei Worte in Latein, die auf einen ganz anderen Teil unserer Geschichte verwiesen. „Dispecta est Thule“: Thule ward gesehen.
Obwohl ich jene Pforte in meinen Schuljahren unzählige Male passierte, erklärte uns kein Lehrer je die lateinischen Worte darauf, und ich machte mir nie die Mühe, nachzufragen. Ich hatte eine vage Vorstellung davon, dass man Thule für den Rand der Welt hielt, und glaubte, Shetland sei irgendwie damit identisch oder dies zumindest irgendwann einmal gewesen. Aber in meinem jugendlichen Gemüt verband sich dieses Wort am engsten mit der Thule-Bar unten am Hafen, für einen Teenager ein Ort, der weitaus geheimnisvoller und lockender war.
Erst viele Jahre später, als die Schulzeit längst hinter mir lag, erfuhr ich etwas über den Ursprung dieses Mottos. Thule war tatsächlich der Rand der Welt, aber es war mehr als das. Es war eine Insel, die einst für real gehalten worden war, aber nun auf den Karten fehlte. Es war ein Ort, der kein Ort mehr war. Die Worte selbst stammten von dem römischen Historiker Tacitus, dessen Schwiegervater Agricola gegen Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. Statthalter von Britannien war. Nördlich des schottischen Festlands segelnd, hatte Agricola Shetland am Horizont erblickt und es für Thule gehalten, den nördlichsten Punkt der antiken Welt. Er verpasste den Inseln dieses Label, aber es blieb nicht lange hängen. Thule ward gesehen und dann verschwand es wieder.
Bei genauerer Betrachtung erscheint es seltsam, dass so ein Satz als geeignete Ausschmückung für jene Tore gegolten haben soll, kollidierte seine Botschaft doch so unübersehbar mit derjenigen, welche er begleitete. Folgte man dem Motto der Schule, so war Shetland ein Ort, der so bedeutsam war, wie wir, seine Söhne und Töchter, ihn zu gestalten vermochten. Arthur Anderson war ein wichtiger Mann – seine Schiffe hatten die Weltmeere befahren –, und wie er konnten wir überall hingehen und alles tun. Aber in jenen drei Worten von Tacitus verlor Shetland seine Identität völlig. Ja, als Anhängsel der Idee von Thule existierten wir kaum. Ein eigenartiger Widerspruch, aber irgendetwas an dieser irrealen Geografie übte eine gewisse Anziehungskraft auf mich aus.
Später stellte ich fest, dass die Meere voll sind von solchen Orten: Inseln, die „entdeckt“ wurden und bei denen sich später herausstellte, dass da gar nichts zu entdecken war. Es gab sie in allen Teilen der Welt und manche erschienen viele Jahrhunderte auf Karten, ehe sie schließlich von diesen getilgt wurden. Diese Inseln sind nicht durch Überflutungen oder Erdbeben verloren gegangen, sie sind keine Opfer von Naturkatastrophen. Diese Inseln sind menschlichen Ursprungs, Produkte der Fantasie und von Fehlern.
In diesem Buch ist eine ganze Schar von solchen Inseln versammelt, unterteilt in sechs Kapitel. Bei den ersten handelt es sich um Inseln des Lebens und des Todes: mythische Orte, die ausschließlich innerhalb von Erzählungen vorkommen. Das Kapitel Im Aufbruch stellt Inseln vor, die von frühen Reisenden im Atlantik und Pazifik gefunden wurden, zu einer Zeit, als wenige Menschen die Welt jenseits ihrer eigenen Ufer kannten. Die dritte Gruppe von Inseln tauchte während der Zeit der Entdeckungen auf, als europäische Seeleute den Globus allmählich mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu durchqueren begannen. Die vierte sind Versunkene Länder, von denen man annahm, sie seien einst untergegangen, während das fünfte Kapitel Trügerischen Inseln gewidmet ist, erfunden von Scherzbolden und Schwindlern. Bei der sechsten und letzten Gruppe handelt es sich um Widerrufene Entdeckungen, die in das 20. und 21. Jh. fallen.
Jeder dieser Orte hat seine je eigene Geschichte und keiner gleicht so ganz dem anderen. Manche waren an der Ausbildung ganzer Kulturen beteiligt, während man von anderen kaum Notiz nahm. Manche sind seltsam und märchenhaft, während andere völlig glaubwürdig sind. Alle spiegeln sie auf die ein oder andere Art und Weise die Werte ihrer Zeit wider und alle haben sie die Geografie des Geistes bereichert. Dieses Buch möchte jene „weg-entdeckten“ Inseln feiern und durch sie die Geschichte erzählen, wie wir unser Bild von der Welt geformt haben.