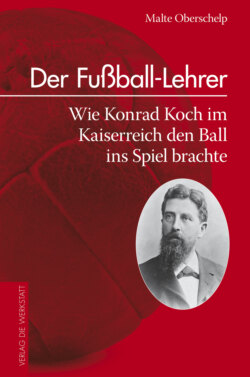Читать книгу Der Fußball-Lehrer - Malte Oberschelp - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas englische Experiment
„Der Mißerfolg beim Versuche, Schulspiele einzuführen,
wird an nicht wenigen Stellen dadurch veranlaßt sein,
daß man der Jugend statt wirklicher Spiele nur Spielereien geboten hat.“
Die Braunschweiger Schulspiele (Zeitschrift für Schulgesundheitspflege 1890, Seite 379)
Am Anfang war der Ball. Am 29. September 1874 warf August Hermann, der Turnlehrer am Braunschweiger Gymnasium Martino-Katharineum, auf dem kleinen Exerzierplatz vor den Toren der Stadt einen Fußball unter einige Schüler. Neben ihm stand Konrad Koch, der Lehrer für Deutsch, Geschichte und alte Sprachen. Beide schauten zu, was passieren würde.
Es war dies nicht das erste Mal, dass in Deutschland Fußball gespielt wurde. Englische Schüler, Kaufleute oder Pensionäre, die vorübergehend oder ständig in Deutschland lebten, haben mit Sicherheit auch vor 1874 das Fußballspiel betrieben, ohne dass es dafür viele Belege gibt. Der Gründungspräsident des DFB, Ferdinand Hueppe, hat beispielsweise berichtet, er habe schon 1865 mit englischen Jungen herumgekickt. Unstrittig ist auch, dass es im Deutschen Flaggen-Club Heidelberg, einem Ruderverein, seit 1872 eine Fußballabteilung gab. Der Gründer war Edward Ullrich, ein Lehrer am Neuenheim College.
Aber das, was 1874 in Braunschweig auf dem Exerzierplatz begann, entwickelte sich zum ersten systematischen Versuch, den Fußball in Deutschland heimisch zu machen: durch die Übersetzung der Regeln, die Eindeutschung der Fachbegriffe, die Gründung eines Schülervereins und die theoretische Auseinandersetzung mit dem pädagogischen Potenzial des Spiels. Konrad Koch mag deshalb nicht der Gründervater des deutschen Fußballs sein, wie es so häufig heißt. Aber anders als seine vereinzelten Vorläufer steht er für den organisierten Beginn des Fußballs in Deutschland. Deshalb war Koch auch der Erste, der mit seinem fußballerischen Feldversuch eine größere Resonanz erzielte. Erst in der Schule, dann in der Stadt und später darüber hinaus. Auch wenn es sich zunächst genau wie bei den in Deutschland lebenden Engländern um Rugby handelte. Der Hilfslehrer Franz Hahne, der viele Jahre später einen Nachruf auf Konrad Koch schreiben sollte, erinnert sich beim ersten Braunschweiger Spielgerät an einen „eiförmigen großen Lederballe“.1 So viel steht fest.
Wer die Idee zu dieser Versuchsanordnung hatte, ist weniger klar. Koch hat stets betont, der Mediziner Friedrich Reck habe die Anregung gegeben. Das klingt plausibel, weil Reck als Militärarzt in England gewesen war. Andererseits war Koch dessen Schwiegersohn und möglicherweise parteiisch. Denn auch Hermann reklamierte die Idee mit dem Ball für sich, zumal er ihn das bestätigen alle Beteiligten aus London hatte kommen lassen. Seine Schwester betrieb ein Internat für deutsche und englische Schülerinnen und war häufig auf der Insel. Hermann hatte eine Pension im Hause, die auch englische Jungen beherbergte. „Wir haben dann mit jenem Balle probiert und geübt, wobei uns einer meiner Pensionäre, ein Engländer, helfend zur Seite stand“, hat Hermann über den Tag im Herbst 1874 berichtet.2 Ganz ohne englische Hilfe ging es also nicht. Die Schüler jedenfalls waren begeistert. Bereits drei Jahre später nannte das Schulprogramm Fußball „das Lieblingsspiel unserer Jugend“.3
Auch international gesehen war Koch mit seinem Schulfußball Pionier. Außer in der Schweiz entwickelte sich der Fußball überall auf dem europäischen Kontinent später. In der Westschweiz, wo Walther Bensemann das Spiel als Schüler kennenlernte, gab es bereits 1860 den Lausanne Football and Cricket Club. 1869 nahm die erste Schule in Genf Fußball in ihr Programm auf. In England war die Entwicklung natürlich schon fortgeschritten. Nachdem die Football Association sich 1863 von der Rugby-Bewegung abgespalten hatte, erfand sie 1871 den ersten Mannschaftswettbewerb der Welt: den FA-Cup. 1874, im Jahr der Braunschweiger Fußballpremiere, gewann Oxford University den Pokal im Endspiel vor 2.000 Zuschauern gegen die Royal Engineers. Von solchen Verhältnissen war Deutschland noch weit entfernt.
Vor dem englischen Experiment hatten es die Lehrer in Braunschweig über zwei Jahre mit den gängigen deutschen Spielen probiert. Bereits im Mai 1872 hatte der Oberlehrer Corvinus versucht, die Schüler des Braunschweiger Elite-Gymnasiums in Bewegung zu bringen. Er und Koch waren schon als Schüler aufs Martino-Kathari-neum gegangen und hatten sowohl im Zuge des Schulturnens als auch aus freien Stücken häufig Ball gespielt. Doch jetzt stellten sie erschrocken fest, „daß alle die einst so beliebten Spiele, wie Barlaufen, Kaiserball, Ballschlagen und so weiter, der Schuljugend vollständig unbekannt geworden waren“.4 Das einzige Spiel, das die Schüler kannten, war Räuber und Soldaten was die Lehrer moralisch bedenklich fanden, aber mangels Alternativen fast ausschließlich spielen ließen.
Weitere Untersuchungen der Schule ergaben, dass die Mehrheit der Schüler kaum einmal aus der Stadt herauskam und einen Großteil der Freizeit in geschlossenen Räumen verbrachte. Braunschweig erlebte in diesen Jahren wie viele deutsche Städte eine Bevölkerungsexplosion. 1850 hatte die Einwohnerzahl 38.000 betragen, knapp 40 Jahre später erreichte sie 100.000. Die industrielle Revolution machte aus der beschaulichen Residenzstadt eine Großstadt. Kochs Bemühungen waren deshalb auch eine Reaktion auf Landflucht und Industrialisierung und in den interaktiven englischen Mannschaftsspielen, die er propagierte, mag man jene komplexer gewordenen industriellen Prozesse zugleich auf dem Spielfeld gespiegelt sehen.
Ein zweiter Grund war die Entwicklung des Turnens. Turnvater Jahn hatte die Übungen 1812 unter freiem Himmel etabliert im paramilitärischen Stil und als Teil der Befreiungskriege gegen die französische Besatzungsmacht. Doch während der sogenannten Turnsperre von 1820 bis 1842, als das Turnen auf frei einsehbaren Plätzen in Preußen verboten war, verlagerte sich die Bewegung in Turnhallen und an die Schulen. Denn nur in geschlossenen Räumen und als Schulfach blieb das Turnen legal. Die Hallen allerdings waren häufig schlecht belüftet und beleuchtet, weshalb Koch und seine Mitstreiter mit den Spielen in freier Natur einen Ausgleich schaffen wollten.
„Hatte nicht der aufmerksame Beobachter bei seinen Spaziergängen durch Feld und Wald schon seit längerer Zeit die früher so laut und hörbar draußen lärmende männliche Jugend fast gänzlich vermißt?“, fragte Koch. „Wußte nicht dagegen auch ein jedes Kind auf der Straße ganz genau, wo regelmäßig an bestimmten Stellen in der Stadt zu bestimmten Stunden die bunten Gymnasiastenmützen stets in größerer Menge zusammen zu sehen waren?“5 Das war eine Anspielung auf die regelmäßigen Kneipentouren der Oberschüler. Mit den traditionellen deutschen Spielen gelang es Koch nicht, die Schüler vom Wirtshausbesuch abzuhalten, selbst wenn bei der Teilnahme der Erlass von Hausaufgaben lockte. Das schaffte erst der Fußball.
Schon bald kamen die Schüler gerne auf den Exerzierplatz. Schnell wurde neben dem Mittwoch- auch der Sonnabendnachmittag zum Spielen freigegeben. Die Zahl der teilnehmenden Schüler stieg 1874 auf 40 und 1875 auf 60 an. Da Fußball bei Koch nur im Winter gespielt wurde, war die Zahl der Spielnachmittage 1874/75 waren es 20 stark witterungsabhängig. Die Teilnahme war freiwillig, aber immerhin bildete sich unter den Sekundanern und Tertianern ein harter Kern. Koch vermerkte stolz, aber sicherlich etwas übertrieben: „Um so mehr blühte unter den regelmäßig Spielenden die edle Kunst des Fußballs und wurde zu einer solchen Vollkommenheit entwickelt, daß sie nach dem Urteile Kundiger durchaus nicht hinter der von englischen Knaben und Jünglingen im gleichen Alter zurückblieb.“6
Koch, der zur Zeit der Fußballpremiere zum Oberlehrer befördert wurde, war regelmäßig mit am Ball bis ins 40. Lebensjahr. Auch das eine Neuerung, die mit den englischen Spielen Einzug hielt: Die Lehrer waren ausdrücklich dazu angehalten, mit den Schülern zusammen zu spielen. Die Aufsichtsperson wurde zum Mannschaftskameraden gegenüber den autoritärem Turnstunden bedeutete das einen enormen Modernisierungsschub. Koch befürwortete auch, dass die Schüler etwaige Streitigkeiten auf dem Platz selber schlichteten. Die Teams, eingeteilt nach Klassen, blieben dazu das ganze Sommer-oder Winterhalbjahr die gleichen. Jede Mannschaft wählte zu Beginn des Halbjahres einen Spielkaiser, Kochs altertümliche Bezeichnung für den Captain, der dann für den korrekten Ablauf der Spiele zuständig war.
Ein Jahr nach der Einführung des Fußballs versuchten es die Pädagogen mit einem zweiten Import aus England. „Nun bestand aber gerade gegen Cricket unter den leitenden Lehrer ein sehr starkes Vorurtheil“, erinnerte sich Koch. „So wurde denn von ihnen absichtlich die Wahl dieses Spieles vermieden zu Gunsten des amerikanischen Eckballs (Base-ball).“7 Doch die Zahl der teilnehmenden Schüler blieb gering, Baseball setzte sich nicht durch.
Cricket fand dagegen seinen Weg nach Braunschweig, und zwar genauso wie in vielen anderen deutschen Städten der Fußball: mit englischer Hilfe. Koch beschreibt die erste Cricket-Partie so: „Aber siehe da, ein junger Engländer, der damals unser Gymnasium besuchte, brachte ohne vorherige Erlaubnis eines Tages eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Beginn der Schulspiele seine eigenen Spielgeräte auf den Platz, und als der die Aufsicht führende Lehrer erschien, fand er zu seiner nicht geringen Überraschung das Spiel schon im besten Gange.“8 Den skeptischen Kollegen blieb nichts anderes übrig, als das zunächst verpönte Treiben in den Spielekanon aufzunehmen: „Aber wenn die Lehrer auch gewollt hätten, sie hätten nun nicht mehr das Cricket vom Spielplatze fernhalten können; so sehr hatte es sich, ähnlich wie Fußball, im Fluge die Herzen der Jugend gewonnen.“9
„Nur von den besten Bestandtheilen“: Werbung für Cricket-Ausrüstungen, „Spiel und Sport“, 1893.
Die Beliebtheit des Cricket schlug sich in der Zahl der spielenden Schüler nieder: Sie stieg bis 1878 auf 109 an. Im gleichen Jahr geschah, was Koch die „Verstaatlichung“10 der Spiele nannte. Das Herzogtum Braunschweig, im Deutschen Reich eine Art Bundesland mit eigenen Verwaltungsstrukturen, integrierte zwei Spielnachmittage offiziell in den Gymnasiallehrplan. In Folge dessen wurde die Beaufsichtigung der Schüler zur Arbeitszeit der Lehrer erklärt. Dazu bewilligte die Schulbehörde einen jährlichen Etat von 200 Reichsmark zur Beschaffung von Spielgeräten. Die Summe hätte für einige Fußbälle gereicht: Anfang der 1880er Jahre kostete ein Ball über zehn Mark, bevor der Preis mit zunehmender Beliebtheit des Spiels sank. Um 1890 wurden englische Import-Leder mit 6,50 Mark pro Stück beworben.
1879 wurde Mitspielen für alle zehn Klassen des Gymnasiums Pflicht. Das betraf allerdings nicht das Fußballspiel im Winterhalbjahr. Hier blieb die Teilnahme freiwillig. Trotzdem jagten 1881/82 nach zwei harten Wintern 110 Schüler dem Ball nach. Wieder lobte Koch stolz: „Das feine Spiel, das die jetzigen Spieler ausgebildet haben, übertrifft noch alle früheren Leistungen; die Sicherheit und Kraft, womit der Ball von den besten Spielern im Platzstoß oder Fallstoß getreten wird, ist eine außerordentlich große.“11 Ein Platzstoß war in Kochs Terminologie aus dem Regelheft von 1875 eine Art Freistoß, ein Fallstoß ein Dropkick. Zu kritisieren hatte der Trainer nur eines: „Am schwächsten sind verhältnismäßig noch die Stürmer, denen es meistens bisher an ausreichender Übung im Dauerlauf gefehlt hat.“12 Heute nennt man das wohl mangelnde Defensivarbeit.
Um den Schülern einen zusätzlichen Anreiz zu geben, entschlossen sich die Braunschweiger Lehrer zur Einführung eines Sommerturniers samt sogenannter Wettspiele. Darunter verstand man damals eine Art Freundschaftsspiel, zum Beispiel zwischen zwei Schulklassen. Ihr Nutzen oder Nachteil war eine vieldiskutierte Streitfrage, weil sie das Konkurrenzprinzip sowie mess- und nachvollziehbare Ergebnisse einführten. Die bisher vorherrschende Leibesübung, das Turnen, kannte beides nicht. Eine Turnriege turnte miteinander, nicht gegeneinander. Wettkämpfe wurden im Turnalltag weitgehend vermieden. Und wenn sie bei Turnfesten ausnahmsweise zugelassen waren, erschloss sich die Bewertung der Teilnehmer nur dem Kenner. Doch in einem Fußballwettspiel konkurrierten zwei Mannschaften um den Sieg, der durch die Zahl der Tore für jedermann nachvollziehbar war. Diese beiden Faktoren trugen entscheidend zur Beliebtheit der englischen Spiele bei der deutschen Schuljugend bei.
Jedes Jahr traten die Schüler des Martino-Katharineums fortan zu Wettkämpfen an, die sich mit lokalen Bundesjugendspielen vergleichen lassen. Die oberen Klassen absolvierten einen griechischen Fünfkampf, die unteren maßen sich im Laufen, Ballwerfen und Ringen. Die besten Spieler der mittleren Klassen traten zu einem Cricket-Wettkampf an. „Wie belebend derartige Schaustellungen auf den regelmäßigen Betrieb der Spiele einwirken, begreift sich leicht“, befand Koch.13 Er setzte sich in vielen Schriften für Wettspiele ein. Für die Fußballer seines Gymnasiums ließ Koch sich 1875 eine besonders symbolträchtige Veranstaltung einfallen: eine Partie, die jedes Jahr am 22. März zum Geburtstag Kaiser Wilhelm I. stattfand.
Das war nur der Anfang. „Weit reger ist die allgemeine Teilnahme, weit lebendiger der Eifer, nicht bloß der Mitspielenden, sondern auch der Zuschauer bei den Wettspielen, wenn dieselben aus dem engern Kreise der einzelnen Schule hinaustreten, wenn sich Schüler verschiedener Schulen im Wettkampfe messen“, erklärte Koch 1886 vor dem Nordwestdeutschen Turnlehrer-Verein.14 Denn die Entwicklung am Martino-Katharineum war in Braunschweig nicht unbeobachtet geblieben. Dass am Vorzeige-Gymnasium im Sommer Cricket und im Winter Fußball gespielt wurde, sorgte für Aufsehen.
Anfang der 1880er Jahre folgten die Oberrealschule und die Günther’sche Privatschule dem Beispiel und führten den Fußball ein. Später kam das Neue Gymnasium hinzu, das zur Entlastung von Kochs Anstalt gegründet worden war. Zwischen allen Schulen entwickelte sich ein reger Spielverkehr. „Da sind es nicht künstlich gebildete oder zufällig sich zusammenfindende Parteien, die einander entgegentreten, sondern ein inneres Band hält sie zusammen und ein Gefühl erfüllt sie“, schrieb Koch, „es gilt ihnen nicht so sehr sich persönlich hervorzuthun, als für die Ehre ihrer Schule das Beste zu leisten.“15 Koch wusste sehr gut, dass solche Wettspiele die perfekte Werbung für die englischen Spiele waren.
Das wirkte sich auch außerhalb der Schulen aus: Sobald der Fußball einmal Fuß gefasst hatte, zog er immer mehr Menschen an. „Auch die sonstige Jugend der Stadt tritt oft den Ball und stellt sich, wo sie Platz findet, ihre Thore zum Cricket auf “, schrieb Koch 1882.16 Gemeinsam mit August Hermann hatte er die englischen Spiele in seiner Heimatstadt etabliert. Beide Pädagogen arbeiteten bereits daran, sie überregional zu verbreiten.
Sie begannen damit auf der achten Deutschen Turnlehrerversammlung 1876 in Braunschweig. Hermann stellte dort folgende These vor: „Unser deutsches Turnen, so wie es sich bis jetzt gestaltet hat, genügt nicht, um die Leibesübungen zur Volkssitte zu erheben.“ Einfacher ausgedrückt: Turnen ist kein Volkssport geworden. Um dieses Ziel zu erreichen, hieß es im Antrag weiter, sei eine Kursänderung nötig. Nämlich die, „das Spiel als nothwendige Ergänzung des Turnens mehr auszubilden und mit der Jugend zu pflegen“.17 Dabei verwies Hermann etwa auf die seit Jahren sinkenden Mitgliedszahlen der Turnvereine. Dem entgegen stellte er die guten Erfahrungen, die er und Koch mit der Einführung der „echt importirten“ englischen Spiele Football und Cricket in Braunschweig gemacht hatten.18
Hermanns und Kochs Öffentlichkeitsarbeit für die englischen Spiele ist vor dem Hintergrund einer Entwicklung zu sehen, die die Historikerin Christiane Eisenberg als „Krise des Turnbetriebs am Ende des 19. Jahrhunderts“ bezeichnet hat.19 Der Verzicht auf Wettkämpfe und die Eintönigkeit der Turnübungen führten häufig zu Beschwerden und Vereinsaustritten. Noch dazu hatte es das Turnen nicht geschafft, die Mittelschicht für sich zu gewinnen. Stattdessen entdeckten die Angestellten und Kaufleute den Sport für sich. Koch und Hermann dagegen wollten den Turnbetrieb durch Fußball und Cricket modernisieren. Zumal Ballspiele zu Jahns Zeit ein wichtiger Bestandteil auf dem Turnplatz gewesen waren, sich seit dem Hallenturnen aber weitgehend aus dem Kanon der Übungen verabschiedet hatten.
Gleichwohl gab es auf der Versammlung Kritik an Hermanns These. Der Direktor der Turnlehrerbildungsanstalt in Karlsruhe, Alfred Maul, sah darin „einen unverdienten Tadel“ des Turnens.20 Dazu wurden die Argumentationslinien sichtbar, die in den folgenden Jahren die Einführung des Fußballs begleiteten. Moritz Kloss, der Hermann als Turnlehrer ausgebildet hatte und die „Neuen Jahrbücher für die Turnkunst“ herausgab, befürwortete mehr Spiele aber es sollten deutsche Spiele sein. Auch Carl Euler, der Herausgeber von Jahns Werken, verwandte sich gegen das „Importiren“ von Spielen anderer Völker.
Ihnen widersprach Friedrich Reck, der Initiator der Braunschweiger Fußballversuche. Er plädierte unter Verweis auf seine England-Aufenthalte dafür, „das Gute dort zu nehmen, wo wir es finden“ eine Formulierung, die sein Schwiegersohn Koch später oft benutzte. Reck sah im Turnen einen weiteren Schwachpunkt: Er gab zu bedenken, „die fröhliche Jugend nicht schon vor dem Eintritt in das Heer mit militärischer Uebung und Strenge zu drillen“.
Sie brachten den Ball ins Rollen: August Hermann (Zweiter von rechts) und Konrad Koch (rechts) bei den Braunschweiger Sedan-Festspielen, 1902.
Tatsächlich war das Schulturnen, wie es Adolf Spieß entwickelt hatte, sehr streng organisiert. Jede Spontaneität der Schüler war ausgeschlossen. Spieß hatte den Kommandoton in den Turnhallen eingeführt, indem er die Schüler ohne Geräte in geordneten Formationen antreten und üben ließ. Für Kloss („Der Drill hat unsere Armee groß gemacht“) war und blieb dieses Turnen die Grundlage der deutschen Wehrfähigkeit. Er befürchtete, die englischen Spiele könnten den Gegnern des Schulturnens in die Hände spielen. Deshalb sprach er sich mit Bestimmtheit dafür aus, „das Schulturnen nicht in die Form des Spieles zu kleiden“. Obwohl der Fußball sich in den ersten Jahrzehnten seiner Entwicklung stark mit dem Militär verbandelte, sahen manche Kritiker in ihm offenbar die Gefahr der Verweichlichung.
Nach wortreichen Änderungsvorschlägen ein Antrag, die Redezeit auf zehn Minuten zu begrenzen, wurde abgelehnt nahm die Turnlehrerversammlung schließlich eine von Otto Heinrich Jäger ins Spiel gebrachte Umformulierung von Hermanns These an. Sie lautete: „Um die Leibesübungen zugleich zur Volkssitte zu erheben, sollte die deutsche Turnschule 1) die Volkswettübungen, 2) das Spiel (zur Ergänzung des Turnens) mehr üben und pflegen“. Unter Volkswettübungen verstanden die Turnlehrer etwas, das man heute als Leichtathletik bezeichnen würde. Nun war das Spiel ausdrücklich als vernachlässigter Bestandteil der Leibesübungen definiert. Welche Spiele das sein sollten, blieb jedoch offen.
Um den Kollegen aus ganz Deutschland eine Vorstellung zu geben, dass es sich dabei nicht bloß um Schlagball oder Bockspringen handeln musste, hatten Koch und Hermann am zweiten Tag der Versammlung eine Praxisvorführung organisiert. „Der frühe trübe Morgen rief die Theilnehmer auf den Spielplatz bei St. Leonhard, wo eine Schar Tertianer und Quartaner des Gymnasiums unter Leitung der Gymnasiallehrer Hermann und Dr. Koch Thor- und Fussballspiel vornahmen“, vermeldete der Berichterstatter der Turnlehrerversammlung. Lange konnten die Schüler des Martino-Katharineums aber nicht vorspielen:
„Ein plötzlich herniederstürzender Regen machte leider der Spiellehre und Freude ein schnelles Ende.“
Der letzte Satz galt auch im übertragenen Sinne. Die Turnlehrerversammlung 1876 führte nicht zum Durchbruch der englischen Spiele in den Turnverbänden. In Braunschweig machte die Eingliederung von Fußball und Cricket in den Schulbetrieb zwar weitere Fortschritte. Doch Koch erkannte, dass eine bloße Vorführung der Spiele nicht ausreichte. Er machte sich deshalb daran, die Vorteile der neuen englischen Spiele theoretisch zu begründen.
In den folgenden Jahren veröffentlichte Koch in mehreren Turn-und Lehrerzeitschriften Aufsätze über die pädagogische Bedeutung der englischen Spiele. 1877 erschien in der Leipziger Fachzeitschrift „Pädagogisches Archiv“, einer Monatsschrift für Erziehung, Unterricht und Wissenschaft, eine größere Abhandlung über Fußball. Sie war in Deutschland die erste ihrer Art und trug den schlichten Titel „Fußball, das englische Winterspiel“.
Auffällig ist, dass Koch auf die Kritik der Turnlehrerversammlung reagierte und behauptete, es ginge bei der Einführung des Spiels gar nicht um einen Import. Die deutsche Jugend, schrieb er, „wird mit dem Fußballe, wenn sie ihn erst nur erhält, schon auf ihre Weise umspringen und sich bald ein Spiel gestalten, das mit Vermeidung der Rohheiten mancher englischen Spielweisen die Eigenthümlichkeit deutscher Art zum Ausdruck bringt“.21 Zum anderen wurde der Fußball gegen das Unwesen des „Stubenhockerthums“22 sowie Alkohol in Stellung gebracht. „Sobald der Fußball eingeführt ward, wurden die Kneipen von ihren unbesonnenen Besuchern leer, alle lasterhaften Vergnügungen in jener Zeit wurden aufgegeben“, schrieb Koch.23 Selbstorganisierte Schülerverbindungen, die nach dem Vorbild der Studenten Saufgelage veranstalteten, waren damals ein großes Problem an den Schulen. Der Reiz des englischen Spiels, so hoffte Koch, werde sie davon abhalten können.
Darüber hinaus bot „Fußball, das englische Winterspiel“ eine sehr genaue Beschreibung der Fußballgeschichte sowie der Regeln der beiden Spielarten Rugby und Fußball wobei Koch aus seiner Vorliebe keinen Hehl machte. Er hielt Rugby für geeigneter, weil es neben den Beinen auch die Arme trainiere. Was das Abseits anging, hinkte Koch der englischen Realität allerdings hinterher: Dass die erste Abseitsregel alle Spieler müssen hinter dem Ball sein für Association seit 1866 nicht mehr galt, war ihm offenbar entgangen.
Den wichtigsten Vorteil des Fußballs bewahrte Koch sich für den Schluss auf: die Schulung des Gemeinsinns. „Es lehrt den Einzelnen sich der Gesammtheit willig einzupassen und unterzuordnen“, schrieb er über das Spiel.24 Kronzeuge dieser These war das bei deutschen Pädagogen sehr populäre Buch „Tom Brown’s Schooldays“ von Thomas Hughes. Es handelt sich dabei um die nostalgisch überhöhte Beschreibung einer Schulzeit an der Public School Rugby zur Zeit des Rektors Thomas Arnold. Koch erzählte ausführlich das Football-Match nach, das an Tom Browns erstem Tag in Rugby stattfand und bei dem die jüngeren Schüler durch eine starke Mannschaftsleistung gegen die körperlich überlegenen älteren bestanden.
1878 beschrieb Koch den Charakter der Mannschaftsspiele im Programm des Martino-Katharineums ausführlich. Die 15-seitige Abhandlung „Der erziehliche Werth der Schulspiele“ war in Deutschland der erste Versuch, die englischen Spiele pädagogisch zu untermauern. Das ging im Land der Dichter und Denker nicht ohne Koryphäen; dementsprechend tief griff Koch in den Fundus der abendländischen Geistesgeschichte. Um aus Fußball angewandte Staatsbürgerkunde zu machen, bemühte er Plato, Aristoteles, Rosseau, Herbart, Jahn, GutsMuths und Thomas Arnold. Mit dessen Erziehungsmethode in Rugby, dem „self-government“ der Schüler, hatte Koch sich während seines Studiums beschäftigt.
„Der besondere Vorzug der genannten englischen Spiele besteht eben darin, daß die Entscheidung in denselben zumeist nicht von hervorragenden Leistungen Einzelner, sondern von dem ‚Zusammenspiel‘ der Spielgenossen abhängig ist“, schrieb Koch. Er fuhr fort, „daß ein jeder nicht blos an seiner Stelle seine Schuldigkeit thut, sondern auch in jedem Augenblick seinen Mitspieler zu unterstützen, auf dessen Wünsche einzugehen bereit ist, kurz, sich in das Ganze seiner Spielgenossenschaft willig und eifrig einfügt“.25 Für die damalige Zeit war das ein moderner Gedanke. Koch verstand Fußball als den Spiegel einer Gesellschaft, die komplexer geworden war und Arbeitsteilung der Schüler erforderte.
„Die Turnschulstunden aber, die eine an militärische Disciplin anstreifende Ordnung nöthig machen, beschränken die freie Bewegung des Einzelnen zu sehr und schließen einen Verkehr der Schüler unter einander innerhalb der Stunde völlig aus“, schrieb Koch.26 Sein Ziel war ein Gemeinschaftsgefühl, in dem Raum für Individualität blieb. In einer Kurzfassung seiner Schrift wurde Koch deutlicher. Eigenmotivation beim Spiel sei „nur zu erreichen auf dem Boden der Freiheit“.27 Von hier war der Weg zu einer Analogie von Spiel und Gemeinwesen nicht weit: Der moderne Nationalstaat ist ein Zusammenspiel von Gesetz und individuellen Entscheidungen. Dem entsprechen Übungsformen, die nicht auf Zwang beruhen und innerhalb der Gemeinschaft Raum für persönliche Entfaltung lassen. Die Spielregel wurde zum Äquivalent des Gesetzes, jede Fußballmannschaft zum Modellstaat.
In einer zweiten Abhandlung setzte sich Koch auch mit dem physiologischen Wert der Spiele auseinander. „Schulspiele und Gesundheitslehre“, erschienen 1882 im „Monatsblatt für öffentliche Gesundheitspflege im Herzogtum Braunschweig“, trat den Nachweis an, dass sich Muskeln und Nerven bei Fußball und Cricket besser entwickeln als in der Turnhalle.
Für das Cricket setzte sich Koch ebenso engagiert ein. Beide Spiele traten als zwei Seiten einer Medaille auf und waren in den ersten Jahren ähnlich erfolgreich. Fußball galt als Spiel für die Wintermonate, Cricket in Deutschland seinerzeit auch Thorball genannt wurde für den Sommer empfohlen. Tatsächlich spielten viele Fußballer gleichzeitig Cricket, zum Beispiel bei Eintracht Braunschweig. In den Vereinen für Rasenspiele abgekürzt VfR wurde außer Fußball auch Cricket und Tennis betrieben. Einer der ersten DFB-Vorläufer war 1891 der Deutsche Fußball- und Cricket-Bund. Und der 1889 gegründete Berliner Thor- und Fußball-Club Victoria, in dem damals der Fußballpionier Walther Bensemann Mitglied war, wurde 1908 und 1911 Deutscher Fußballmeister.
Die Eindeutschung Thorball stammte aus Johann Christoph Fried-rich GutsMuths’ berühmtem Buch „Spiele zur Uebung und Erholung des Körpers und Geistes, für die Jugend, ihre Erzieher und allen Freunde unschuldiger Jugendfreuden“ aus dem Jahr 1796. GutsMuths war der zweite Gründervater der deutschen Turnbewegung. Sein Buch „Gymnastik für die Jugend“ von 1793 diente Jahn als Vorbild. Allerdings hatte GutsMuths’ Domäne, das Spiel, in der Turnbewegung mehr und mehr an Bedeutung verloren. Koch übernahm GutsMuths’ Begriff Thorball und veröffentlichte 1877 die „Regeln des Thorballs mit einigen Bemerkungen für Anfänger, einer Tafel und einem Plane“. Im gleichen Jahr schrieb er den Aufsatz „Vergleichung des englischen Thorballs mit dem deutschen Ballspiel ‚Kaiser‘“. Dort arbeitete er prinzipielle Unterschiede zwischen den Spielen beider Länder heraus.
Kaiserball war damals ein anderer Name für Schlagball. Dort warf ein Spieler der einen Partei einen Ball in die Höhe, den ein Spieler der anderen mit einem Schlagholz wegbefördern musste. Gelang dies, durften die Mitspieler des Schlägers zwischen zwei markierten Zonen hin- und herlaufen und bekamen dafür Punkte. Die andere Partei versuchte, den Ball aufzufangen und damit die laufenden Gegner abzuwerfen. Unverkennbar ist eine Ähnlichkeit zum Baseball, die auch durch die deutsche Übersetzung des Ballwerfers zum Ausdruck kam: Er hieß Einschenker der englische Pitcher ist zugleich der Begriff für einen Bierkrug.
Cricket, referierte Koch, ähnelt dem Schlagball. Ein Spieler wirft, einer schlägt, die „runs“ ergeben die Punkte. Aber: Beim Schlagball war das Werfen des Balles eine bloße Formalität, damit das Spiel in Gang kam. Der Einschenker hatte ein Interesse daran, dass der Schläger den Ball trifft. Beim Cricket bestand die Kunst darin, so hart oder geschickt zu werfen, dass der Schläger den Ball verfehlt und das Tor hinter ihm getroffen wird. Das Ergebnis war stärkerer Wettbewerb. Koch fasste zusammen, „erstens dass unsere beiden Spiele in Bezug auf Einschenken, Schlagen, Aufpassen in den Grundforderungen eine unverkennbare Ähnlichkeit besitzen, zweitens dass Thorball in bei weitem höheren Grade als Kaiser für alle drei Thätigkeiten Kraft und Gewandtheit, Sicherheit und Schnelligkeit erfordert“.28
„Es ist etwas anderes, einen Ball an einer Stelle einfach ein Paar Fuß hoch in die Luft zu werfen und auf eine Entfernung von 20 Meter das gegenüberliegende Thor zu treffen“, bekräftigte Koch 1878 in der Abhandlung „Cricket als Schulspiel“.29 Damit hatte er zugleich einen wichtigen Punkt herausgearbeitet, der die enorme Beliebtheit der englischen Spiele bei seinen Schülern erklärte. Es gab schlichtweg keine deutschen Spiele, die so einfach zu lernen waren wie Cricket oder Fußball und doch so viele Herausforderungen bereithielten.
Weil er mit Hermann die Erfahrung gemacht hatte, dass sich gerade ältere Schüler nicht mehr für die Schulspiele seiner Jugend interessierten, sah Koch in den englischen Spielen die Lösung. Sie waren definitiv modern, weil sie mehr Wettbewerb boten und komplexer und körperbetonter praktiziert wurden als Schlagball, Drittenabschlagen oder Wanderball. In der Tat haftete den vielen Spielesammlungen in der Nachfolge GutsMuths’ etwas höchst Altertümliches an. In ihnen finden sich auch Sackhüpfen oder Eierlaufen Spiele, die bis heute auf dem Kindergeburtstag Hochkonjunktur haben. Anders ausgedrückt: Während die deutschen Turnspiele miteinander gespielt wurden, gab es bei den englischen Spielen ein klares Konkurrenzverhältnis. Noch dazu übten sich die Schüler durch das Prinzip des fairen Wettbewerbs spielend in die Parameter von Bürgertum, Liberalismus und Freihandel ein.
Man kann es eine moderne Theorie der Spiele nennen, woran Koch damals arbeitete. Ende der 1870er Jahre war sie in ihren Grundzügen komplett. Die neuen englischen Spiele waren attraktiv, weil es wirklich um Gewinnen und Verlieren ging und der Erfolg Tor oder nicht Tor messbar und für jedermann verständlich war. Sie passten in die Zeit, weil sie durch vergleichsweise komplexe Regeln die alten ländlichen Spieltraditionen hinter sich ließen. Und sie waren erzieherisch wertvoll im Rahmen einer modernen Reformpädagogik, die in den Jugendlichen nicht mehr bloß Empfehlsempfänger in der Turnhalle sah.