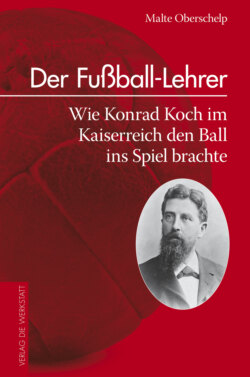Читать книгу Der Fußball-Lehrer - Malte Oberschelp - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Spielbewegung
„Doch wollen wir mit dem Erreichten uns nicht begnügen und
den zahlreichen Schulen, die noch keinen Versuch mit dem Fußball gemacht haben,
immer wieder auf’s dringendste dieses Spiel empfehlen.“
Wodurch sichern wir das Bestehen der Schulspiele auf die Dauer?
Vortrag, gehalten auf der Versammlung des Nordwestdeutschen Turnlehrer-Vereins zu Braunschweig,
am 24. October 1886 (Braunschweig 1887, Seite 9)
Koch hatte sich in seiner Heimatstadt als Mentor der englischen Spiele einen Namen gemacht. Außerhalb kannte ihn nur jene kleine Schar von Experten, die Fachzeitschriften las. Oder ihn besuchte: 1880 kamen zwei Schulmänner aus Gütersloh und Halberstadt vorbei, um sich über die neuen Schulspiele zu informieren. Dazu gab es einige schriftlichen Anfragen. Kochs Renommé wuchs auf einen Schlag, als der preußische Kultusminister Gustav von Goßler am 27. Oktober 1882 den sogenannten Spielerlass verfügte. Der Minister, nach dem in Berlin zwei Straßen benannt sind, empfahl den ihm unterstellten Schulbehörden nicht nur genau das, was Koch in Braunschweig durchgesetzt hatte. Der „Ministerial-Erlaß, betreffend die Beschaffenheit von Turnplätzen zur Förderung des Turnens im Freien und zur Belebung der Turnspiele“ erwähnte darüberhinaus Koch persönlich und empfahl dessen Schrift „Zur Geschichte und Organisation der Braunschweiger Schulspiele“ als Lektüre.
„Öfter und in freierer Weise, als es beim Schulturnen in geschlossenen Räumen möglich ist, muß der Jugend Gelegenheit gegeben werden, Kraft und Geschicklichkeit zu bethätigen und sich des Kampfes zu freuen, der mit jedem rechten Spiel verbunden ist“, hieß es im Erlass.1 Auch von Goßler stufte die Dominanz des Schulturnens in geschlossenen Hallen als schädlich ein. Sein Schreiben betonte weiter, „daß mit dem Turnplatz eine Stätte gewonnen wird, wo sich die Jugend im Spiel ihrer Freiheit freuen kann und wo sie dieselbe, nur gehalten durch Gesetz und Regel des Spiels, auch gebrauchen lernt“.2 Das war eine ähnlich moderne Bewertung der spielerischen Freiheit, wie sie auch Koch vorgenommen hatte.
Den Braunschweiger Schulmann dürfte auch gefreut haben, dass das preußische Ministerium dem Spiel ebenfalls erzieherische Wirkung zumaß. Es „lehrt und übt Gemeinsinn, weckt und stärkt die Freude am thatkräftigen Leben und die volle Hingabe an gemeinsam gestellte Aufgaben und Ziele“, wie es im Erlass heißt.3 Der Kultusminister sah das Spiel als Motor einer modernen Persönlichkeitsentwicklung, genau wie Koch es in seiner theoretischen Schrift „Der erziehliche Werth der Schulspiele“ 1878 ausgearbeitet hatte.
Sodann empfahl von Goßler eine Reihe von Spielebüchern, natürlich beginnend mit dem Ahnherrn des Genres, GutsMuths’ „Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und des Geistes“. Anschließend zählte er diejenigen Leibesübungen auf, die vom Ministerium für besonders vorbildlich befunden wurden. Neben Treibball, Schlagball, Kreisball, Stehball und diversen Laufspielen wie Barlauf finden sich in dieser Liste auch Kochs englische Spezialdisziplinen: Fußball und Cricket.
Von Goßler war nicht der Einzige, der sich um die Jugend sorgte. Bereits 1881 veröffentlichte der Düsseldorfer Amtsrichter Emil Hartwich die Schrift „Woran wir leiden“. Sie trug den Untertitel „Freie Betrachtungen und praktische Vorschläge über unsere moderne Geistes- und Körperpflege in Volk und Schule“ und erregte reichsweit Aufsehen. Im Stile eines Predigers klagte Hartwich ein Schulsystem an, das die Gymnasiasten im Industriezeitalter immer noch mit den alten Sprachen traktierte. Er wetterte gegen die „Gehirnüberreizung“,4 „unsere moderne Staub- und Stuben-Pädagogik“5 sowie „die brodlose Kunst, lateinisch und griechisch schriftstellern zu können“.6 Alle Übel der Moderne wurden einer Ursache zugeschrieben: dem Mangel an körperlicher Bewegung. Als Beleg für eine überforderte Schuljugend musste gar die Verbrechensstatistik samt Sittlichkeitsdelikten sowie die zunehmende Kurzsichtigkeit herhalten: „Wenn der große Cäsar heute lebte, würde er sicher eine Brille tragen!“7
Heute klingt das grotesk. Damals war die sogenannte Überbürdung der Schuljugend eine vieldiskutierte Frage. Zahlreiche Vereine und Gesellschaften, in denen sich vor allem das nationalliberale Bildungsbürgertum engagierte, begannen für eine umfassende Schulreform zu plädieren. Viele dieser Vereine stammten aus der Hygienebewegung, die durch das Votum von Ärzten und Naturwissenschaftlern unterstützt wurde. Es ging um zu wenig frische Luft in geschlossenen Räumen, die Folgen zu langen Sitzens und zu wenig Bewegung der Schüler. Die Diskussion beeinflusste eine Statistik, derzufolge im Herzogtum Braunschweig sechs Gymnasisaten in die Irrenanstalt eingewiesen worden waren. Oder ein ärztliches Gutachten des Kaiserlichen Statthalters in Elsass-Lothringen, das dem Schulturnen Nachholbedarf attestierte.
Im Sammelbecken der Reformer entwickelte sich eine eigene Richtung, die sich speziell für mehr Schulspiele einsetzte und heute Spielbewegung genannt wird. Emil Hartwichs Streitschrift gehörte zu ihren entscheidenden Anstößen, und Koch wurde eine ihrer zentralen Figuren. Nach und nach kamen im Verlauf der 1880er Jahre weitere Protagonisten dazu und nahmen Kontakt untereinander auf. Dabei baute die Spielbewegung unmittelbar auf die bisherigen Reformvereine auf. Der Sozialwissenschaftler Eerke U. Hamer, der „Die Anfänge der ‚Spielbewegung‘“ detailliert beschrieben hat, beurteilt von Goßlers Spielerlass zum Beispiel als eine Reaktion auf den Druck der Hygiene-und Schulreformvereine.
Auch in Braunschweig gab es einen solchen Verein. Kochs Schwiegervater Friedrich Reck war in der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte aktiv, aus der einst der Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege hervorgegangen war. 1877 gründete er einen Braunschweiger Ableger, den Verein für öffentliche Gesundheitspflege im Herzogtum Braunschweig. Koch war Mitglied und publizierte in der Monatsschrift des Vereins mehrfach über seine Erfahrungen mit den Schulspielen am Martino-Katharineum. In „Die Beseitigung des Nachmittags-Unterrichts und die Schulspiele“ plädierte er beispielsweise dafür, den Stundenplan zu straffen und mehr als nur zwei Nachmittage zum Spielen freizugeben.
Im Niederrheinischen Verein für öffentliche Gesundheitspflege wiederum war Emil Hartwich Mitglied, und seine Schrift „Woran wir leiden“ traf den Nerv der Zeit. Sie erlebte in rascher Folge zwei weitere Auflagen und drei Übersetzungen. 1885 wandte sich Prinz Wilhelm von Preußen, der spätere Kaiser Wilhelm II., an Hartwich und pflichtete ihm eingedenk seiner eigenen Schulzeit an einem altsprachlichen Gymnasium in Kassel bei. Die Diskussion hing auch damit zusammen, dass viele Abiturienten für das prestigeträchtige Einjährige der Wehrdienst unterhalb der Offizierslaufbahn untauglich waren. „Leider entbehren aber gerade die Schwächlichsten dieser energischen Korrektur durch den Unteroffizier“, bedauerte Hartwich.8 Eine Lösung war auch für ihn der Rückgriff auf die englischen Tugenden, auf Fußball und Cricket. Hartwich rief den Centralverein für Körperpflege in Volk und Schule ins Leben, der unter anderem die englischen Spiele fördern sollte.
An diesen Gleichgesinnten wollte sich Koch 1883 in einem offenen Brief wenden, der zur Veröffentlichung in Hartwichs „Korrespondenzblatt des Centralvereins für Körperpflege“ gedacht war. Die Zeitschrift erschien allerdings nur unregelmäßig und fand nach fünf Ausgaben ein Ende, als Hartwich Ende 1886 in einem Duell ums Leben kam ausgerechnet auf der Berliner Hasenhaide, Jahns erstem Turnplatz. Der Düsseldorfer Amtsrichter hatte mit der unglücklich verheirateten Elisabeth von Ardenne angebändelt und mit ihr eine geheime Korrespondenz unterhalten. Als der Ehemann, ein Baron und Adjutant des Kriegsministers, die Briefe entdeckte, forderte er Hartwich auf Pistolen. 1895 hörte Theodor Fontane von der Geschichte und machte daraus den Roman „Effie Briest“. Für die Titelheldin stand Elisabeth von Ardenne Pate, ihren Verehrer Major Crampas gab Emil Hartwich. Der streitbare Amtsrichter schaffte es noch nach seinem Tod, für Furore zu sorgen.
Kochs offener Brief erschien daher erst 1888 nach Hartwichs Tod. Mittlerweile war er zum Professor ernannt worden, was im damaligen Schuldienst in etwa einem Studienrat entsprach. Abgesehen von minimalen Differenzen über die Rolle der Schule die Koch als Lehrer aus Leidenschaft natürlich erheblich positiver bewertete stimmte er Hartwichs Philippika „Woran wir leiden“ erfreut zu. Erneut beschwor er die erzieherische Wirkung der Spiele und lobte den Fußball. „Giebt es doch für unser brustschwaches Geschlecht keine heilsameren Übungen als der Dauerlauf im Sommer und das Fußballspiel im Winter“, schrieb Koch.9
Der Überblick über die Entwicklung in Braunschweig, den Koch gegen Ende des Briefes gab, war 1888 allerdings nicht mehr ganz up to date. Nachdem die höheren Schulen der Stadt jahrelang munter gegeneinander gekickt hatten, war es für Koch nur ein konsequenter Schritt zur Erfindung des Auswärtsspiels. Am 15. November 1886 machten die 15 besten Spieler des Göttinger Gymnasiums auf dem kleinen Braunschweiger Exerzierplatz einer kombinierten Braunschweiger Rugby-Mannschaft von Martino-Katharineum und Neuem Gymnasium ihre Aufwartung. Trotz ungünstigen Wetters, berichtete Koch, habe das Spiel „einen erfreulichen Verlauf genommen“.10 Das Ergebnis hat er nicht mitgeteilt.
Am 22. März 1887 reisten die Braunschweiger zum Rückspiel nach Göttingen, das ebenfalls auf eine längere Fußballtradition blicken konnte. Das dortige Schulteam war 1879 gegründet worden. 1888 trat Kochs Anstalt gegen das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium aus Hannover an, einer Hochburg des Rugby-Fußballs. An dieser Schule war Ernst Kohlrausch Lehrer, der damals zugleich Vorsitzender des Nordwestdeutschen Turnlehrer-Vereins war. 1883 hatte er mit seinem Kollegen Alwin Marten ein Kompendium über „Turnspiele“ herausgebracht, dessen Fußballregeln sich unter anderem auf diejenigen Kochs beriefen.
Die Schulspiele, zuvorderst die englischen Rasenspiele, breiteten sich aus zumindest in Norddeutschland. 1887 listete Koch eine Absatzstatistik der Braunschweiger Firma Dolffs & Helle auf, die zu den ersten Fußballherstellern in Deutschland gehörte. Demnach hatte das Unternehmen, das als „Deutsche Cricket- und Fußballindustrie“ Werbung machte und bereits seit 1883 Bälle der Londoner Firma Lillywhite importierte, insgesamt 297 Schulen, Schulturngemeinden und Turnvereine beliefert. 23 davon kamen aus dem Herzogtum Braunschweig, die meisten der übrigen aus Nord- und Westdeutschland.
Unter diesen Spielgeräten wird auch mancher Fußball gewesen sein. „In den letzten zehn Jahren hat dieses herrliche Spiel sich über ganz Deutschland ausgebreitet, ist sogar von hier aus über seine Grenzen weiter gedrungen und hat überall einen so glänzenden Erfolg gehabt, daß ich zum Lobe desselben […] wohl kein Wort mehr zu verlieren brauche“, behauptete Koch 1887 in seinem Vortrag auf der Versammlung des Nordwestdeutschen Turnlehrer-Vereins.11 Drei Jahre später gab er an, außer in Braunschweig habe man sich auch in Bremen, Bützow, Celle, Goslar, Göttingen, Gütersloh, Halberstadt, Holzminden, Lüneburg, Magdeburg und Wiesbaden an die Einführung der neuen englischen Schulspiele gemacht.
„Fußbälle, rund und oval“: Werbung der Braunschweiger Firma Dolffs & Helle auf der Rückseite von Kochs Schrift „Wodurch sichern wir das Bestehen der Schulspiele auf die Dauer?“, 1887. Unten wird auf Kochs Fußball- und Cricketregeln hingewiesen.
Dieser positiven Bilanz stehen allerdings zahlreiche Aussagen gegenüber, die in der Zeit nach dem Spielerlass eine Stagnation beklagen. Es schien, auch das sagte Koch in seinem Vortrag, „als sei auf die Flutwelle, die unser Schiff in den sichern Hafen zu tragen verhieß, nicht die vorhergesagte Ebbe gefolgt, nein! geradezu eine mächtige Gegenströmung“.12 Zum einen lag das daran, dass von Goßlers Ministerialerlass keinerlei politische Verbindlichkeit bedeutete. Ob die Schuldirektoren auf ihn reagierten, hing allein vom persönlichen Engagement ab. Und mit Finanzmitteln aus dem Ministerium konnten sie auch nicht rechnen.
Das Leipziger Realgymnasium zum Beispiel hatte 1883 gegen viele Widerstände einen Spielplatz von der Stadt erhalten. Der verursachte Kosten zwischen 360 und 420 Mark pro Jahr, die nur mit Hilfe der Gemeinnützigen Gesellschaft der Stadt zu stemmen waren. „Die teuren Fußbälle sind hier in erster Reihe zu erwähnen und es will mir scheinen, da ihre Dauerhaftigkeit in keinem Verhältnis zu dem hohen Preise von 13 bis 16 Mk. steht, man habe immer noch nicht einen festen, guten, den vielen Stößen entsprechend ausgestatteten Ball erfunden“, berichtete der für den Platz zuständige Lehrer H. W. Wortmann.13 Auch er hatte Bälle von Dolffs & Helle in Braunschweig bezogen. Besonders die oberen Jahrgänge der Schule spielten begeistert Rugby. Ein zweites Problem war im Übrigen das Lehrerkollegium: Für schlechte Leistungen in der Schule wurde allzugern der Spielplatz haftbar gemacht. Ohne die Schulleitung, die hinter dem Projekt stand, hätte der Platz keine Zukunft gehabt.
Auch nicht gerade für Klarheit sorgte, dass von Goßlers Erlass eine wahre Inflation von Spielbüchern nach sich zog. Spielflut, Spielsucht, Spielkrawall mit solchen Begriffen kommentierten Zeitgenossen die Entwicklung. 1883 kamen „134 Spiele im Freien für die Jugend“ von Ernst Lausch und „Turnspiele für Deutschlands Jugend“ von E. Lier auf den Markt. 1884 folgte „Das Bewegungsspiel“ von Eduard Trapp und Hermann Pinzke, das allein 200 Spiele enthielt. Das Spektrum reichte von Wanderball, Armbrustschießen, Stelzenlaufen und Der Plumpsack geht herum bis Der blinde Wegweiser oder Die Piep-Blindekuh. Ganz zu schweigen von Spielen wie Hämmerchen vermieten und Der Bär kommt heraus.
Alle drei Sammlungen beriefen sich im Untertitel ausdrücklich auf den Ministerialerlass. Seinem Inhalt entsprachen sie kaum. Immerhin enthielten zwei von ihnen Cricket, und alle drei verzeichneten im Inhaltsverzeichnis ein Spiel namens Fußball allerdings nicht den Fußball Kochs. Vorgestellt wurde ein Spiel, das früher als Kreisfußball bekannt war und bei dem ein Spieler in der Mitte eines Kreises den Ball ins Freie befördern muss: eine Art Spiegelbild des fünf gegen zwei, wie es heutzutage jede Profimannschaft im Training spielt. Doch gerade für die avisierte Zielgruppe der älteren Schüler war wenig Brauchbares dabei.
Auch Koch gab zu, dass es „unter vielem Wertlosen und manchem geradezu Verkehrten nur ganz vereinzelt brauchbare Anweisungen“ unter den Neuerscheinungen gab. „Verantwortlich aber wurde für die Mißerfolge […] nicht derjenige gemacht, der die Sache ohne richtige Einsicht und verkehrt angefaßt oder sie nur lau betrieben hatte“, klagte er, „die Schuld fiel auf die Spiele selbst zurück.“14 Es fehlte an Fachleuten, Organisation und Geld. Während die Fußballbewegung der Sportsleute Fortschritte machte und sich einige Vereine gründeten, trat die Spielbewegung der Turner Mitte 1880er Jahre auf der Stelle.
Auch deshalb, weil viele Turner ihre Autorität untergraben sahen. Sie kamen sich vor wie ein alter Wandersmann, der plötzlich den Wald vor lauter Mountainbikern nicht mehr sieht. „Kalt und nüchtern, gewappnet bis an die Zähne, eisig und frostig standen uns im Dienste unserer Turnerei ergraute Männer gegenüber“, berichtete Wortmann aus Leipzig.15 Viele Turnlehrer hatten der Spielbewegung von jeher skeptisch gegenübergestanden. Obwohl in den Turnvereinen kaum noch gespielt wurde, verwies man leicht beleidigt darauf, dass schließlich schon Jahn und vor allem GutsMuths die Bedeutung der Spiele erkannt hatten.
Als GutsMuths’ Spielbuch, das von Koryphäen der Turnbewegung regelmäßig aktualisiert und erweitert wurde, 1885 in der siebten Auflage erschien, beschwerte sich der Chemnitzer Oberturnlehrer Moritz Zettler in einer Rezension über die neuen Spielesammlungen: „Auf mich machte diese emsige Herausgabe solcher Werke, von denen wohl die meisten, ohne irgend einen Verlust wach zu rufen, schon wieder verschollen sind, den Eindruck, als ob man gar nicht die alte classische Quelle ‚Spiele zur Uebung und Erholung des Körpers und Geistes‘ von GutsMuths gekannt hätte.“16 Dann kam Zettler auf den Punkt: „Ja man that mitunter auch so, als ob die bisherigen Träger der Turnsache sich um die Belebung und Förderung des Spielbetriebes der heranwachsenden Jugend ganz und gar nicht gekümmert hätten.“17 Dass in dieser Neuauflage von GutsMuths’ Buch zum ersten Mal beide Spielarten des englischen Fußballs aufgenommen worden waren, erwähnte Zettler nicht.
1888 lieferte sich Zettler in der „Deutschen Turn-Zeitung“ dann einen Strauß mit August Hermann, der erneut eine Lanze für Neuerungen brach und etwa das Geräteturnen durch volkstümliche Übungen ergänzen wollte. Auch dort verteidigte Zettler das Turnen und schimpfte über die Folgen des Spielerlasses von 1882: „Ich freue mich, daß diese Spielsucht wieder geschwunden ist.“18 Fünf Jahre später ergänzte er die vielen Bibliotheksmeter an Spielliteratur um ein eigenes Werk wobei man fairerweise sagen muss, dass Zettlers „Die Bewegungsspiele. Ihr Wesen, ihre Geschichte und ihr Betrieb“ eher eine weltweit angelegte Studie über Spiele als eine simple Regelsammlung war.
Trotz aller Hindernisse sorgten die Reformvereine dafür, dass das Thema Schulspiele auf der Tagesordnung blieb. Mitte der 1880er Jahre nahm der Druck wieder zu. Einer der Gründe war, dass ein deutscher Lehrer auf Staatskosten nach England gefahren war, um die Rolle der Schulspiele an den Public Schools zu studieren. Er hieß Hermann Raydt und reiste quasi mit den besten Wünschen von Reichskanzler Otto von Bismarck. Der hatte die Schönhausen-Stiftung ins Leben gerufen, die nach seinem Geburtsort benannt und für Lehramtskandidaten an höheren Schulen gedacht war. Raydt war einer der ersten Stipendiaten.
Der zukünftige Lehrer aus Ratzeburg besuchte im Sommer 1886 zwei Schulen in Schottland sowie das Eton College in Windsor, die älteste Public School Winchester College und natürlich Thomas Arnolds ehemalige Schule in Rugby jene Schule, die entscheidend an der Entwicklung des Fußballs beteiligt war. Über seine Erlebnisse schrieb Raydt eine Reihe von Artikeln im „Hannoverschen Courier“ (die Koch las) und veröffentlichte 1889 ein Buch mit einem wenig einfallsreichen Titel und desto programmatischeren Untertitel: „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Englische Schulbilder in deutschem Rahmen“.
„Football zu Rugby“: Abbildung aus Hermann Raydts England-Bericht „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“, 1889.
Raydts Buch war eine fast schwärmerische Werbung für die englischen Schulspiele. Abgefasst war der Reisebericht in Form von Briefen an einen imaginären Schüler eine Referenz an Ludwig Adolf Wiese und seine „Deutschen Briefe über englische Erziehung“, die in zwei Bänden 1850 und 1877 erschienen waren. Man könnte auch so sagen: Raydt wollte in England das sehen, was er in „Tom Brown’s School-days“ gelesen hatte. Als er in Rugby eintrifft und durch einen Schüler begrüßt wird, glaubt er sich fast wie Tom Brown bei dessen Ankunft zu fühlen. Auch sonst steckt Raydts Bericht voller Hinweise auf das Buch von Thomas Hughes, das in der Spielbewegung zu einer Ikone stilisiert wurde.
Dabei übersah der deutsche Besucher die Nachteile der englischen Eilte-Internate. Das Präfektorialsystem, die Aufsichtspflicht der älteren Schüler über die jüngeren, artete im Schulalltag regelmäßig in teils brutale Schikanen aus. „Bullying“, das Quälen der Neuankömmlinge, und „Fagging“, das Bedienen der älteren Schüler, war an der Tagesordnung. In „Tom Brown’s Schooldays“ gibt es eine Szene, in der Tom an den brennenden Kamin gedrängt wird, bis er vor Schmerzen ohnmächtig wird. Auch beim Sport, besonders beim Fußball, waren die jüngeren Schüler quasi Freiwild für die stärkeren Jungen.
Raydt hielt derlei Übergriffe für Relikte aus der Vergangenheit. „Die älteren Schüler bilden, soweit ich habe bemerken können, in allen englischen Public Schools ein nettes vermittelndes Verhältnis zwischen den jüngeren Knaben und den Lehrern.“19 Dem widersprachen beispielsweise die Erfahrungen Walther Bensemanns. Der Vereins-gründer, Fußballimpresario und spätere „Kicker“-Gründer hatte seine Jugend in einem Schweizer Internat verbracht und dort viele englische Schüler kennengelernt. In der Schrift „Public school und Gymnasium“ schrieb der 20-jährige Bensemann 1893 über den typischen Präfekten, „dass er im Laufe seiner Amtszeit Dutzende von Knaben nicht nur moralisch, sondern physisch zu Grunde richtet“.20
Auf seiner Reise 1886 bemerkte Raydt die Schattenseiten der englischen Internate nicht oder wollte sie nicht bemerken. Umso besser kannte er die des deutschen Schulwesens. Wortreich geißelte er das alkoholschwangere Verbindungswesen an den Universitäten, deren Studenten den Primanern und Sekundanern der Gymnasien das Kampftrinken beibrachten oder sie mit Fechtduellen bekannt machten. Den Fehler im System aber benannte Raydt wie Hartwich so: „eine Überbürdung der gewissenhaften Knaben, sofern sie nicht besonders gut beanlagt sind, mit geistiger Arbeit ohne ein genügendes Äquivalent körperlicher Übungen“.21
Auf den englischen Schulen war das genau andersherum. Ein guter Ballspieler galt dort mehr als der Klassenprimus. Diese physiologische und pädagogische Wirkung der Schulspiele wollte Raydt nach Deutschland importieren. Trotz aller Parteilichkeit und Schwärmerei leistete „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ in dieser Hinsicht wichtige Vermittlungsarbeit. Das Buch beschrieb die Strukturen und Tagesabläufe der Public Schools recht genau und enthielt großformatige Bilder spielender Schüler. Raydt schilderte ein Match zwischen Harrow und Eton, das er auf dem Londoner Lord’s Cricket Ground dem Wembley des Cricket beobachtet hatte. Und sein Buch enthielt eine Beschreibung des Fußballs auch wenn Raydt damals noch glaubte, in Deutschland heiße dieses Spiel „Thorball“.
Auf der Rückreise nach Deutschland besuchte Raydt zunächst Hartwich und dann Koch. Das Netzwerk der Spielbewegung formierte sich. „Ich freute mich, in genanntem Herrn einen Mann kennen zu lernen, der in Wort und Schrift viel für die Einführung der körperlichen Spiele in freier Luft für unsere höheren Schulen gewirkt und der mit eben so viel Geschick wie unermüdlichem Eifer die Möglichkeit gezeigt hat, daß auch ohne die Ansprüche auf geistigem Gebiet zu ermäßigen eine Wiedereinführung kräftigender Jugendspiele bei uns möglich ist“, schrieb Raydt über Koch.22 Natürlich kam er in den Genuss einer Spielevorführung und war des Lobes voll. „Die jungen Leute machten bei der Kricketpartie, welche ich sah, einen frischen, kräftigen und fröhlichen Eindruck, und manche Schläge und Würfe hätten sich auch in England, dem Lande des Krickets, sehen lassen können.“23
Kritik übte der Ratzeburger Kollege nur am Zustand des Platzes. Außerdem gab er sogleich eine seiner Erfahrungen aus England weiter. Er empfahl Koch, seine Schüler „mit leichtem Flanellanzuge“ spielen zu lassen: „Der Körper kann sich dann doch freier und besser bewegen und mehr ausdünsten, so daß der gesundheitliche Zweck des Spiels vollkommener erreicht wird.“ Zum Schluss bemühte sich Raydt aber wieder, die Pionierleistungen des Kollegen herauszustellen. Er habe „die Überzeugung gewonnen, daß sich Professor Dr. Koch nicht nur um seine Schüler und um die Stadt Braunschweig, sondern um das Erziehungswesen des ganzen deutschen Reiches ein nicht zu unterschätzendes Verdienst erworben hat“.
Raydt reiste zurück nach Ratzeburg, ließ an seinem Gymnasium alsbald auch Fußball spielen und verfasste 1889 die „Englischen Schulbilder in deutschem Rahmen“. Der letzte Gruß an den Kollegen in Braunschweig darin lautete: „Seinen weiteren Bestrebungen wünsche ich alles, was gut und glücklich ist.“ Zwei Jahre später saßen Hermann Raydt und Konrad Koch gemeinsam im organisatorischen Zentrum der Spielbewegung: im Vorstand des Zentralausschusses zur Förderung der Volks- und Jugendspiele in Deutschland.