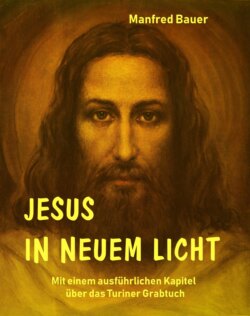Читать книгу Jesus in Neuem Licht - Manfred Bauer - Страница 6
2. Kapitel
ОглавлениеGeschichte des Judentums
Die Lehren Jesu wurzelten in den religiösen Anschauungen und den historischen Erfahrungen des Judentums. Bevor wir uns daher seiner Person zuwenden, ist es unerlässlich, die Geschichte seines Volkes näher zu betrachten. Nur in diesem Kontext können wir ihn verstehen. Zumal es ein außergewöhnlich eigenwilliges Volk ist, wie aus folgenden Texten zu ersehen ist.
Denn du bist ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott, Dich hat der HERR, dein Gott erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. 1
Wache auf, wache auf! Zion, ziehe deine Stärke an! Lege deine Ehrenkleider an, Jerusalem, du heilige Stadt! Denn hinfort wird kein Unbeschnittener noch Unreiner mehr in dich hineinkommen. Schüttle den Staub von dir ab, stehe auf und setze dich, Jerusalem! Mache dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion! Denn also spricht der HERR: Umsonst seid ihr verkauft worden, so sollt ihr auch ohne Geld erlöst werden. 2
Als nun solches alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und Leviten hielten sich nicht abgesondert von den Völkern der Länder, trotz ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hetitern, Pheresitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben deren Töchter genommen für sich und ihre Söhne und haben den heiligen Samen mit den Völkern der Länder vermischt; und die Hand der Obersten und Vornehmsten ist in dieser Missetat die erste gewesen. 3
Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen: Ihr habt euch versündigt und habt fremde Frauen heimgeführt, womit ihr die Schuld Israels noch größer machtet. So leget nun dem HERRN, dem Gott eurer Väter, ein Bekenntnis ab und tut, was ihm wohlgefällig ist, und scheidet euch von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen! Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme: Es soll geschehen wie du uns gesagt hast! 4
Was haben nun diese Texte des Alten Testamentes, die um 500 Jahre v. Chr. und früher niedergeschrieben wurden, mit der Situation Israels in der Zeit Jesu zu tun?
Das Selbstverständnis der Juden begründete sich auf diese Schriften und ist entscheidend für die Probleme die sie mit den Römern bzw. die Römer mit ihnen hatten.
Sie verstanden sich als auserwähltes, kultisch reines Volk Gottes. Jeder Kontakt mit Angehörigen eines anderen Volkes war für sie eine Verunreinigung. Sie aßen niemals zusammen mit einem Nichtjuden, ja, sie betraten nicht einmal sein Haus. Schon das Betreten ihres Staatsgebietes – der von JHWH geheilige Boden Israels – durch Angehörige anderer Völker war ihnen unerträglich.
„Das gesamte Judentum … war besessen von Fragen der ,Reinheit‘. Heiligkeit wurde verstanden als ,Trennung von allem Unreinen‘, und das System der ,Politik der Heiligkeit‘ setzte Heiligkeit mit Reinheit gleich. Es schuf ein Reinheitssystem, durch das ein Spektrum an Menschen entstand, das sich von den ,Reinen‘ über verschiedene Ausprägungen von ,Reinheit‘, bis hin zu den Menschen in den äußeren Randbereichen der Gesellschaft erstreckte, die von Grund auf und unwiderruflich unrein waren. Zu den Gerechten gehörten diejenigen, die das Reinheitssystem befolgten, und ,Sünder‘ waren diejenigen, die es nicht taten. Bestimmte Berufe – wie Steuereintreiber und Schafhirten – waren automatisch unrein. ,Sünde‘ war nicht mehr eine Frage des inneren Gewissens, sondern eine Frage von ,Unreinheit‘ und somit von ,Unberührbarkeit‘. Die körperlich Unversehrten waren ,rein‘, die Verstümmelten, chronisch Kranken und Leprakranken waren es nicht. Reich zu sein bedeutete nicht automatisch, auch ,rein‘ zu sein, durch bittere Armut aber wurde man fast unweigerlich ,unrein‘. Dies war zum Teil darauf zurückzuführen, dass man glaubte, Reichtum sei ein Zeichen göttlichen Segens, zum Teil aber auch darauf, dass die bitter armen Menschen keine Möglichkeit hatten, die Reinheitsgesetze zu befolgen. Weder waren Männer automatisch rein, noch waren Frauen automatisch unrein, aber … sowohl die Menstruation als auch die Geburt (wurden) als Quellen von Unreinheit betrachtet und führten wie in vielen anderen Kulturen des Altertums auch, zu der allgemeinen Überzeugung, dass Frauen ,unrein‘ seien. Jüdisch zu sein war keine Garantie für Reinheit, jedoch waren per Definition alle Nichtjuden unrein." 5
Für das Volk Israel waren die Vorschriften über die kultische Reinheit, die sich aus den Schriften ergaben, Gebote JHWH's. Und sie waren sein Auserwähltes Volk.
Wie wir schon gesehen haben, war es nicht Gott, der diese Texte eingegeben hatte, sondern sie waren von der Priesterschaft niedergeschrieben, um den Kult um JHWH vor der Konkurrenz durch andere Götter zu schützen und einer Überfremdung durch Vermischung mit angrenzenden Völkern vorzubeugen.
So wie Gott die Sonne scheinen lässt über Gerechte und Ungerechte, so bevorzugt oder benachteiligt er auch niemanden. Daher gibt es auch kein von ihm „Auserwähltes Volk“.
Aber für das Volk Israel war diese Vorstellung und die Gebote JHWH' s Teil ihrer Identität. Daran gab es nicht zu rütteln. Und jetzt, unter römischer Herrschaft, mussten sie in ihrem Land Heiden aus allen Regionen des römischen Reiches dulden: Griechen, Römer, Gallier, Ägypter und noch viele andere. Die Eingliederung in die imperiale Gemeinschaft Roms bedeutete in den Augen der Juden Erniedrigung und eine Bedrohung ihrer Exklusivität.
Andere Völker dagegen schätzten die Vorteile der Pax Romana, den Frieden im Inneren des Reiches, der Stabilität, Sicherheit und Wohlstand mit sich brachte. Das kulturelle und wirtschaftliche Leben blühte, da die einzelnen Provinzen weitgehend von äußeren Feinden durch das römische Heer geschützt waren. Viele Städte besaßen sogar keine Mauern mehr.
Für die Juden war dies jedoch keine Option. Für sie waren die Römer unrein und sie nannten sie – da sie zu alledem noch Schweinefleisch aßen – Schweine.
Im Buch Josua ist geschildert wie dieser bei der Landnahme (etwa 1500-1200 v. Chr.) mit seinem Heer die Städte der ansässigen Völker eine nach der anderen einnimmt und jedes Mal die ansässige Bevölkerung inklusive der Tiere ausrottet:
Also schlug Josua das ganze Land auf dem Gebirge und gegen den Süden und in den Tälern und an den Abhängen, samt allen ihren Königen, und ließ nicht einen übrigbleiben und vollstreckte den Bann an allem, was Odem hatte wie der HERR, der Gott Israels, geboten hatte. 6
Diese Vorgehensweise befahl JHWH bereits im 5. Buch Mose:
Aber in den Städten dieser Völker, die der HERR, dein Gott, dir zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hetitern, Amoritern, Kanaanitern, Pheresitern, Hevitern und Jebusitern; wie der HERR, dein Gott, dir geboten hat. 7
Was hätte Josua wohl mit diesen „römischen Schweinen“ gemacht?
Sie aber waren machtlos gegenüber deren Herrschaft und ihren Günstlingen, zu denen auch die Tempelpriesterschaft gehörte. Wut und Hass, geboren aus dieser Diskrepanz, wie Israel nach dem Willen JHWH's sein sollte und wie es tatsächlich war, sorgten für ein ständiges Rumoren im Volk. Die herrschende Schicht war ständig bemüht, jeden Ansatz eines Aufstandes – oft mit brutaler Gewalt – in Keim zu ersticken.
Waren die Israeliten bei der Sesshaftwerdung im Land Kanaan zwischen 1500 und 1200 v. Chr. wirklich so außergewöhnlich brutal und blutrünstig vorgegangen wie bei Josua oder Mose geschrieben steht?
Die Historiker und Archäologen sind eher der Meinung, dass sie große Aufschneider waren. Die Berichte über die angeblichen Kriegszüge wurden erst Jahrhunderte später niedergeschrieben. Hierbei wurden sie religiös verbrämt. Siege wurden völlig übertrieben dargestellt. Man denke an den Fall der Stadtmauer von Jericho, verursacht durch das Umkreisen mittels der Bundeslade und einer Blaskapelle – sieben Tage lang. 8
Trotz der Ausführlichkeit mit der dies erzählt wird, konnte die Archäologie keine Anzeichen für eine Stadtmauer finden. Auch war die Stadt zu dieser Zeit verfallen und nicht besiedelt. Hier wurde offensichtlich eine Sage über eine frühere Eroberung der Stadt durch ein anderes Volk aktualisiert und in die eigene Geschichte integriert.
Man sprach stereotypisch von der totalen Vernichtung des Gegners, verschwieg Niederlagen oder deutete sie in Siege um. Manche Siege wurden wiederholt erzählt und jeweils anderen Feldherren zugerechnet.
Die Hebräer waren vor der Zeit der Sesshaftwertung ein schlecht organisierter Haufen nomadischer Stämme. Es ist kaum vorstellbar, dass sie gut gerüstete und befestigte Städte militärisch einnehmen konnten.
Die Besiedlung Kanaans ging vielmehr nach und nach vor sich, wobei es sicher auch hin und wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit der ansässigen Bevölkerung kam, anfangs jedoch vor allem zur Vermischung mit dieser.
Tatsächlich musste sich das jüdische Volk schon Jahrhunderte vor der Römerzeit viel öfter ausländischer Herrschaft beugen, als den eigenen Königen. Sein Siedlungsgebiet lag an strategisch wichtiger Stelle für die Großmächte. So machten die Babylonier im Jahre 597 v. Chr. Jerusalem dem Erdboden gleich und führten die Bevölkerung in die Gefangenschaft. Nachdem die Perser die Babylonier geschlagen hatten, erlaubten sie die Rückkehr der Verbannten, jedoch unter persischer Oberhoheit. Durch Alexander den Großen, der die Perser besiegte, kamen sie unter die Herrschaft der Griechen und in Berührung mit deren Kultur. Nach Alexanders Tod im Jahre 323 v. Chr. wurden sie Kriegsbeute der Ptolemäer und von Ägypten aus regiert. Diese wiederum mussten 198 v. Chr. den Seleukiden weichen.
Deren König Antiochos Epiphanes machte jedoch einen entscheidenden Fehler. Um seine Herrschaft in Jerusalem zu stabilisieren, verbot Antiochos den religiösen Kult der Juden und ließ den Tempel zu einer Kultstätte des Zeus umweihen. Damit traf er jedoch das religiöse Selbstverständnis Israels mitten ins Herz. Der Götzendienst anderer Völker war ihnen ein Gräuel. Dass sie nun anstelle ihres Gottes JHWH Götzen anbeten sollten, war für sie so unerträglich, dass dies 166 v. Chr. zu einen gnadenlosen Guerillakrieg unter dem Hasmonäer Mattatias führte – auch Aufstand der Makkabäer nach Judas Makkabäus genannt. Sie erreichten hierbei tatsächlich die Unabhängigkeit und zum ersten Mal seit vier Jahrhunderten wieder eine jüdische Vorherrschaft über die Provinzen Judäa, Galiläa und Samarien.
Die hasmonäischen Könige – auch Makkabäer genannt – waren gleichzeitig Herrscher und Hohepriester. Sie begründeten ein streng religiös orientiertes System des Priesterkönigtums. Dies bescherte Israel eine mehr als ein Jahrhundert währende Zeit weitgehender Eigenständigkeit.
All dies endete im Jahre 63 v. Chr. durch Egoismus und Dummheit der Herrschenden. Im Jahre 67 v. Chr. sollte Johannes Hyrkanos König werden. Jedoch kam es zum Streit mit seinem jüngeren Bruder Aristobul, weil dieser ebenfalls den Thron für sich beanspruchte.
Der daraufhin ausbrechende Bürgerkrieg sah mal den einen und mal den anderen als Sieger, bis schließlich beide Parteien Rom um Hilfe anriefen. Dessen Feldherr Pompeius entschied sich zu Gunsten Hyrkanos, und da er ohnehin mit seinem Heer in der Nähe war, ließ er sich nicht lange bitten und beendete den Bürgerkrieg mit der Einnahme Jerusalems, wobei 12.000 Einwohner ums Leben gekommen sein sollen.
Hyrkanos wurde als Hoherpriester und Ethnarch (etwa der Rang eines Fürsten) in Judäa eingesetzt. Judäa war damit Rom tributpflichtig geworden. Aristobul, der gefangen nach Rom gebracht worden war, konnte nach einiger Zeit fliehen und entfachte in Judäa einen Aufstand, der von den Römern blutig niedergeschlagen wurde. Wiederum wurde er nach Rom gebracht und dort im Jahre 49 v. Chr. vergiftet.
Als aber Antigonus, ein Sohn des getöteten Aristobul., sich mit den Parthern (ein antikes Volk, das am Kaspischen Meer beheimatet war) verbündete, geriet nun Hyrkanos im Jahre 40 v. Chr. in dessen Gefangenschaft. Da nur ein körperlich Unversehrter für das Amt des Hohenpriesters in Frage kam, wurde Hyrkanos durch das Abschneiden seiner Ohren hierfür untauglich gemacht und nach Mesopotamien verschleppt.
Antigonus regierte danach als Priesterkönig bis ein Mann ins Spiel kam, der auch im Evangelium des Matthäus eine unrühmliche Rolle spielt – zugleich klug und gerissen, fürsorglich und gewissenlos, führungsstark und brutal.
Herodes der Große
Er entstammte einer einflussreichen idumäischen Familie. Die Idumäer hatten zwar einige Jahrzehnte zuvor die jüdische Religion angenommen, wurden aber von den Juden nicht als ihresgleichen angesehen. So blieb auch Herodes in Judäa zeitlebens ein Außenseiter.
Bereits im Jahre 41 v. Chr. war er von den Römern zum König von Judäa ernannt worden, musste sich den Thron aber erst erkämpfen, indem er in einem dreijährigen Krieg Antigonus und die Parther mithilfe der Römer besiegte. Antigonus wurde danach hingerichtet.
37 v. Chr. bis zu seinem Tode im Jahre 4 v. Chr. war er König von Judäa und erhielt nach und nach Samaria, Galiläa und angrenzende Gebiete dazu.
Herodes beherrschte meisterhaft den Balanceakt, sich in einem Gewirr von gegensätzlichen Interessen, Hass und Intrigen an der Macht zu halten. Josephus Flavius, der jüdische Geschichtsschreiber, schildert ausführlich wie er einerseits in einer Dürreperiode Kunstgegenstände seines Palastes einschmelzen ließ, um mit dem Gold in Ägypten Getreide für seine Untertanen zu kaufen oder ein anderes Mal in einer Hungersnot die Steuern herabsetzte. Das machte ihn zeitweise im Volk sogar beliebt.
Da er jedoch darauf angewiesen war, sich mit den Römern gut zu stellen, hielt dies jedoch nicht lange an. Er lieferte diesen oft mehr Tributzahlungen als gefordert und war auch mit einigen Herrschern, Heerführern und sogar dem römischen Kaiser befreundet. Um Unruhen im Volke frühzeitig zu erkennen, baute er eine Geheimpolizei auf und beseitigte jeden, der sich seiner Herrschaft in den Weg stellte.
So ließ er die noch lebenden Mitglieder des Hasmonäerhauses ermorden und ersetzte sie durch eigene Günstlinge.
Nachdem er den Enkel des Hyrkanos, den beim Volk beliebten 17-jährigen Aristobul III, auf Drängen der Römer zum Hohenpriester ernannt hatte, ließ er ihn 36 v. Chr. beim Baden ertränken. Vier Jahre später fiel auch Hyrkanos selbst seiner Mordlust zum Opfer. Diese machte auch vor seiner eigenen Familie nicht halt. So ließ er im Laufe seiner Regierungszeit Mariamne, seine zweite von wahrscheinlich sieben Frauen, deren Mutter Alexandra, seinen Schwager Kostobaros sowie seine Söhne Alexandros, Aristobolos und Antipatros wegen angeblicher Verschwörung hinrichten.
Josephus beschreibt wie seine Mutter und seine Schwester, die Mariamne hassten, gegen diese intrigierten, mit dem Ziel, den König glauben zu machen, diese hätte ihn mit einem Liebestrank vergiften wollen. Da er Mariamne sehr liebte, zögerte er mit einer Verurteilung. Angeblich hätte sie sich aber gegen ihn sehr hochmütig und abweisend verhalten, so dass er sie schließlich in einem Gerichtsverfahren zum Tode verurteilen ließ. Hernach habe er sehr um sie getrauert.
Nebenbei wurde in dieser Angelegenheit noch deren Eunuch gefoltert und der ihm treu ergebene Soemus als angeblichen Nebenbuhler hingerichtet.
Interessant ist in diesem Zusammenhang eine kleine Geschichte, die Josephus erwähnt. Ein gewisser Manaem aus der Sekte der Essener sagte Herodes, als dieser noch ein einfacher, kleiner Junge war, voraus, dass er einstmals König der Juden werden würde.
„Du wirst in der Tat König werden und, weil dich Gott dessen für würdig hält, eine glückliche Regierung führen. Erinnere dich… dass alles Glück wandelbar ist. Denn eine solche Erwägung wird dir zu großem Nutzen gereichen, wenn du Gerechtigkeit und Frömmigkeit liebst und dich gegen deine Untertanen mild erweisest. Ich aber… weiß bestimmt, dass du so nicht sein wirst. Denn du wirst wohl… ein glückliches Leben führen und dir ewigen Ruhm erwerben, Frömmigkeit und Gerechtigkeit aber wirst Du vergessen. Allein Gott dem Herrn wird dies nicht verborgen bleiben, und er wird dich am Ende deines Lebens dafür bestrafen."
Als Herodes dann tatsächlich König wurde, ließ er den Manaem rufen und fragte ihn, wie lange er noch regieren werde. Als dieser ihm sagte, dass er noch 20–30 Jahre vor sich hätte, war er damit zufrieden, entließ Manaem und hielt von der Zeit an alle Essener in Ehren.9 Die letzten Jahre seines Lebens war Herodes sehr krank – er hatte hochgradige Gelbsucht – und als er im Jahre 4 v. Chr. seinen Tod herannahen fühlte, war er Realist genug um zu wissen, dass sein Tod vom Volk mit Erleichterung und Jubel aufgenommen werden würde. Einfallsreich wie er war, ersann er ein Szenario, wie er das Volk nach seinem Tode dazu bringen könnte, zu trauern. Er befahl die Vornehmen des ganzen Volkes zu sich und ließ sie im Amphitheater einsperren. Josephus schreibt hierzu: „Er (Herodes) kenne ja die Gesinnung der Juden recht wohl und wisse, dass sie sich über nichts so sehr freuen würden, als über seinen Tod, da sie sich schon bei seinen Lebzeiten sich gegen ihn empört… hätten. Es werde also Pflicht der Salome (seine Schwester, der Autor) und ihres Gatten sein, diesem Übelstand abzuhelfen. Wenn sie seiner Meinung beipflichteten, müssten sie ihm ein glänzendes Leichenbegräbnis veranstalten wie es noch nie einen König zuteil geworden sei, und das ganze Volk werde dann aufrichtig um ihn trauern, während es ihn sonst nur mit Spott und Hohn beklagen werde. Sobald Sie daher wahrnähmen, dass er seinen Geist aufgegeben habe, sollten Sie die Rennbahn von Soldaten umzingeln lassen, … und dann alle eingeschlossenen Juden mit Pfeilen erschießen lassen. Durch eine solche Tat würden sie ihm eine doppelte Freude bereiten, indem sie … eine seiner würdigen Totenklage zustande brächten.“10
Allerdings hatten seine Schwester und sein Schwager Verstand genug, diesen Plan nicht in die Tat umzusetzen. Herodes bekam zwar ein monumentales Begräbnis, die im Amphitheater Eingeschlossenen wurden jedoch unversehrt freigelassen.
Der herodianische Tempel
Herodes war auch ein genialer Organisator. Er rief ein monumentales Bauprogramm ins Leben. Überall ließ er nach griechischem Vorbild Märkte, Theater, Paläste und Häfen errichten, was ihm bei seinen jüdischen Untertanen wiederum verhasst machte, da sie diese ausländische Kultur ablehnten oder als Götzendienst verachteten.
Mit seinem größten Projekt wollte er jedoch nicht nur seine Gönner, die Römer beeindrucken, sondern sich vor allem die Liebe des Volkes erwerben. Er ließ den eher bescheidenen Tempel in Jerusalem, der nach der Zerstörung des Salomonischen Tempels im Jahre 597 v. Chr. durch die Babylonier, errichtet worden war, abtragen und auf dem höchsten Punkt der Stadt einen monumentalen Bau im griechischen Stil errichten. Dieser erstreckte sich über 15 % der gesamten Fläche Jerusalems und galt als eines der Wunderwerke der antiken Welt.
Lassen wir die Beschreibung des Josephus Flavius auf uns wirken:
„Das Äußere des Tempels wies alles auf, was Herz und Augen staunen lässt. Denn über und über war der Tempel mit dicken Goldplatten umhüllt, und wenn die Sonne aufging, dann gab er einen Glanz wie Feuer von sich, so dass der Beschauer, auch wenn er absichtlich hinsah, sein Auge wie vor den Strahlen der Sonne abwandte. Tatsächlich hatten die Fremden, die sich Jerusalem näherten, den Eindruck eines Schneegipfels; denn wo er des Goldes entbehrte, da war er leuchtend weiß."11
Herodes sah den Tempel, an dem die Massen zusammenströmten, aber auch als potenziellen Ausbruchsherd von Revolten. Zur Bewachung des Areals verstärkte er daher die im Norden an den Tempelbezirk grenzende Burg Antonia. Deren Festungstürme überragten die Mauern des Tempelbezirks als steinerne Mahnung.
Wieso war für die Juden dieser zentrale Tempel in Jerusalem so wichtig?
Dies ist dem 5. Buch Mose, auch Deuteronomium genannt, zu entnehmen. Dort ist festgelegt, dass JHWH nur an einem zentralen Ort geopfert werden darf: „Wenn nun der HERR, euer Gott, einen Ort erwählt, dass sein Name daselbst wohne, so sollt ihr dorthin bringen alles, was ich euch gebiete: Eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten, eurer Hände Hebopfer und alle eure auserlesenen Gelübde, die ihr dem HERRN geloben werdet,
( …) Hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht an einem beliebigen Orte opferst, den du sehen wirst; sondern an dem Ort, den der HERR in einem deiner Stämme erwählt,….“ 12 Das hatte zur Folge, dass dieser Kult nirgendwo sonst ausgeübt werden durfte.
Vor allem zu den großen jüdischen Wallfahrtsfesten, Pessach (Fest der ungesäuerten Brote), Schawuot (Wochenfest) und Sukkoth (Laubhüttenfest), strömten gewaltige Pilgermassen aus den jüdischen Gebieten Palästinas und sogar aus dem gesamten römischen Reich zum Tempel. Über 100.000 Pilger dürften die Stadt dann förmlich überschwemmt haben. Sie alle suchten die Versöhnung mit JHWH und die Vergebung ihrer Sünden.
Man konnte ihn mit einem Tieropfer – hauptsächlich Stiere, Schaf- und Ziegenböcke und für ärmere Bevölkerungsschichten Tauben – gnädig stimmen oder Sündenvergebung erlangen. Die Tiere hatten völlig makellos zu sein.
Abbildung 1: Nachbildung des Jerusalemer Tempels
Begleiten wir nun eine Pilgerfamilie, bestehend aus Vater, Mutter, Söhnen und Töchtern. Diese mussten sich zunächst in einer der vielen Badestellen – Mikwa genannt – reinigen. An Hygiene war hierbei nicht zu denken, da Hunderte oder Tausende von Pilgern in demselben Wasser untertauchten. Es ging hierbei vielmehr um kultische Reinheit.
Als sie nun die Treppen zum Eingang des Tempels hochsteigen, werden sie von Leviten, der untersten Schicht der Tempelpriesterschaft, auf eben diese Reinheit überprüft. Durch einen der Eingänge in den äußeren Umfassungsmauern gelangen sie zunächst in den sogenannten „Heidenvorhof“. Dieser ist auch für Nichtjuden zugänglich.
Sie treffen hier auf eine Vielzahl von Händlern, die Opfertiere jeder Art in Käfigen bereithalten. Die Tiere dürfen allerdings nicht mit griechischen oder römischen Münzen bezahlt werden, da diese Bilder des Kaisers oder anderer Herrscher aufweisen und somit gegen das Bilderverbot in den Schriften verstoßen. Daher gesellen sich zu diesem riesigen Markt noch Geldwechsler hinzu, bei denen man das Tempelgeld eintauschen kann.
Der Vater begutachtet zunächst einmal die Tauben im Käfig. Sie sind am billigsten und wären für ihn, als armen Kleinbauern, durchaus angemessen. Seine Frau redet aber energisch auf ihn ein und zerrt ihn zu den Ziegenböcken. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als ein junges Zicklein zu erstehen, für das er einen stolzen Preis bezahlt. Sie sprechen nun einen der vielen, in weißes Linnen gekleideten Priester an, die sich auf den Tempelgelände aufhalten. Diese sind verantwortlich für die täglichen Riten im Tempel; in erster Linie für die Tieropfer, aber sie vergießen auch Wein als Trankopfer oder opfern Brot und Früchte als Speiseopfer.
Als Juden dürfen sie nun dem Priester mit dem Opfertier in das Zentrum des Tempels folgen. Auf dem Weg dorthin treffen sie überall auf Leviten, die Hilfsdienste leisten. Sie verbrennen Berge von Weihrauch, singen Psalmen und begleiten diese mit Trompeten, Zimbeln und Leiern. Auch sind sie für die Bewachung und Verwaltung zuständig.
Zunächst gelangt die Pilgerfamilie in den „Frauenhof“. Dieser ist Endstation für die Mutter und Töchter.
Vor dem Eingang ist eine Tafel angebracht, mit der „fürsorglichen“ Warnung: „Kein Fremder darf den Bereich innerhalb der Brüstung um den Tempel betreten. Wer erfasst wird, ist für seinen Tod selbst verantwortlich.“ (1871 wurde eine solche Tafel in Jerusalem gefunden).
Der Vater und die Söhne werden nun durch ein Tor in den „Israelitenhof“ geführt. Weiter dürfen auch sie nicht. Aber von hier aus können sie zuschauen, wie dem Tier, neben dem zentralen Opferaltar im „Priesterhof“, die Kehle aufgeschlitzt wird und das Blut in eine Schale fließt, die ein Levit als Helfer bereithält.
Als der jüngste Sohn nun sieht, wie das Zicklein zitternd niedersinkt, fängt er bitterlich zu weinen an. Es war ihm auf dem ganzen Weg nachgelaufen, weil er ihm von seinem Brot zu Fressen gab. Er hatte so sehr gehofft, er dürfe es mit nach Hause nehmen. Er verstand die Welt nicht mehr.
So viel Verwirrendes hatte sich in den letzten Wochen zugetragen. Es hatte damit angefangen, dass er mit ansehen musste, wie seine Mutter die Nachbarin beschimpfte und der Streit beider Frauen so weit eskalierte, bis sie sich schließlich ineinander verkrallt auf dem Boden wälzten. Nicht genug damit, wurde auch sein Vater von dem Ehemann der Nachbarin wüst beschimpft und wäre von ihm geschlagen worden, wenn er nicht schleunigst ins Haus gelaufen wäre und die Tür hinter sich zugeschlagen hätte. Als seine Mutter endlich blutend und zerzaust wieder ins Haus kam, ließ sie ihre ganze Wut am Vater aus und beschimpfte ihn derart, dass er aus dem Haus rannte. Danach sprach sie tagelang kein Wort mehr mit ihm.
Als er seine große Schwester, fragte wieso sich die Eltern auf einmal so schlimm mit den Nachbarn stritten und wieso Mutter auf den Vater so böse wäre, erzählte diese ihm flüsternd, dass der Vater und die Nachbarin etwas ganz Schlimmes gemacht hätten. Sie wären als Ehebrecher erwischt worden. Die Mama sei jetzt furchtbar wütend auf dem Papa und hätte von ihm verlangt, dass er mit ihnen nach Jerusalem gehen und im Tempel opfern müsse, um seine Sünde abzuwaschen. Und die Mama würde mitgehen. Sie wolle sicher sein, dass er nicht ein zu kleines Tier opfere und das restliche Geld vertrinkt.
Er versteht diese Erwachsenenwelt nicht. Die Nachbarin war doch immer freundlich zu ihm und hatte ihm öfter Leckereien zugesteckt. Keiner will ihm erklären, was Ehebruch ist. Und jetzt wird dem Zicklein der Hals durchgeschnitten, weil der Papa etwas Falsches gemacht hat. Es kann doch nichts dafür. Ihn verwirrt das alles.
Nun besprengt der Priester mit dem Blut die vier Ecken des Altares und weidet mit seinem Helfer den Kadaver aus. Die Eingeweide und das Fettgewebe werden anschließend vom nie erlöschenden Feuer des Altares verzehrt. Das Fell und einen Teil des Fleisches übergibt der Levit dem Vater; den Rest nimmt er für den Tempel an sich. Mit dem Fell bezahlen sie später ihre Herberge. Das Fleisch dürfen sie nicht mit nachhause nehmen. Es darf nur an den Ort, den der Herr erwählt hat, also nur in Jerusalem, verzehrt werden.
Der Rauch der Opfergaben steigt in einer stinkenden Rauchsäule himmelwärts. Unangenehm wird es, wenn er vom Wind über dem Tempel verteilt wird. Dann verbindet er sich mit den Gerüchen von verbranntem Weihrauch, verschiedener Kräuter sowie tausenden Litern Blut, die in einer Rinne ins Kidrontal fließen. Der Geruch setzt sich auf der Haut, in den Haaren und Kleidern fest und wird die Familie und ihre Umgebung noch einige Tage nach ihrer Heimkehr an die Pilgerfahrt erinnern.
An Gerüche gewöhnt, beeinträchtigt dies jedoch nicht die Fröhlichkeit, die der Vater nun ausstrahlt. Er hat durch das Opfer seine Schuld abgewaschen und ist vor JHWH wieder gerechtfertigt. Auch die Mutter zeigt sich wieder versöhnt, vor allem auch in Gedanken an die ausgiebige Fleischmahlzeit am Abend. Sie hat auch noch etwas Geld für Wein übrig. Heute Abend wird gefeiert. Das Leben ist wieder schön.
Das wichtigste Gebäude des Tempels war das in der Mitte gelegene, sich über alle anderen erhebende Allerheiligste. Ursprünglich, im Salomonischen Tempel, beherbergte es die sagenumwobene Bundeslade. Nach der Zerstörung durch die Babylonier verschwand diese spurlos, so dass das Allerheiligste seitdem leer blieb.
Ausschließlich der Hohepriester durfte es einmal im Jahr während des Versöhnungstages (Jom Kippur) betreten, um Sühne für das Volk Israel zu erbitten. Israels Sünden waren nur vergeben, wenn JHWH ihn für würdig erachtete. Vorsorglich wurde ihm ein Seil um die Taille gebunden, mit dem er – um eine Entweihung des Tempels zu vermeiden – herausgezogen werden konnte, falls Gott ihn als Unwürdigen erschlagen würde. Eigenartigerweise ist dies während all der Jahrhunderte nie geschehen, obwohl von einigen unwürdigen Hohenpriestern berichtet wird. JHWH scheint doch viel Geduld gehabt zu haben!
Während des Schreibens dieses Artikels kam mir der Gedanke wie es wohl im Allerheiligsten ausgesehen haben mag, wenn dort über Jahrzehnte niemand sauber machen durfte. Spinnweben dürften noch das Geringste gewesen sein.
Der Tempelkult war in Israel jedoch nicht unumstritten. Nicht nur Jesus stieß sich daran, wenn er sagt:
„Es steht geschrieben: ,Mein Haus ist ein Bethaus.‘ Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht!“ 13
Schon einzelne Propheten wie etwa Hosea, Amos, Jeremia oder Jesaia setzten sich kritisch mit der Opferpraxis auseinander. Gerechtigkeit üben, Gutes zu tun und die Schwachen zu schützen war ihnen wichtiger, als Brandopfer.
„Was soll mir die Menge eurer Opfer?“ spricht der HERR. „Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber! Blut der Farren, Lämmer und Böcke begehre ich nicht! Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer fordert solches von euren Händen, … . (…). Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele, sie sind mir zur Last geworden; … . (…). Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg, höret auf, übel zu tun. Lernet Gutes tun, erforschet das Recht, bestrafet den Gewalttätigen, schaffet den Waisen Recht, führet die Sache der Witwe!“ 14
„Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja wahrlich, auch ich sehe es so an, spricht der HERR.“ 15
Nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahre 70 n. Chr. durch die Römer und dem Ende des Opferkultes entwickelte sich die Sabbatfeier in der Synagoge zu einem Wortgottesdienst mit Priestersegen, und wurde zum zentralen Kult der Gemeinde. Teile hieraus übernahm das spätere Christentum in dessen Messfeier.
Gottesherrschaft JHWH's
Herrscher über Israel waren nicht der König oder der Hohepriester. Der eigentliche Herrscher war JHWH. Josephus Flavius benennt daher die Staatsform Israels als „Theokratie“ – Gottesherrschaft.
Zwar stellte man sich JHWH als ein im Himmel wohnendes, nicht ortsgebundenes Geistwesen vor. Da die Menschen sich aber mit Geistwesen schwer tun – sie brauchen etwas Greifbares – , bauten sie ihm in der Zeit des Nomadentums die sogenannte „Bundeslade", in der er seine irdische Dependance hatte und überall mitgenommen werden konnte. Vergleichbar auch mit der Monstranz und dem Tabernakel in katholischen Kirchen.
Nach der Eroberung Jerusalems durch König David um 1000 v. Chr. wurde diese Lade in das dortige zentrale Heiligtum überführt und im späteren salomonischen Tempel aufbewahrt. Der Tempel, und in ihm das Allerheiligste, war daher das religiöse, politische und kulturelle Zentrum Israels.
Von hier aus strömte der Segen JHWH's wie von einer Quelle über Israel und die umgebenden Völker. Dies galt aber nur, wenn die Bewohner Recht und Gesetz befolgten. Sonst wurde er zum Ort des Gerichtes und der Vergeltung über sie.
Sicher haben Sie schon einmal den Begriff „Zion" gehört! Zion ist ein Synonym für den Ort, an dem JHWH seinen Thron hat. Bei den Propheten wird Zion als der Sitz der königlichen Macht des Messias auf dieser Erde gesehen. Als himmlisches Jerusalem ist es der Mittelpunkt des künftigen allumfassenden Reiches Gottes. In der Vorstellung der Gläubigen war daher das Allerheiligste und mit ihm Jerusalem das Zentrum der Welt.
Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen, und des HERRN Wort von Jerusalem. 16 Und der HERR wird über die ganze Erde König werden. An jenem Tage wird nur ein HERR sein und sein Name nur einer. 17
Im Unterschied zum Christentum, das Gott in erster Linie als den liebenden Vater sieht, wie es auch Jesus vorlebte, wird JHWH vorrangig als der Gerechte gesehen, der mit Belohnung oder Strafe für die Einhaltung seiner Gesetze sorgt.
Während das Christentum dem Gläubigen Belohnung oder Strafe nach dem Tode durch Himmel, Hölle oder Fegefeuer in Aussicht stellt, wird in den jüdischen Schriften Gerechtigkeit meistens im Hier und Jetzt angestrebt. Vielleicht deswegen, weil das Judentum lange Zeit keine oder nur nebulöse Vorstellungen von einem Weiterleben nach dem Tode hatte.
Vorbildlich für die damalige Zeit und richtungsweisend für die moderne Gesetzgebung, war das jüdische Menschenbild. Ausgehend von der Vorstellung eines einzigen Gottes, einer allerhöchsten Macht, ergab sich das Prinzip der Gleichheit aller Menschen. Hierauf baut die ganze biblische Gesetzgebung auf wie die Gebote der Nächstenliebe – Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; denn ich bin der HERR 18 (gilt allerdings nur für die Angehörigen des eigenen Volkes) –, Rechte für die Sklaven, die Pflicht zur Unterstützung der Armen, der Schutz der Tiere –, Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden 19.
In jedem 50. Jahr wurde ein Erlass- oder Jubeljahr ausgerufen, in dem alle Schulden erlassen, Erbland zurückgegeben und Menschen in Schuldsklaverei freigelassen werden sollten.
Natürlich wurde wie überall, auch in Israel gegen diese Gesetze verstoßen. Schon die Propheten waren bekannt für ihre wütenden Tiraden über das Unrecht der Mächtigen den Machtlosen gegenüber.
Wenn es auch manchmal wenig nützte, so konnten Letztere sich doch auf die Schrift berufen.
Aber wir dürfen uns auch nicht dazu verleiten lassen, das alte Israel zu idealisieren. Es gab auch die düstere Seite der Gerechtigkeit, nach der beispielsweise Ehebrecher (sowohl Männer als auch Frauen), Gotteslästerer, Götzendiener oder ungeratene Söhne gesteinigt werden sollten.
So sollen ihn (den ungeratenen Sohn, der Autor) steinigen alle Leute der Stadt, dass er sterbe... . 20
Allerdings waren die Sitten zur Zeit Jesu nicht mehr so rigoros. Die Steinigung als Todesstrafe wurde durch die Römer zumindest zeitweise unterbunden. Die damalige Rechtslage ist jedoch unklar und umstritten. Es gab jedoch die Steinigung sicher noch als eine Form von spontaner Lynchjustiz wie beispielsweise die Steinigung des Stephanus.
Die meisten der über 600 Gesetze oder Weisungen gehen auf das 5. Buch Mose zurück. Viele davon sind Vorschriften über das Verhalten am Sabbat, Zubereitung koscherer Nahrung und Reinhaltung des Körpers.
Aber JHWH ist nicht nur ein Gott der Gerechtigkeit, er liebt auch sein Volk und darüber hinaus alle Menschen und will geliebt werden:
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. 21
Wie konnte das Volk aber nun den Willen JHWH' s erfahren?
Tempelpriesterschaft
Dafür war die Tempelpriesterschaft und an deren Spitze der Hohepriester zuständig. Diese waren Mittler zwischen dem Volk und JHWH.
Diese privilegierte Stellung brachte ihnen bzw. dem Tempel immense Einnahmen wie die Tempelsteuer, die jeder Jude in Palästina und sogar im gesamten römischen Reich jährlich bezahlen musste. Dazu kam der Anteil an den Geschäften, die mit den Pilgern gemacht wurden. Der Tempelschatz war legendär und weckte natürlich Begehrlichkeiten der Feinde. So wurde er im Jahre 70 n. Chr., bei der Zerstörung Jerusalems, von den Römern geraubt und im Triumphzug durch Rom getragen.
Natürlich wurden diese Privilegien von der Priesterschaft mit allen Mitteln verteidigt. Wie wir noch sehen werden, hatte nicht zuletzt die Verurteilung Jesu damit zu tun.
Der Hohepriester hatte in Fragen der Religion und des Kultes die oberste Entscheidungsbefugnis. Seine hohe Stellung drückte sich auch in seiner Kleidung aus. An hohen Festtagen trug er eine besondere Amtskleidung, die schon im 2. Buch Mose (Kapitel 28 und 39) beschrieben ist.
Über einem weißen Leinengewand trug er ein ärmelloses, hyazintblaues Obergewand. An dessen unterem Saum hingen ringsum abwechselnd goldene Glöckchen und Granatäpfel. Sein Ephod, eine Art Schürze, war eine kostbare Stickarbeit aus feinem Leinen, purpurrot gefärbter Wolle und Goldfäden. Das prachtvolle Brustschild, das ähnlich gefertigt war wie das Ephod, schmückten zwölf in Gold gefasste Edelsteine, in denen die Namen der Stämme Israels eingraviert waren. Auf der Vorderseite seines hohen Turbans war ein glänzendes Stirnblatt aus purem Gold befestigt in dem der unaussprechliche Name JHWH's eingraviert war. An dem feierlichen Klang der Glöckchen hörten die Menschen, wenn der Hohepriester durch die Menge zum Heiligtum schritt.
Offenbar fürchteten die Römer die psychologische Wirkung dieses Gewandes auf die Massen, denn sie bewahrten es in der nahen Burg Antonia auf und gaben es nur jeweils zu den Festtagen heraus.
War das Amt des Hohen Priesters in früheren Zeiten erblich, wurde diese Tradition durch die Römer durchbrochen. Sie beriefen oder setzten diesen ab, nach eigenem Ermessen. Diese Praxis zwang den Hohen Priester und mit ihm die Tempelpriesterschaft zur Kollaboration mit den Römern.
Religiöse Gruppierungen und deren Vorstellungen
Zwar sahen alle Juden JHWH als den alleinigen Gott Israels an. Innerhalb dieses allgemeinen Konsens gab es jedoch viele verschiedene Sekten. Als die Bedeutendsten nennt Josephus Flavius die Sadduzäer, Pharisäer und Essener.
Die Sadduzäer gehörten zur reichen Oberschicht. Aus alten adeligen Priesterfamilien stammend, beherrschten sie den Tempelkult. Aus ihren Reihen stammte auch der jeweils amtierende Hohepriester.
Josephus schreibt über ihre Weltanschauung: „Gott, so behaupten sie, habe gar nichts zu tun mit bösem Handeln, ja es interessiere ihn überhaupt nicht, vielmehr sei es dem Menschen anheimgegeben, das Gute oder das Schlechte zu wählen… . Ein Fortleben der Seele, ferner Belohnung und Strafe im Hades verwerfen sie, … . Im Verkehr mit ihren eigenen Leuten geben sie sich ablehnend wie Fremden gegenüber." 22
Die Sadduzäer waren gegenüber der griechisch–römischen Kultur sehr aufgeschlossen, gingen ins Theater und waren den Römern gegenüber eher freundlich gesonnen. Dies machte sie bei romfeindlichen religiösen Gruppierungen nicht gerade beliebt.
Nach der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 n. Chr. verlor sich die Partei der Sadduzäer.
Die größte Gruppierung – entstanden etwa 135 v. Chr. – waren die Pharisäer. Sie waren eine vom Volk sehr geschätzte Laienbewegung, die sich besonders dafür einsetzte, dass die Gesetze, wie sie in den Büchern Mose stehen, genau eingehalten wurden. Durch ihre Gottesfurcht und die Ernsthaftigkeit, mit dem sie ihren Glauben lebten, waren sie beim Volk sehr angesehen. Durch ihre absolute Fokussierung auf die mosaischen Gesetze und deren Auslegung sorgten sie allerdings dafür, dass diese immer komplizierter wurden und die Menschen mit ihren Alltagsproblemen noch zusätzlich belasteten. Wobei es natürlich wie so oft unterschiedliche Gruppierungen gab. Manche gingen mit ihrer Auslegung auf die Menschen zu wie etwa Jesus, um die Erfüllung der Vorschriften erträglicher zu machen, während andere auf der buchstabengetreuen Einhaltung beharrten.
Jesus kritisierte diese daher: „Sie binden aber schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf den Hals; aber sie selbst wollen dieselben nicht mit einem Finger regen.“ 23
Er benannte sie auch als Heuchler, da sie ihre Frömmigkeit gern zur Schau stellten. Allerdings müssen wir hier ein Fragezeichen setzen, da die Christen zur Zeit der Abfassung des Matthäusevangeliums in starker Konkurrenz zu den Juden standen und der Evangelist diese Passagen, als seine eigene Ansicht, Jesus in den Mund gelegt haben könnte.
Sollte Jesus aber mit den Pharisäern Probleme gehabt haben, bedeutet dies keineswegs eine pauschale Ablehnung derselben. Er war als Rabbi, wie er in den Evangelien des Öfteren angesprochen wird, vermutlich selbst ein Pharisäer. Aus deren Reihen gingen nämlich die Rabbiner hervor.
Über ihre Weltanschauung schreibt Josephus: „Für sie ist alles dem Schicksal und Gott anheimgestellt. Wohl stehe es in erster Linie den Menschen zu, Recht- und Unrechttun zu wählen, doch bei jeglichem Tun sei auch das Schicksal beteiligt. Es seien zwar alle Seelen unsterblich, aber nur die Seelen der Guten fänden Eingang in einen anderen Körper, während die der Schlechten ewiger Verdammnis ausgeliefert seien.“ 24
Die kleinste Gruppe war Josephus offensichtlich am meisten sympathisch. Er beschreibt sehr ausführlich deren Sitten und Gebräuche über mehrere Seiten. Es sind die Essener.
Hier einige Ausschnitte aus seiner Charakterisierung:
Sie bemühen sich um eine besondere Selbstheiligung und lehnen jede sinnliche Lust als Sünde ab, während sie die Enthaltsamkeit und den Widerstand gegen die Begierden als Tugend erachten. Über die Ehe urteilen sie abträglich … lehnen sie … wohl nicht gemeinhin ab, doch sie verschanzen sich gegen die Lüsternheit der Frauen. Den Reichtum verachten sie, und ihr Gefühl für Gemeinschaft ist bewundernswert. Niemand besitzt mehr als die anderen, da sie ihr Hab und Gut an die Gemeinschaft übertragen. Sie konzentrieren sich nicht auf eine einzelne Stadt, sondern sind in großer Anzahl auf alle Städte verteilt. Ihre – bevorzugt weiße – Kleidung ist wie die eines Knaben und auch ihre Körperhaltung ist so, als hätten sie Angst vor einem Erzieher. Untereinander kaufen sie und verkaufen nichts. Wer etwas braucht, bekommt es – auch wenn er auf Reisen ist – von den anderen Gemeindemitgliedern. Weder Geschrei noch sonstwelcher Lärm stört je die Weihe des Hauses. Vor und nach der Mahlzeit preisen sie Gott als Spender der Lebensnahrung. Den Zorn halten sie unter Kontrolle, Gefühlswallungen zwingen sie nieder, Zuverlässigkeit gilt Ihnen viel, für den Frieden tun sie alles. Jedes Wort das sie sprechen, ist verlässlicher als ein Eid. Zu schwören weigern sie sich.
Wie alle Juden legen sie viel Wert auf körperliche und kultische Reinheit, indem sie sich zum Beispiel vor jeder Mahlzeit waschen. Sogar wenn ein Höhergestellter Berührung mit einem Nachgeordneten hatte, muss er sich wieder reinigen.
Sie erforschen die medizinischen Eigenschaften von Kräutern und Mineralien und weigern sich mehr als andere Juden am Sabbat irgendeine Arbeit anzurühren. Im Krieg gegen die Römer widerstanden sie den Folterungen sogar mit einem Lächeln. Es gibt unter ihnen auch welche, die die Zukunft voraussagen und es geschieht selten, dass sie dabei irren.
Die meisten werden über 100 Jahre alt, da sie ein einfaches und wohlgeordnetes Leben führen.“ 25 An anderer Stelle schreibt er: „Von den Seelen glauben sie, dass sie aus dem feinsten Äther hervorgegangen, sich zusammenfügten und durch irgendeinen natürlichen Vorgang der Anlockung herabgeholt worden seien. Und wenn sie dann von den Fesseln des Fleisches befreit würden, dann fühlten sie sich wie aus langer Haft entlassen und erhöben sich in seliger Freude wieder nach oben. … dass auf die guten Seelen jenseits des Ozeans ein Leben warte und ein Ort ohne die Unannehmlichkeit von Schnee, Regen und Hitze, wo vielmehr vom Ozean her unablässig ein sanfter Zephyr weht, um seine kühlende Wirkung zu tun. Auf die Schlechten harrt nach ihrer Meinung eine finstere, eiskalte Höhle, der Ort ewiger Strafe. (…). Das also ist die essenische Theologie der Seele, und wer einmal von ihrer Weisheit kostet, an dem haftet diese wie ein Köder, von dem er sich nicht mehr befreien kann.“ 26
„Wenn Sie Weihegeschenke in den Tempel bringen, bringen sie kein Opfer dar, weil sie heiligere Reinigungsmittel zu besitzen vorgegeben. Aus diesem Grunde ist ihnen der Zutritt zum gemeinsamen Heiligtum nicht gestattet, und sie verrichten demgemäß ihren Gottesdienst besonders." 28
Es gab auch noch eine andere Gruppe von Essenern, die in Lebensart, Sitte und Gesetzgebung mit der ersteren übereinstimmte, jedoch heiraten und ein Familienleben führen durfte. 27
Zwischen 1947 und 1956 wurden in Felshöhlen nahe der Ruinenstätte Qumram eine große Anzahl von Schriftrollen aus dem antiken Judentum entdeckt, die zwischen 250 v. Chr. und 40 n. Chr. gefertigt wurden. Soweit sie noch intakt sind, geben sie größtenteils Texte der jüdischen Schriften wieder. Eine Textgruppe betrifft Regeln und Organisation, Lehre und Alltagsleben einer jüdischen Gemeinschaft, darunter ein sogenannter Sektenkanon, ein Regelbuch, eine Kriegsrolle, Verträge und Aufzeichnungen über Geschäfte. Ferner gehören gottesdienstliche Texte in diese Gruppe.
Man nahm lange an, Qumram, das 70 n. Chr. von den Römern zerstört wurde, wäre ein Zentrum der Essener gewesen und diese Texte würden von ihnen stammen. Neuerdings kamen an dieser Theorie jedoch Zweifel auf, da viele Artefakte der Ausgrabungen von Qumram nicht zu der essenischen Lebensweise passen. Allein die Schriftrollen seien von etwa 500 verschiedenen Schreibern gefertigt worden. Hierfür gab es aber nicht genug Wohnunterkünfte. Auch wurden keine Materialien, die zur Herstellung der Schriftrollen benötigt gewesen wären, gefunden.
In keiner der etwa 970 Schriften fand man Hinweise auf Esseni oder Essaioi oder Begriffe, die sich von einem dieser Wortstämme ableiten lassen. Für Askese und Zölibat fanden sich dort ebensowenig Belege wie für einen Unsterblichkeitsglauben.
Gegen die Annahme eines Essenerklosters spricht auch die Lage Qumrams zur damaligen Zeit. Es war keine abgelegene Siedlung, wie sie die Essener bevorzugten, sondern lag an einem belebten Verkehrsknotenpunkt und war wirtschaftlich mit benachbarten Orten verbunden.
Viele Historiker sind daher mittlerweile der Meinung, die Schriften hätten unter anderem aus der Tempelbibliothek von Jerusalem gestammt und seien im Jahre 70 n. Chr. vor den Römern in Sicherheit gebracht worden.
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Zustände
Das wirtschaftliche Rückgrat Israels war jahrhundertelang von kleinbäuerlicher Landwirtschaft und Fischerei bestimmt. Nach der Eroberung Jerusalems durch die Römer im Jahre 63 v. Chr. verschlechterte sich aber deren Lage. Sie mussten nun zusätzlich zum Zehnten an die Tempelpriesterschaft auch noch Steuern an den römischen Kaiser bezahlen. Dies konnte, vor allem in Zeiten schlechter Ernten, die Ablieferung bis zur Hälfte des Ertrages bedeuten. Viele Bauern mussten sich bei den Großgrundbesitzern oder der Priesterschaft verschulden. Aufgrund eines Verbotes in der Schrift durften Juden zwar von Ihresgleichen keine Zinsen nehmen; war der Schuldner jedoch in Verzug, wurden kräftige Strafzahlungen erhoben, die die fehlenden Zinsen bei weitem aufwogen. So fiel sein Land oft an den Gläubiger, der es seinerseits von Verwaltern und Tagelöhnern bearbeiten ließ.
(Von den Fremden magst du Zinsen nehmen, aber nicht von deinem Bruder… . 29).
War der ehemals selbstständige Landwirt noch zusätzlich einem Beruf nachgegangen, hatte er durch die rege Bautätigkeit, die mit den Römern und vor allem mit Herodes einsetzte, die Möglichkeit, seine Existenz und die seiner Familie zu sichern. Andernfalls blieb ihm nur der Gang in die Armut als Tagelöhner. Nach Herodes' Tod kam jedoch die Bautätigkeit zum Erliegen, so dass auch diese Erwerbsmöglichkeiten verloren gingen. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis die Not dieser Unzufriedenen und Leidenden in einen Aufstand münden würde.
Herodes konnte das Volk bis zu seinem Tode 4 v. Chr. durch seine konsequent despotische Politik klein halten. Was aber war mit seinen Nachfolgern? Konnten sie den Druck in diesem brodelnden Kessel niederhalten?
Schon kurze Zeit nach der Eroberung Jerusalems durch die Römer (63 v. Chr.) bildeten sich nationalistische Widerstandsbewegungen gegen die römische Besatzungsmacht. Für das Volk waren diese Banden aus religiösen Eiferern, Bauern und Tagelöhnern Werkzeuge der göttlichen Gerechtigkeit gegenüber den Eroberern und deren jüdischen Kollaborateuren.
In seiner Not und Abscheu gegen die Fremdherrschaft klammerte sich das Volk an die Weissagungen der Schrift, die einen Messias vorhersagte, der das Reich Gottes errichten würde, in dem alle Feinde vernichtet und alle Not behoben wäre. Ein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens. Auch wurde die Erinnerung an vergangene machtvolle Könige wie David beschworen, die die Feinde der Nation in die Flucht geschlagen hatten.
Diese Vorstellungen spukten in den Köpfen der Aufständischen. Sie verkündeten ihren jeweiligen Anführer als König Israels oder Messias, der das Gottesreich auf Erden wiederherstellen würde. Dies war jedoch gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung an Rom.
Unter einem von ihnen, dem charismatischen Anführer Hiskia, der sich als Messias ausrufen ließ, sammelten sich sowohl die in der Gesellschaft zu kurz gekommenen, als auch Söhne reicher Familien aus Jerusalem. Sie entfachten von Galiläa aus einen Guerillakrieg, überfielen römische Einrichtungen und raubten die Reichen aus. Aber der junge Herodes – erst etwa 15 Jahre alt – bekämpfte sie erfolgreich und ließ Hiskia und seine überlebenden Anhänger hinrichten. Fortan war unter seiner Herrschaft an Aufstand nicht mehr zu denken.
Als nun die Frage der Nachfolge nach Herodes' Tod anstand, teilte Kaiser Augustus das Herrschaftsgebiet unter dessen drei Söhnen auf: Judäa, Samaria und Idumäa wurden Archelaos übertragen. Herodes Antipas erhielt Galiläa und Peräa, während Philippos Gaulanitis (heutige Golanhöhen) und die Gebiete nordöstlich des Sees Genezareth regierte. Den Königstitel erhielten sie jedoch nicht. Herodes Antipas und Philippos wurden Tetrarchen (Herrscher eines Viertels); Archelaos wurde Ethnarch (Herrscher eines Volkes).
Diese Aufteilung erwies sich als ein katastrophaler Fehler der römischen Besatzungsmacht. Religiös motivierter Hass auf die „gottlosen“ Unterdrücker und deren jüdische Handlanger sowie Verbitterung über die eigene aussichtslose wirtschaftliche Lage, während die weltliche Oberschicht wie auch die Tempelpriesterschaft ein Leben in Luxus führte, mündete nun in eine Flut von Aufständen und gewaltsamen Protesten.
Zunächst gab sich Archelaos als neuer Herrscher in Jerusalem milde und leutselig und wurde daher vom Volk nach der harten Herrschaft des Herodes begeistert begrüßt. Sofort wurden Wünsche an ihn herangetragen wie Abschaffung von Steuern, Freilassung von Gefangenen und Bestrafung von Günstlingen des Herodes. Als Archelaos sie in dem Glauben ließ, ihre Forderungen würden erfüllt, sie jedoch auf später vertröstete, kam derartiger Unmut gegen ihn auf, dass er mit einem Aufstand rechnen musste. Er schickte daher eine Abteilung Soldaten in den Tempel.
„Gegen diese Soldaten aber hetzten die am Aufruhr beteiligten Gesetzeslehrer das Volk durch lärmende Zurufe auf, so dass es schließlich zum förmlichen Angriff des Volkes auf die Kriegsleute kam, die umzingelt und größtenteils mit Steinen zu Tode geworfen wurden, … . " 30
Archelaos bot nun seine ganze Streitmacht auf, diesen Aufstand niederzuwerfen. „Auf diese Weise wurden gegen 3000 der Empörer von der Reiterei zusammengehauen, während der Rest sich auf die nahe gelegenen Berge zurückzog." 31
In der Folgezeit wurde Archelaos durch seinen launischen und grausamen Regierungsstil immer verhasster, so dass ihn Juden und Samaritaner deswegen bei Kaiser Augustus verklagten. Er wurde daraufhin seines Amtes enthoben und nach Gallien verbannt. Römische Präfekten verwalteten danach sein Herrschaftsgebiet. Zwanzig Jahre später hieß der amtierende Präfekt Pontius Pilatus.
Während Archelaos sich in Rom vor Augustus verteidigte, vertrat ihn der Römer Sabinus in Jerusalem. Seine Habsucht und das momentane Machtvakuum waren der Auslöser für den Aufstand einer ungeheuren Menschenmenge aus Judäa, Galiläa, Idumäa, Jericho und Peräa, wie Josephus schreibt. Sie kesselten zunächst die römischen Soldaten in Jerusalem ein, wonach diese zurückschlugen und Teile des Tempels, in dem sich die Aufständischen verschanzt hatten, in Brand setzten. Für die Soldaten war dies eine günstige Gelegenheit, den Tempelschatz zu plündern, was die Erbitterung des Volkes auf den Höhepunkt trieb.
Als die Aufständischen daraufhin den Königspalast belagerten, in dem sich Sabinus verschanzt hielt, sandte dieser Hilferufe an Varus, den Präfekten Syriens – derselbe, der in der Schlacht im Teutoburger Wald 9 n. Chr. mit seinen Legionen sein Ende gefunden hat.
„Zur nämlichen Zeit“ schreibt Josephus, „loderte an zahlreichen anderen Plätzen des Landes das Feuer des Aufstands empor, und die allgemeine Situation gab vielen Anlass, nach der Königskrone zu greifen.“ 32
In Idumäa meuterten zweitausend ehemalige Soldaten des Herodes. In Sepphoris, der Hauptstadt Galiläas, scharte Judas der Galiläer, vermutlich ein Sohn des Hiskia – der seinerseits als Messias umhergezogen war und schließlich Herodes erlag – eine ansehnliche Menge um sich. Sie bewaffneten sich, indem sie das Waffenmagazin der Stadt plünderten. Sie stellten eine neue religiöse Gruppierung dar, die Josephus die vierte Philosophie nennt, die Zeloten. Religiöse Eiferer, die den Zorn JHWH's über Israel abwenden mussten, indem sie das Land von Römern und verräterischen Juden – als solchen sahen sie auch den Hohenpriester an – säuberten. Vor allem wandten sie sich gegen die Steuerschätzung, die Quirinius 6 n. Chr. angeordnet hatte – bekannt aus der Kindheitsgeschichte Jesu. In den Augen des Judas dem Galiläer, der sich auch als Messias sah, war es schändlich, an Rom Tribut zu entrichten, da dies den Eindruck vermittelte, das Land gehöre Rom und nicht JHWH.
Simon, ein Sklave aus Peräa zog mit seinen Leuten brandschatzend und plündernd durch das Land. Sie raubten den Königspalast in Jericho und andere Prachtgebäude aus und ließen sie in Flammen aufgehen. Der Hirte Athrongaios ließ sich von seinen Leuten zum König krönen und überfiel mit seinen vier Brüdern, die er jeweils zu Anführern einer bewaffneten Schar machte, vor allem Römer. Aber auch Juden wurden ausgeraubt, wenn es sich lohnte.
War zunächst wirtschaftliche Not und religiöser Fanatismus der Auslöser zur Bildung einer Widerstandsgruppe, wandelte sich diese oft in eine ganz normale Räuberbande, der es nur noch um eigene Bereicherung ging. „So war Judäa eine wahre Räuberhöhle, und wo sich nur immer eine Schar von Aufrührern zusammentat, wählten sie gleich Könige, die dem Staate sehr verderblich wurden. Denn während sie den Römern nur unbedeutenden Schaden zufügten, wüteten sie gegen ihre eigenen Landsleute weit und breit mit Mord und Totschlag." 33
Nachdem Varus den Hilferuf des eingeschlossenen Sabinus erhalten hatte, walzte er mit seinem Heer, von Galiläa her, die Aufstände nieder und ließ Städte und Orte, die sich daran beteiligt hatten, in Flammen aufgehen. Sepphoris traf es besonders hart. Es wurde niedergebrannt, die männliche Einwohnerschaft umgebracht und alle anderen in die Sklaverei verkauft. Tausende von Aufrührern wurden ans Kreuz genagelt oder auf andere Weise getötet.
Beim Erscheinen seiner Streitmacht vor Jerusalem suchten die Aufständischen schleunigst das Weite. Jerusalem entging einer harten Bestrafung, da die Bewohner ihre Treue zu Rom beschworen und die Schuld des Aufstandes den Pilgern von auswärts zuschoben.
In dieser Zeit des hasserfüllten Fanatismus und der brutalen Unterdrückung wird in dem kleinen Dorf Nazareth in Galiläa, nahe dem unglücklichen Sepphoris, unbemerkt von den Großen der Welt, ein Kind geboren, das einmal Weltgeschichte schreiben würde – genannt Jeschua bar Josef, aber auch Jeschua bar Myriam oder einfach der Nazoräer.
Ich werde später noch erläutern, wieso er nicht in Bethlehem geboren wurde, wie es in den Evangelien geschrieben steht.
Als Kind wird er mit seiner Familie am Abend schaudernd den rot gefärbten Himmel über dem brennenden Sepphoris betrachtet haben, in banger Erwartung von Vergeltungsaktionen römischer Soldaten auch in seinem Dorf. Aus den Evangelien ist hierüber nichts zu entnehmen, obwohl es auch in Nazareth einige gegeben haben dürfte, die sich den Aufständen angeschlossen hatten. Vielleicht sympathisierte auch sein Vater Josef mit ihnen. Wir werden es nie wissen.
Nachdem nun Varus die „Pax Romana“ – Friede durch gewaltsame Unterdrückung – wiederhergestellt hatte, folgte bis etwa 40 n. Chr. eine längere Phase äußerer politischer Stabilität, in die auch das Leben Jesu fällt. Im Inneren gärte es jedoch nach wie vor, bis hin zum ultimativen Vulkanausbruch im Jahre 66 n. Chr.
Zunächst folgte aber eine Zeit des Wiederaufbaus, in der Herodes Antipas Sepphoris als „Schmuckstück Galiläas“ wieder errichten ließ. Es liegt nahe anzunehmen, dass auch Jesus mit seinem Vater dort als Bauhandwerker gearbeitet hat.
Nachdem sich mehrere römische Statthalter verschlissen hatten, kam im Jahre 26 n. Chr. der uns bekannte Pontius Pilatus als Präfekt nach Jerusalem. Er regierte bis 36 n. Chr. über Judäa und Samaria. Römische Historiker beschreiben ihn als kaltherzig, grausam und streng, ohne Respekt vor den religiösen Empfindlichkeiten der Juden. So brachte er einen Satz vergoldeter römischer Schilde, die dem Tiberius geweiht waren, als Opfergabe für die römischen Götter im Jerusalemer Tempel an. Für die Juden ein ungeheuerlicher Akt der Blasphemie. Als er dann noch einen Teil des Tempelschatzes für die Erneuerung der Wasserleitung verwendete – eigentlich eine vernünftige Idee, da die Wasserversorgung Jerusalems in einem miserablen Zustand war –, kam es zu gewaltsamen Protesten. Diese ließ er jedoch durch seine Soldaten kurzerhand niedermachen.
Bei der Amtseinführung des Pilatus hatte Kaiphas bereits acht Jahre das Amt des Hohenpriesters inne und behielt es bis zum Jahre 36. Er war der Schwiegersohn des früheren Hohenpriesters Annas, der auch nach und nach fünf seiner eigenen Söhne in diese Position brachte.
Für Pilatus als weltlicher Herrscher und für Kaiphas als religiöses Oberhaupt hatte die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oberste Priorität. Ersterer war für den reibungslosen Fluss der Tributgelder an Rom verantwortlich. Zudem residierte er in dem herrlichen, ehemaligen Königspalast des Herodes. Diese komfortable Bleibe wollte er so schnell nicht aufgeben. Letzterer musste den ungestörten Ablauf des Tempelkultes garantieren, von dessen Einnahmen ihm ein nicht geringer Teil zufloss.
Beide arbeiteten daher Hand in Hand und schafften es, wie vordem Herodes, wo immer sich ein Aufruhr anbahnte, diesen im Keim zu ersticken.
Die rebellische Einstellung des jüdischen Volkes zu ihren Besatzern mündete jedoch nach der Absetzung des Pilatus, bis zur endgültigen Zerstörung Jerusalems im Jahre 70, immer wieder in für beide Seiten verlustreiche Aufstände. Der erbitterte Todesmut der Rebellen wurde genährt durch einen sich immer mehr verdichtenden Glauben an das baldige Kommen des Messias und das Aufrichten des Reiches Gottes in nächster Zukunft.
So gab sich Theudas, ein wunderwirkender Prophet, im Jahre 44 vor seinen Anhängern als Messias aus und wollte die Römer aus dem Land werfen. Diese machten kurzen Prozess. Sie schickten Soldaten, die seine Anhänger in die Wüste trieben und ihn selbst köpften.
Zwei Jahre später wurden zwei Söhne des Judas dem Galiläer gekreuzigt, weil sie eine revolutionäre Bewegung ins Leben rufen wollten.
Die Unruhe im Land wurde befördert durch eine Reihe unfähiger und korrupter römischer Präfekten, die kein Gespür für die Befindlichkeiten des Volkes hatten. So postierte der Statthalter Cumanus während des Pessachfestes römische Soldaten auf den Umfassungsmauern des Tempels um Unruhen vorzubeugen. Einem der Soldaten war etwas langweilig und so kam er auf die glorreiche Idee, den Erregungspegel der Gläubigen auszutesten. Er lüpfte „… seinen Mantel, bückte sich, wandte in unanständiger Weise den Juden das Gesäß zu und gab einen Laut von sich, der dieser Geste entsprach.“ 34
Die Menschenmenge kochte vor Wut, so dass Cumanus Soldaten aufmarschieren ließ, um die darauf folgenden Unruhen einzudämmen. Daraufhin kam es zu einer Panik, bei der nach Josephus 30.000 Menschen erdrückt oder zu Tode getrampelt wurden. Obwohl Josephus mit Opferzahlen oft übertreibt, war das Fest sicher zum Anlass großer Trauer geworden.
Kurze Zeit später zerriss ein römischer Soldat bei einer Verhaftungsaktion eine Tora-Rolle und warf sie ins Feuer. „Die Juden waren darüber so entsetzt, als wäre ihr ganzes Land ein Raub der Flammen, und ergriffen von ihren religiösen Gefühlen wie von einer automatisch wirkenden Kraft, eilten sie … zu Cumanus…“ 35 und forderten die Bestrafung des Frevlers. Cumanus ließ den Soldaten daraufhin exekutieren, um das Volk zu beruhigen.
Als eine Gruppe jüdischer Jerusalempilger in Samarien überfallen und viele von ihnen getötet wurden, forderten die Juden von Cumanus, die Samaritaner zu bestrafen. Dieser blieb jedoch tatenlos, so dass sich das Gerücht bildete, er hätte sich von Letzteren bestechen lassen. Unter Eleasar, einem Räuber, nahm die rachedurstige Menge daraufhin das Gesetz in die eigene Hand und zog mordend und brandschatzend durch Samarien, bis sie von römischen Soldaten gestoppt wurde. In der Folge wurde Cumanus wegen Unfähigkeit ins Exil geschickt.
Antonius Felix, der ihm im Jahre 52 nachfolgte, war allerdings nicht fähiger. In der Zeit seiner Statthalterschaft bildete sich eine im Untergrund agierende Gruppe, die sich nach ihrer Waffe – kleinen leicht zu verbergenden Dolchen (lateinisch: sicae) – Sikarier nannten. In ihrer fanatischen, apokalyptischen Weltsicht wollten sie dem Reich Gottes den Weg bereiten, indem sie dessen – vermeintliche – Feinde umbrachten. Sie ermordeten ihre Opfer sogar am helllichten Tag mitten in einer Menschenmenge.
Besonders sahen sie es auf die reiche Priesteraristokratie ab, die mit den Römern gemeinsame Sache machte. So gelang es sogar einem von ihnen, den Hohen Priester Jonathan im Gedränge im Tempel niederzustechen und unerkannt zu entkommen. Gerüchten zufolge soll Felix diesen Mord in Auftrag gegeben haben.
Josephus schreibt hierüber: „Wer sich weiterhin der römischen Herrschaft fügen wollte, wurde mit dem Tode bedroht … . Rottenweise verstreuten sie sich über das Land, plünderten die Behausungen der einflussreichen Persönlichkeiten, brachten diese selbst um und legten die Ortschaften in Schutt und Asche, so dass ganz Judäa ein Opfer ihres Wahnwitzes wurde."36
So wie die Priesterschaft ihre Ämter an die Söhne weitergab, vererbten die Aufrührer ihre führende Stellung manchmal ebenfalls. So war Manaim, der Anführer der Sikarier, ein Enkel von Judas dem Galiläer.
Kommt Ihnen das geschilderte Szenario irgendwie bekannt vor? Die Geschichte scheint sich in unseren Tagen zu wiederholen, wenn wir an die Gotteskrieger der Al Qaida und des IS denken.
Die Unruhen in Judäa und Galiläa ließen sich immer weniger unter Kontrolle bekommen. Immer öfters tauchte ein neuer Messias auf wie beispielsweise „Der Ägypter“, der Tausende von Anhängern um sich scharte, um vom Ölberg aus wie einstmals Josua in Jericho, die Mauern Jerusalems zu Fall zu bringen. Seine Gefolgschaft wurde von römischen Soldaten niedergemacht; er selbst entkam.
Die korrupten Nachfolger des Präfekten Felix, der daraufhin abberufen worden war, erbitterten das Volk noch mehr. Dazu kam die erdrückende Armut, Ungerechtigkeit, Dürren und Hungersnöte, die viele auf einen gewaltsamen Umsturz durch den immer noch ausstehenden Messias hoffen ließen.
Im Mai des Jahres 66 legte der römische Statthalter Florus selbst Feuer an die Lunte, die das gefüllte Pulverfass der Revolution explodieren ließ.
Josephus ist der Meinung, Florus hätte die Juden absichtlich in den Krieg getrieben, um von seinem eigenen Fehlverhalten abzulenken. So schreibt er: „Florus allerdings stachelte die Leute zum Krieg auf, als habe man ihn dafür angestellt.
So streckte er seine Hand nach dem Tempelschatz aus, aus dem er sich 17 Talente nahm mit der Begründung, dass der Kaiser sie benötige." 37 Ein Talent entsprach 6.000 römischen Denaren oder dem Wert eines normalen Segelschiffes.
Der Tumult, der daraufhin losbrach, wurde von den Soldaten des Florus brutal niedergeschlagen, indem sie sogar in die Häuser eindrangen, diese ausraubten und Männer Frauen und Kinder niedermetzelten.
Die Vornehmen, führende Pharisäer und der Hohepriester taten nun ihr Äußerstes. Sie stellten sich mit zerrissenen Kleidern und Asche auf dem Haupt vor das erbitterte Volk und beschworen die Menge, alles zu erdulden, da ihre schöne Stadt Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Römer dem Untergang geweiht sei. Alles wäre besser, als die Gräuel des Krieges. Sie sollten auch an ihre Frauen und Kinder denken, die dies nicht überleben würden.
Florus war allerdings an einer Beruhigung der Situation nicht gelegen. Er heizte die aufgeladene Stimmung durch weitere Übergriffe der Soldaten mit tausenden von Opfern immer mehr an.
So kam es, wie es kommen musste. Das Feuer der Revolution war nun nicht mehr aufzuhalten. Die radikalen Kräfte unter den Juden, die Sikarier und Zeloten, kämpften nun offen gegen die römische Garnison in Jerusalem und belagerten diese. Nachdem die Soldaten die eidliche Zusage freien Geleites erhalten hatten, legten sie die Waffen ab, um abzuziehen. Kaum waren sie allerdings im Freien, wurden sie von den jüdischen Kämpfern niedergemacht. Etwa 6.000 römische Soldaten sollen ihr Leben verloren haben. Diese Niederlage gilt als die schwerste, die die römische Armee gegen eine rebellische Provinz erleiden musste.
Aber der Hass der Aufrührer richtete sich nicht nur gegen die Römer, sondern auch gegen die Oberen des Volkes, die mit diesen zusammengearbeitet hatten. So wurde der Hohepriester Ananias zusammen mit einigen aus der höheren Priesterschaft, die sich in die Königsburg geflüchtet hatten, ermordet.
Josephus Flavius beschreibt nun in Der Jüdische Krieg in allen Einzelheiten wie der Aufstand sich über das ganze Land verbreitete und die Römer tatsächlich vollständig vertrieben wurden.
Die Revolution richtete sich aber nicht nur gegen die Römer, sondern brachte auch die ethnischen Spannungen zutage, die zwischen den einzelnen Volksgruppen in Israel und den angrenzenden Ländern wie Syrien, Gaza oder Gaulanitis herrschten.
In vielen Städten brachten Juden Angehörige anderer Nationalitäten um oder wurden selbst umgebracht, wenn sie in der Minderheit waren. So verloren nach Josephus allein in Cäsarea 20.000 Juden in einer einzigen Stunde ihr Leben. Die Fackel des Aufstandes wurde sogar bis Ägypten, nach Alexandria getragen, wo 50.000 Juden, nach gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den dortigen Griechen, von römischen Soldaten niedergemacht worden seien. Wie bereits gesagt, übertreibt Josephus oft mit Opferzahlen, aber es dürfte ein gewaltiges Morden durch die Lande gezogen sein.
Als dann die Römer, gegen die sich der Aufstand gerichtet hatte, beseitigt waren, trat das ein, was mit dem Wort gemeint ist: „Die Revolution frisst ihre Kinder.“
Zwischen den verschiedenen Gruppierungen der Aufständischen bestand tiefes Misstrauen und Uneinigkeit, wer die Führung übernehmen solle. So ging Manaim, der Führer der Sikarier, ein Enkel von Judas dem Galiläer und Urenkel des Hiskia, davon aus, dass jetzt, mit der Vertreibung der Römer, das Reich Gottes gekommen sei. Und wer sollte der Messias sein, wenn nicht er, mit seiner Abstammung. Er legte daher königliche Gewänder an, zog in einer feierlichen Prozession in den Tempel ein und ließ sich von seinen Anhängern als Messias feiern. Der Tempelhauptmann Eleasar sah darin jedoch einen dreisten Griff der Sikarier nach der Macht. Mit seinen Männern überwältigte er die Leibwache Manaims, nahm diesen gefangen und folterte ihn zu Tode.
Zwar flohen die Sikarier daraufhin aus der Stadt, aber die verbleibenden Gruppierungen terrorisierten sich weiterhin gegenseitig.
Den Revolutionären war jedoch klar, dass der römische Gegenschlag nur eine Frage der Zeit sein konnte. Diese Gefahr einte sie letztlich und sie machten sich in fieberhafter Eile daran, das ganze Land, alle Städte und Dörfer, zu befestigen. Aber was wollten sie gegen ein Heer von 60.000 Mann ausrichten, das Vespasian im Herbst des Jahres 67 von Norden, von Galiläa, her kommend, heranführte? Eine der ersten Städte die fiel, war Jotapa, der Sitz des jüdischen Befehlshabers für Galiläa, Josephus ben Mathitjahu ha Kohen, uns bekannt als Josephus Flavius. Nach einer 47-tägigen Belagerung konnten die Römer die Stadt einnehmen. Josephus und ein anderer Mann überlebten, weil sie sich nicht wie die anderen Kämpfer selbst getötet hatten. Sie ergaben sich und wurden am Leben gelassen.
Vespasian und sein Sohn Titus, der eine Legion aus Ägypten heranführte, rollten nun das ganze Land nach und nach auf, indem sie Städte und Dörfer eroberten, dem Erdboden gleichmachten und in vielen Fällen nicht nur die Männer, sondern auch Frauen und Kinder, umbringen ließen.
So kreisten sie Jerusalem langsam ein. Im Jahre 68 war das ganze Land wieder unter römischer Kontrolle, mit Ausnahme Jerusalems. Dann trat allerdings eine Verzögerung ein. Da Kaiser Nero gestorben war, reiste Vespasian nach Rom, um Ansprüche auf den Thron anzumelden. Er wurde tatsächlich zum Kaiser gewählt und befahl daraufhin seinem Sohn Titus Jerusalem einzunehmen, koste es was es wolle.
Dort war das Chaos ausgebrochen. In die schon überfüllte Stadt waren von überallher Flüchtlinge geströmt, was die Not noch vergrößerte. Ganze Familien verhungerten, die Straßen waren voller Leichen. Zu allem Überfluss bekämpften sich die verschiedenen Parteien noch gegenseitig – Gemäßigte, die kapitulieren wollten, Zeloten, die überzeugt waren, JHWH würde die Juden zum Sieg gegen die Römer führen und einem Rebellenlager von 10.000 Mann, das von Simon bar Giora angeführt wurde. Diese Macht gab ihm die Möglichkeit, sich zum König und Messias ausrufen zu lassen und in festlichen Gewändern durch die Stadt zu stolzieren. Als solcher beschuldigte er Angehörige der Oberschicht des Verrats und ließ sie hinrichten. Zudem überzogen die fanatisch gläubigen Zeloten die Stadt mit Terror gegen die Andersdenkenden.
Als nun die Römer mit der Belagerung der Stadt begannen, blieb den verschiedenen Parteien nichts anderes übrig, als sich zu einigen und sich auf den Angriff vorzubereiten.
Die Römer hatten um die Stadt eine Mauer aufgerichtet, die jedes Entkommen unmöglich machte. Die Flüchtenden, die sie aufgriffen, kreuzigten sie, für alle sichtbar, auf dem nahen Ölberg.
Als im April des Jahres 70 Titus mit seinen Legionen schließlich die Stadt erstürmte, metzelten die Soldaten alle Einwohner ohne Unterschied nieder. Sie plünderten und raubten den Tempelschatz. Am Ende ließen sie alles, einschließlich des Tempels, in Flammen aufgehen. Als diese verlöscht waren, wurde Jerusalem eingeebnet, als hätte es nie bestanden.
Endlich war Ruhe im Land eingekehrt. Friedhofsruhe!
Abbildung 2: Raub des Tempelschatzes durch römische Soldaten
(Quelle: Wikimedia Commons, Von Dnalor 01 Lizenz CC-BY-SA 3.0)
Die Welt, in der Jesus einige Jahrzehnte vorher gewirkt hatte, war untergegangen. Hatte er dieses Szenario vorausgesehen? Hatte er versucht dies zu verhindern?
Die Mitglieder der christlichen Urgemeinde von Jerusalem waren vermutlich vor der Zerstörung Jerusalems nach Pella in der Dekapolis (Zehnstädteland) im heutigen Jordanien geflohen. Es ist nicht überliefert, dass Christen in Jerusalem umgekommen wären. Hatten sie Warnungen Jesu gekannt und beherzigt?
Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: „Meister! Siehe, welche Steine und welch ein Bau ist das?“ Und Jesus sprach zu ihm: „Siehst du diese großen Bauten? Es wird kein Stein auf dem andern gelassen werden, der nicht zerbrochen wird!“ 38
„Wenn ihr aber sehen werdet den Gräuel der Verwüstung…, alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge; und wer auf dem Dache ist, der steige nicht hernieder ins Haus und komme nicht hinein, etwas zu holen aus seinem Hause; und wer auf dem Felde ist, der wende sich nicht um, seine Kleider zu holen. Weh aber den Schwangeren und Säugerinnen zu der Zeit! Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter. Denn in diesen Tagen werden solche Trübsale sein wie sie nie gewesen sind bisher, vom Anfang der Kreatur, die Gott geschaffen hat, und wie auch nicht werden wird.“ 39
Stammen diese Sätze von Jesus und waren sie auf die Geschehnisse dieser Zeit gemünzt?
Wurden sie ihm im Nachhinein von den Evangelisten in den Mund gelegt, da diese nur wenige Jahre nach der Zerstörung Jerusalems schrieben und ihnen dieses Szenario bekannt war? Fragen, die wir in der Folge zu lösen versuchen!
Wie wir gesehen haben, waren viele Menschen damals religiösem Fanatismus und weltlichen Machtwahn unterworfen und gebunden durch Ängste, einengende religiöse Vorschriften und starre Familientraditionen. In diese Welt wurde Jesus hineingeboren.
War er berufen, die Menschen aus diesen Abhängigkeiten zu erlösen und ihnen den eigentlichen Sinn des Lebens zu vermitteln?
In der Bhagavad Gita, der „Indischen Bibel" sagt Krishna: „Immer wenn die Rechtschaffenheit abnimmt und die Bosheit zunimmt, werde ich mich auf dieser Welt inkarnieren." 40
Nach unserer Sichtweise bedeutet dies, dass Gott immer dann einen „Erlöser“ in die Welt schickt, der die Menschheit wieder auf den rechten Weg führen soll, wenn diese im Chaos zu versinken droht.
War dies der Auftrag Jesu?