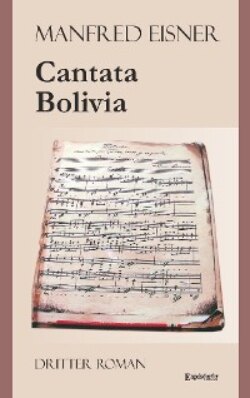Читать книгу Cantata Bolivia - Manfred Eisner - Страница 10
4. Berches, Coca und Kaffee
ОглавлениеInzwischen hat Heiko sich in der Bäckerei des Señor Elias Espinoza Barrientos sehr gut eingebracht und sich rasch zum Capataz, zum Vorarbeiter, hochgearbeitet. Unter ihm wirken fünf Gesellen und zwei Gehilfen. Die Tagesproduktion besteht hauptsächlich aus den bereits erwähnten krossen Marraqueta-Weißbroten. Zudem beliefert die Bäckerei die beiden öffentlichen Schulen in der Nachbarschaft mit den runden, bräunlichen und weichen Sarnitas aus Mischmehl mit Kleie, die zusammen mit einem heißen Trunk aus violetten, fein gemahlenen Maiskörnern, genannt „Api“, den Kindern täglich als „desayuno escolar“, als Schulfrühstück, gereicht werden, damit – das betrifft die meisten von ihnen – sie wenigstens eine Mahlzeit am Tage erhalten.
Heiko beeindruckt seinen Chef zum einen wegen der fundierten Fachkenntnisse, zum anderen aber auch durch seinen fleißigen Einsatz. Er ist der Erste, der um fünf Uhr morgens die Bäckerei betritt, und der Letzte, der nachmittags gegen vier Uhr, nachdem er kontrolliert hat, dass alles wieder ordentlich gereinigt ist und sich an seinem vorgesehenen Platz befindet, das kleine Bäckereigebäude verlässt und dessen Tor verschließt. Er hat aber vorab noch Satanás, den Rottweiler, aus dem Zwinger geholt und ihn an die lange Laufkette gelegt – eine leider aufgrund zweimaligen Einbruchs notwendig gewordene Vorsichtsmaßnahme.
In der Anfangszeit spricht Heiko den Inhaber noch mit „Señor Barrientos“ an, bis dieser ihm klarmacht, dass „Barrientos“ der Nachname seiner Mutter und nicht sein Familienname sei, der sich ja väterlicherseits ableitet und Espinoza lautet. Dann belehrt er Heiko, dass seine Mutter, Señora Berta Inés Barrientos Sanz, seit der Heirat mit seinem Vater den Namen „Señora Barrientos de Espinoza“ trägt – alles ziemlich kompliziert für einen nicht eingeweihten Mitteleuropäer. Schließlich aber ermuntert der Inhaber der Bäckerei seinen tüchtigsten Angestellten, ihn der Einfachheit halber mit „Don Elías“ anzusprechen.
Nach einigen Wochen fragt Heiko ihn, was er davon halte, gegebenenfalls das Backsortiment um einige europäische Brotsorten zu erweitern. Zudem, so bringt er vor, habe er bereits eine Anfrage der jüdischen Gemeinde, an jedem Freitag zunächst fünfzig Mohnzöpfe für den Sabbat zu liefern. Aaron Levy hat ihm inzwischen das versprochene Grundrezept für die sogenannte „Challah“ – oder „Berches“, wie das Backwerk üblicherweise auf Jiddisch genannt wird – zukommen lassen. Don Elías ist allerdings bezüglich einiger der für ihn unüblichen Zutaten für diese Brotsorte – Honig, Pflanzenöl, Eier und Mohnsamen, die neben Weizenmehl, Hefe und Salz erforderlich sind – überrascht. Dann meint er: „Also, Heiko, grundsätzlich finde ich die Idee gut, aber du müsstest dafür eine eigene, zusätzliche Arbeitskraft besorgen, die Übung im Zopfflechten mitbringt. Bei der Beschaffung von Honig und Maiskeimöl sehe ich kein größeres Problem, allerdings bin ich mir nicht sicher, woher du die vielen frischen Eier und die Mohnsamen nehmen willst. Die wenigsten Eier, die es von den Cholitas auf den Mercados zu kaufen gibt, sind frisch, manche sind sogar bereits verdorben.“
„Machen Sie sich bitte keine Sorgen wegen der Eier, Don Elías, die kann ich mit verbürgter Frische von der Hacienda meines Freundes José Rembowski beschaffen. Und zwecks der Mohnsamen werde ich meinen Mitbewohner, Señor Kahn, beauftragen, eine Quelle ausfindig zu machen. Er kennt sich hier schon bestens aus. Die Frage ist nur: Sind Sie prinzipiell einverstanden? Als Arbeitskraft werde ich schon ein oder zwei geübte Zopfflechterinnen unter den vielen jüdischen Hausfrauen auftreiben, die uns jeden Freitagmorgen unter die Arme greifen.“
„Welchen Verkaufspreis, denkst du, könnte man denn für eines dieser etwa ein Kilogramm schweren Brote, erzielen? Der Rohwareneinsatz und die Art und Weise der Herstellung sind ja um etliches aufwendiger als bei unseren einfachen Marraquetas und Sarnitas, nicht wahr? Du müsstest erst einmal alles zusammenrechnen, auch den Lohn für die Zopfflechterinnen, und dazu unsere allgemeinen Kosten. Wenn du mir die Summe vorlegen kannst, sprechen wir noch einmal darüber, in Ordnung, Heiko?“
Am nächsten Tag macht sich Heiko eifrig auf die Suche, um Lieferanten für die Zutaten seiner Sabbatzöpfe zu finden und deren Preise zu ermitteln. Mit Herrn Levy berät er sich über einen angemessenen Preis, zu dem man die Gemeindemitglieder beliefern könnte. In einem Gespräch mit Rabbiner Akiba Süßkind verabreden sie, hierfür eine Umfrage in einem repräsentativen Verbraucherkreis durchzuführen.
Aus Heikos ursprünglichem Einfall, geübte Zopfflechterinnen zu rekrutieren, wird allerdings nichts. Der Rabbi gibt zu bedenken, dass, obwohl diese Brotart eigentlich „parve“ sei – also weder Fleisch noch Milch enthält –, die Challah aber, die für den allgemeinen Verzehr der Gemeindemitglieder bestimmt sein würde, vorzugsweise von jüdischen Männerhänden hergestellt werden müsse, um den Speise-Reinheitsvorschriften voll zu entsprechen. Es gäbe da in seiner Gemeinde einen ehemaligen Bäcker aus Posen, den solle man fragen, ob er vielleicht hierzu bereit sei.
Heiko fahndet also nach jenem Fränkel Gottlieb, den er schließlich in einem Altenheim ausmacht. Dieser ist schon fast siebzig Jahre alt, hat aber lange Zeit bei einem jüdischen Bäcker in Kurmik gerade diese Schabbes-Mohnzöpfe gedreht und gebacken. Gern ist er bereit, einmal wöchentlich einzuspringen und sich dabei ein Taschengeld – viel mehr kann ihm Heiko ja nicht bieten – zu verdienen. „Was Sei mir werden geben können, wird seien git“, bemerkt er mit einem freundlichen Lächeln, und die beiden schlagen ein.
Zwei Wochen später erhält Heiko von Aaron Levy Bescheid, dass man sich im Abnehmerkreis auf einen Abgabepreis von bis zu 6,00 Bolivianos pro Mohnzopf von je einem Kilogramm geeinigt habe. Eine Umfrage hat zudem ergeben, dass anfänglich vierzig Gemeindemitglieder sich verpflichten würden, allwöchentlich je eines der Zopfbrote abzunehmen, weitere fünf mehrköpfige Familien sogar je zwei. Die Menge, die Aaron Levy anfänglich genannt hat, war also realistisch. Mit diesen Angaben rechnet Heiko noch einmal alle Herstellungskosten zusammen. Damit spricht er seinen Chef abermals an: „Also, Don Elías, hier ist meine Kostenaufstellung. Wir sollten den Preisvorschlag von 6,00 Bolivianos annehmen, wobei ich einen Gesamtpreis von 11,00 Bolivianos für die Abnehmer von zwei Broten vorschlage. Die 50 Stück kosten uns summa summarum nicht ganz 200,00 und wir könnten wöchentlich 295,00 Bolivianos durch den Verkauf erzielen. Davon bitte ich Sie, mir eine Vermittlerprovision von 30,00 Bolivianos zuzugestehen, dann verbleiben der Firma immer noch satte 65,00 Bolivianos Reingewinn. Das wäre prozentual doch reichlich mehr, als wir heute an den einfachen Marraquetas und Sarnitas verdienen, nicht wahr? Übrigens glaube ich, dass wir noch viel mehr Zöpfe bei weiteren Brotläden in der Stadt absetzen könnten, würden wir sie dort anbieten.“
Don Elías’ tiefe Stirnfalten ziehen sich bei Heikos Erwähnung der beanspruchten Provision bedrohlich zusammen, entspannen sich aber ebenso rasch, als er von dem guten Erlös erfährt, den der Verkauf der Sabbatzöpfe verspricht. Es folgt eine längere Denkpause, dann mustert er Heiko und sagt: „De acuerdo, einverstanden! Aber sagen wir zunächst einmal für zwei Monate zur Probe. Dann erfahren wir, ob deine Berechnungen auch stimmen.“ Im Gegensatz zu Heiko, der die Warenkalkulation noch aus seiner Marschländer Backwarenfabrik in Oldenmoor aus dem Effeff beherrscht, hat Don Elías kaum Erfahrung in dieser Materie, denn sowohl Rezeptur und Abgabegewicht als auch Verkaufspreise für die gängigen Brote sind amtlich vorgeschrieben. Wenn es wegen der Inflation mit dem Erlös der Bäcker enger wird, reagieren diese zunächst stets mit dem Knapsen am Gewicht der Backwaren. Werden schließlich die Marraquetas allmählich kleiner und ist die Regierung nicht bereit, den Verkaufspreis des Brotes dem Währungswertverfall anzupassen, nimmt üblicherweise die Bevölkerung diese Erscheinung als Omen dafür wahr, es könne wohl bald wieder zu einer Revolution mit Umsturz von Präsident und Regierung kommen.
Als es Jakob Kahn tatsächlich gelungen ist, einen Mohnsamenlieferanten unter den libanesischen Kaufleuten der Stadt aufzutreiben, der zudem Sesamkörner, Datteln und ähnliche Waren aus dem Nahen Osten im Angebot führt, machen sich Heiko und Fränkel Gottlieb mit einem der Gehilfen am nächsten Freitagmorgen gemeinsam an die Arbeit. Unter Fränkels Regie wird zunächst das Wasser auf etwa 40 Grad Celsius erwärmt und in den Kessel der museumsreifen AlexanderwerkHubknetmaschine gefüllt. Laut ächzend setzt dessen Motor Kessel und Rührwerk in Bewegung. Nach der zerbröselten Hefe werden Honig, Maisöl, verquirlte Eier und Salz nacheinander im Wasser untergeschlagen. Schließlich wird das Mehl portionsweise hinzugegeben und untergemischt. Dann wird der Teig so lange geknetet und der Rest des Mehls zugefügt, bis dieser elastisch und nicht mehr klebrig ist. Die Teigmasse wird schließlich in größere Holzmollen überführt und mit feuchten Tüchern abgedeckt. Während der folgenden 90-minütigen Ruhezeit verdoppelt sich das Teigvolumen.
Dann knetet Fränkel noch einmal tüchtig den Teig mit den Händen und portioniert anschließend mit geübtem Griff die Teigmengen. Er rollt anschließend die Portionen zu Strängen von eineinhalb Zentimetern Durchmesser. Aus je drei dieser Stränge dreht er geschickt die Zöpfe, die alle gleichmäßig groß sind. Sie werden auf geölte Bleche gelegt und ruhen erneut eine Stunde unter feuchten Tüchern, wobei sie abermals aufgehen. Dann bepinselt Heiko die Zöpfe mit verquirltem Ei und bestreut sie gleichmäßig mit Mohnsamen. Das Thermometer am inzwischen mit Holz vorgeheizten, typischen irdenen Backofen zeigt die vorgeschriebenen 190 Grad Celsius an, als der Gehilfe die Backbleche mit den Berches für etwa 40 Minuten einschiebt.
Gespannt warten der inzwischen hinzugekommene Don Elías sowie die gesamte Mannschaft auf das Ergebnis. Mit begeisterten Ausrufen und Applaus bestaunen sie die goldgelben und stark duftenden Brote, als diese nach dem Backen wieder zum Vorschein kommen. „Vorsicht“, mahnt Fränkel, „die müssen erst eine Stunde abkühlen, bevor wir sie anschneiden, sonst fallen sie zusammen!“ Behutsam überträgt er die Zöpfe auf Drahtroste. Schließlich, als sie abgekühlt sind, gebührt es Fränkel Gottlieb, eine Challah anzuschneiden, nachdem er die gebotene Bracha – den Segen über das Brot – auf Hebräisch heruntergemurmelt hat. Gerührt und freudig probieren Don Elías, seine Ehefrau Doña Silvia und die ganze Belegschaft die gut schmeckenden Zopfbrotscheiben. Sie gratulieren Heiko und Fränkel zu dem gelungenen Experiment. Dann laden sie die Mohnzöpfe in mit Pergamentpapier ausgeschlagene Holzkisten um und verladen diese auf die klapprige Chevrolet-Camioneta. Heiko, der inzwischen auch den hiesigen Führerschein gemacht hat, bekommt den Schlüssel für den Pickup und fährt zusammen mit Fränkel rasch zur Synagoge, denn es ist schon fast vier Uhr nachmittags und die Sabbatbrote müssen vor Beginn des Vorabends abgeliefert worden sein. Man hat vereinbart, dass die Bezahlung dieser Lieferung am darauf folgenden Mittwoch erfolgen soll, wenn alle Abnehmer bezahlt hätten, denn am Shabbes dürfe man kein Geld berühren, geschweige denn welches mitführen.
Tatsächlich erscheint am Mittwoch Jankele Bauchwitz, der Shammes – Synagogendiener – mit einem Umschlag, in dem sich die vereinbarten 295,00 Bolivianos befinden, für die er an der Kasse von Doña Silvia eine Quittung erhält. Dann meldet er Heiko, der „Rebbe sugt“, man möge bitte zum nächsten Shabbes 53 Berches liefern, da einige Gemeindemitglieder erst nachträglich von dieser Gelegenheit erfahren hätten. Heiko übersetzt seinem Chef die frohe Botschaft. Darauf zählt Don Elías die vereinbarten 35 Bolivianos ab und überreicht sie mit den Worten: „Alle Achtung, lieber Heiko, die hast du dir wahrlich verdient!“
* * *
Als Josef und Frauke das etwa 280 Hektar große Anwesen ihrer Hacienda Guayrapata erwerben, wird auch diese – wie in 95 Prozent der in Latifundien aufgeteilten Landwirtschaftsflächen Boliviens üblich – noch mit dem aus der Zeit der spanischen Kolonialzeit stammenden „pongueaje“-System bewirtschaftet. Die Pongos, völlig mittellose, in der Agrarwirtschaft tätige Indios werden gnadenlos ausgebeutet und sind durch sklavenähnliche Verhältnisse nahezu lebenslang an ihre herzlosen Patrones gebunden. Gnädig überlassen die Landeigentümer jeder Pongofamilie ein kleines Stück Land, auf dem sie sich selbst die karge, strohgedeckte und irdene Adobehütte errichten und etwas Gemüse und Coca für den Eigenbedarf anbauen dürfen. Etwaige Überschüsse werden vom Patrón zum miserablen, niedrigsten Preis übernommen, während den Pongos ergänzende Lebensmittel und Bedarfsgegenstände überteuert zur Verfügung gestellt werden, so dass die armen Teufel stets tief verschuldet bleiben. Drei Tage in der Woche leisten diese Männer jeweils bis zu zwölf Stunden lang den unbezahlten Frondienst für den Herrn als Gegenwert für das ihnen überlassene Stückchen Land.
Als Frauke und Josef an ihrem vom Vorbesitzer übernommenen Personal diese menschenverachtenden und für ihren Geschmack absolut unzumutbaren Zustände wahrnehmen, überlegen sie, wie sie dies umgehend ändern können. Sie hören sich um und erfahren, dass es in Huatajata, am Ufer des Titicacasees, seit 1911 einen von einer Mission der kanadischen Baptistenkirche realisierten Versuch gibt, eine traditionelle Hacienda in ein menschliches Unternehmen zu verwandeln. Sie fahren nach Huatajata und treffen dort auf Bruder Abelardo, einen einheimischen Missionsmitarbeiter, der an der Umgestaltung des Anwesens maßgeblich beteiligt ist.
„Ich finde es sehr löblich von Ihnen, Señor und Señora Rembowski, dass Sie sich für ein so nobles Vorhaben engagieren, nämlich eine Vermenschlichung der Arbeitsbedingungen für die armen Pongos in Angriff zu nehmen. Bedenken Sie dabei aber bitte, dass Sie mit Ihrer Aktion ein archaisches und bei allen Betroffenen tief verwurzeltes System angreifen. Es wird Ihnen schwerfallen, vor allem das Vertrauen der inzwischen von den Weißen über Jahrhunderte geschundenen und gedemütigten Indios zu gewinnen. Insbesondere machen Sie sich damit Ihre Nachbarn, die Hacenderos der Umgebung, ganz sicher zu erbitterten Feinden. In deren Augen verletzen Sie ein heiliges Tabu und begehen einen unverzeihlichen Frevel, müssen Ihre Nachbarn doch befürchten, dass die neu gewährte Freiheit für ihre Peones – ihre eigenen Pongos – ein schlechtes Beispiel sei. Ich weiß, wovon ich rede. Nicht nur einmal versuchte man, uns mit übelsten Mitteln – einmal wurde sogar ein Feuer gelegt – von unserem Vorhaben abzubringen. Glauben Sie mir, machen Sie sich auf alles gefasst!“
Während Josef noch über das soeben Erfahrene nachdenkt, fragt Frauke: „Hermano Abelardo, würden Sie uns helfen? Wir sprechen kein Aymara und die meisten unserer Leute haben keine Spanischkenntnisse. Wären Sie bereit, zu uns zu kommen, um ihnen das, was wir vorhaben, zu erklären?“
„Wenn ich Ihnen damit helfen kann, liebend gern, geschätzte Señora!“
Im Anschluss an das Gespräch führt Bruder Abelardo Josef und Frauke in seiner Modellfinca herum, erklärt alles und gibt ihnen viele Ratschläge. Tief beeindruckt von dem, was sie an diesem Tag gehört und gesehen haben, kehren die beiden beseelt und fest entschlossen, die erforderlichen Veränderungen auf ihrem Landgut unverzüglich in Angriff zu nehmen, spät in der Nacht nach La Paz zurück. „Du hattest den besten Einfall des Jahrhunderts, geliebte Frauke.“ Josef sah sie liebevoll an.
„Ohne die Hilfe des Hermano Abelardo stünden wir wie der Prediger in der Wüste da, nicht wahr?“
* * *
Kurze Zeit nach ihrem Ausflug nach Huatajata besucht Bruder Abelardo Josef und Frauke in La Paz. Von ihm erhalten sie weitere wertvolle Ratschläge für die beabsichtigte Umstellung der Arbeitsverhältnisse und die zukünftige Entlohnung ihrer dann eigenständigen Landarbeiter oder Peones, wie man sie von nun an nennen wird.
Am nächsten Tag begleitet Abelardo Josef nach Guayrapata. Alle dort ansässigen Indios und ihre Familien werden zu einer abendlichen Versammlung in die Casa Vieja eingeladen. Hermano Abelardo hält eine längere Ansprache auf Aymara und erklärt den Landarbeitern, dass sie ab sofort von ihren sämtlichen Altschulden an den vorherigen Patrón befreit seien. Wenn sie es wünschten, könnten sie schon am Monatsende ihre Arbeit auf der Hacienda ohne Behinderung beenden und beliebig wegziehen. Jene, die es dennoch vorzögen zu bleiben und weiterarbeiten wollten, könnten dies unter ab sofort erheblich verbesserten Bedingungen tun. Sie erhielten nunmehr einen schriftlichen Arbeitsvertrag für jeweils ein Jahr, der aber beliebig verlängert werden könne, solange Patrón und Peón dies für wünschenswert und angebracht hielten. In Zukunft werde jede von den Beschäftigten geleistete Arbeitsstunde gerecht entlohnt und jedem der angesammelte Lohn zweimal monatlich in bar ausbezahlt. Die je nach Bedarf vom Verwalter angeordnete Arbeitszeit betrage ab sofort maximal acht Stunden täglich an bis zu sechs Tagen in der Woche. Sonntage und Nationalfeiertage blieben grundsätzlich arbeitsfrei. Allerdings könne der Patrón jene Peones jeweils zum übernächsten Monatsende entlassen, die ihre Obliegenheiten nicht zufriedenstellend erfüllten. Sie dürften aber selbst dann noch zwei bis drei Monate in ihren Häusern wohnen, bis sie eine neue Bleibe gefunden hätten.
Die Zuhörer sind zunächst fassungslos. Doch schon bald kommt eine große Unruhe in der Zuhörerschaft auf und unter den Beteiligten erhebt sich eine lebhafte Diskussion.
Josef lässt sie eine Weile gewähren, dann ergreift er das Wort: „Mein liebes Personal! Wie ihr wisst, komme ich aus dem fernen Europa und bin hier, in eurem Land Bolivien, mit meiner Frau und meinen vielen Freunden sesshaft geworden. Wir haben erfahren, dass ihr mit den hiesigen Arbeitsbedingungen sehr unzufrieden, ja sogar sehr unglücklich seid. Auch wir finden eure bisherigen Lebens- und Arbeitsverhältnisse menschenunwürdig und wollen diese deswegen ab sofort verbessern. Bitte, Hermano Abelardo, übersetzen Sie.“
Danach fährt Josef fort: „Aus diesem Grund möchten wir auch einiges auf der Hacienda umstellen. Neben den von Hermano Abelardo angekündigten Änderungen werden wir vor allem aber die bisherige Coca-Anpflanzung beenden. Wir wissen, welche Bedeutung diese Pflanze für Sie hat, aber wir müssen zukünftig andere Produkte erzeugen, die sich besser verkaufen lassen. Der Cocapreis ist so niedrig, weil alle Haciendas in den Yungas nur diese Blätter erzeugen. Um euch aber in Zukunft für eure Arbeit besser bezahlen zu können, werden wir schon bald unsere Hauptproduktion auf Kaffee umstellen. Unsere ersten Versuche waren sehr vielversprechend. Es besteht hier auf der Hacienda ja schon ein zwar noch bescheidener Cafetal, dessen Kaffeebäume uns jedoch bereits sehr ordentliche Ernten geliefert haben. Hiervon konnten wir uns sowohl selbst versorgen als auch eine gewisse Menge nach La Paz verkaufen. Für den Kaffee haben wir dort viel bessere Preise erzielt als für die Coca.“
Großes Palaver brandet auf, nachdem Bruder Abelardo übersetzt hat. Als er Bruchstücke davon aufgefangen hat, spricht er einige Worte in Josefs Ohr.
Der reagiert sofort: „Machen Sie sich aber um Ihren eigenen Bedarf an Cocablättern keine Sorgen: Wir lassen ein Cocal mit genügend Pflanzen bestehen, damit Sie sich versorgen können. Allerdings wird es Ihre Aufgabe sein, diese ab sofort in Ihrer Freizeit selbst zu pflegen und auch abzuernten. Der Schieferplattenhof vor der Casa Vieja steht Ihnen dafür allerdings nicht mehr zur Verfügung, denn er wird zukünftig für die Trocknung unserer Kaffeebohnen benötigt. Schaffen Sie sich also vor Ihren Häusern eine eigene Trocknungsfläche. Da wir also den Handel mit Coca einstellen, können wir nicht mehr wie bisher Ihre Überschüsse übernehmen und vergüten. Das gilt selbstverständlich nicht für Ihre anderen Erzeugnisse. Gern werden wir Ihnen Bohnen, Maiskolben, Yuca, Chirimoyas, Guayabas, Mangos, Bananenstauden und andere Früchte, die Sie selbst nicht benötigen, zu gerechten Marktpreisen abnehmen und diese unverzüglich in bar bezahlen.“
Santiago erhebt sich und fragt auf Spanisch, ob er das Wort ergreifen dürfe. Als es ihm gewährt wird, sagt er: „Ist ja alles sehr schön und gut, aber bisher durften wir mit unseren Familien bis ans Lebensende in unseren Ranchos wohnen bleiben, auch wenn wir zu alt waren, um noch für den Patrón zu arbeiten. Wie wird es jetzt sein, wenn wir alt sind und nicht mehr arbeiten können? Wo gehen wir dann hin und wovon sollen wir leben?“ Er wiederholt das soeben Gesagte auf Aymara und erntet damit großes Zustimmungsgemurmel.
„Hermano Abelardo“, antwortet Josef, „der aus Huatajata stammt, wo genau dieselben Arbeitsbedingungen eingeführt und erfolgreich angewendet werden, berichtet uns, dass von jenen freien Peones, die dies ausdrücklich wünschen, ein kleiner Betrag des Gehaltes einbehalten und auf ein Sparkonto bei der Bank einbezahlt wird, damit die Arbeiter für ihr Alter vorsorgen. Deren Arbeitsverträge gelten bis zum 65. Lebensjahr. Danach dürfen sie das ihnen vertraglich zugeteilte Haus mit Landstück weiterhin unentgeltlich bis zu ihrem Tode sowie dem der Witwe weiter bewohnen und wie bisher nutzen.“
Nachdem Bruder Abelardo auch diese Neuigkeiten auf Aymara verkündet hat, bittet er die Anwesenden, eine Nacht über das Angebot zu schlafen. Am nächsten Tag sollen die Landarbeiter zu Einzelgesprächen wiederkommen. Es werden ihnen sämtliche Fragen beantwortet und auch die neuen Arbeitsverträge vorgelesen und übersetzt. Sie könnten diese dann auch mitnehmen und sich mit einem Rechtsanwalt oder Notar beraten. Wenn genügend Kandidaten dies wollten, werde der Patrón einen Rechtsbeistand aus Chulumani herbestellen, damit er ihnen behilflich sei.
Abschließend kündigt Josef an: „Wir werden das Angebot unserer Pulpería, in der Sie wie bisher zu amtlichen Marktpreisen einkaufen können, weiterführen und nach Ihren Anregungen erweitern. Sie können dort, wann immer Sie wollen, Ihre Sonderbestellungen aufgeben. Diese werden ausgeliefert, sobald sie eingetroffen sind. Ich darf auch ankündigen, dass, sobald unser Backofen instandgesetzt ist, wir zweimal wöchentlich backen werden und Ihnen frisches Brot anbieten. Zuletzt habe ich noch eine große Bitte: Seien Sie so gütig und behalten Sie unser heutiges Angebot für sich. Sie können sich vorstellen, dass die Pongos der benachbarten Haciendas sehr neidisch sein werden, wenn sie von den anstehenden Neuerungen erfahren. Es bleibt sicher nicht aus, dass ihre Patrones davon hören und uns deswegen Schwierigkeiten bereiten könnten. Dies möchten wir, solange es nur möglich ist, vermeiden. Also, bitte seien Sie diskret und reden Sie nicht mit Fremden über das, was Sie heute erfahren haben. Hermano Abelardo wird Sie jetzt der Reihe nach auf die Liste für die morgigen Einzelgespräche setzen. Muchas gracias y vayan con Diós!“
Etwa eine Woche später haben bis auf eine Ausnahme alle bisherigen Landarbeiter, Iraya, Santiago, Manuel und Jaime dem Vorschlag des Patrón Don José Rembowski zugestimmt und im Beisein des Notars, Don Fidelio Ramos Mejía, ihre neuen Verträge als sesshafte Peones der Hacienda Guayrapata unterschrieben. Auch sämtliche Saavedramädchen sowie Miguel haben Einzelverträge als Festangestellte erhalten. Der alte Agustín ist ein fast siebzigjähriger Witwer und braucht keinen neuen Vertrag, um in seinem bescheidenen Rancho bis zum Lebensende weiter wohnen zu bleiben. Die 25 Bananos auf seinem Altenteil, die stets volle Stauden der kleinen, sehr aromatisch-süßen Enanos – Zwergbananen – erzeugen, pflegt er dennoch weiterhin sorgfältig und beliefert damit regelmäßig den Don José-Patrón.
* * *
Josef war nicht von ungefähr auf die Idee mit der Kaffeeplantage gekommen. Als er die Hacienda kaufte, war in einer Terrassenecke ein zwar geringer, dennoch nicht unbedeutender Anteil bereits mit Arabica-Kaffeebäumen bepflanzt. Da diese fast ständig in Blüte waren, konnte man über das ganze Jahr hinweg die roten Kirschen ernten. Deren geschälte Bohnen, die eigentlich Kerne waren, ergaben nach Trocknung und Röstung einen sehr aromatischen Aufguss.
Vater Schloß hatte schon vorweg auf einem abgezäunten Feld und angeleitet durch einen brasilianischen Kaffeespezialisten mit der Aussaat neuer Pflanzen begonnen. Nach dem Keimen hatten sie die Aufzucht neuer Setzlinge erfolgreich vorangetrieben. Ademir Pereira dos Santos hatte eine noble deutsche Schule in São Paulo besucht und dort sein Abitur gemacht, bevor sein Vater, ein reicher Kaffeebaron, ihn zu sich in die eigene Plantage holte. Ademir, ein sympathischer junger Mann, hatte sich irgendwann wegen einer sich anbahnenden Beziehung zu einer einfachen Pflückerin mit seinem Vater gestritten und war kurzerhand von zu Hause abgehauen. Er wanderte zunächst in Brasilien umher, dann überschritt er die Grenze nach Bolivien. Eines Tages kam er nach La Paz und lungerte des Öfteren bei einem Landsmann herum, der eine bescheidene Kaffeerösterei betrieb. Dort lernte er zufällig Josef Rembowski kennen, der bei diesem und anderen potenziellen Kunden wichtige Informationen für seine zukünftige Plantage einholte. Schließlich engagierte ihn Josef für jene Zeit, die Ademir benötigen würde, um die Guayrapata Kaffeeplantage in Gange zu bringen. Vater Schloß war jedenfalls ungemein stolz auf seinen „Kaffeekindergarten“ und beäugte misstrauisch jeden fremden pflanzlichen oder tierischen Eindringling, der seinen Schützlingen irgendeinen Schaden würde zufügen können.
* * *
Schon kurze Zeit nach Josefs Ankündigung beginnen die Peones mit der Rodung der Cocasträucher, die auf den lang gezogenen Terrassenanlagen wachsen. Man hat ihnen vorab eine Woche Freizeit gewährt, damit sie samt ihren Familien die Blätter von den Pflanzen abernten. Sie dürfen diese letztmalig auf dem Schieferplattenhof vor der Casa Vieja ausbreiten. Drei Mal täglich kommen ihre Frauen, um die trocknenden Blätter mit Reisigbesen zu wenden. Nach etwa einer Woche sind die Blätter trocken und werden in Jutesäcke gepresst.
Nachdem die Stufen eines Terrassensegmentes von den Cocapflanzen befreit sind, wird unter Ademirs Leitung zunächst die restlos ausgelaugte Erde mit gemischtem Muli- und Rinderstalldung gedüngt und mit reichlich frischem Wasser begossen. Erst eine Woche später werden die Beete mit neuer Muttererde, die man aus dem oben gelegenen Wald geholt hat, vermischt und untergegraben. Nach einer weiteren Woche werden die Kaffeesetzlinge eingepflanzt. Dank der optimalen Klima- und Umgebungsbedingungen werden sie in etwa drei Jahren eine üppige Blütenpracht entfalten und eine reiche Kaffeeernte liefern.
Wie von Geisterhand verschwinden indessen sämtliche während des Tages entfernten Cocapflanzen. Nach dem Arbeitsende der Peones befördern allabendlich Ademir, Urs Brunner und Josef Schloß unauffällig das unheilbringende Krautzeug auf Schubkarren davon. Später brennt lichterloh, hinter dem Hühnerstall verborgen, ein großer Scheiterhaufen. Seltsam geformte Rauschschwaden, die oft ungeheuren Tieren oder übernatürlichen Geschöpfen ähneln, winden sich hinauf und verlieren sich schließlich am Himmel.