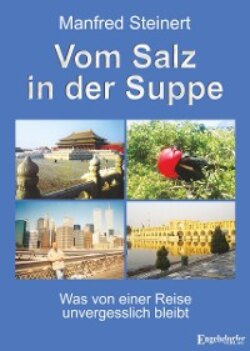Читать книгу Vom Salz in der Suppe - Manfred Steinert - Страница 8
Im Faltboot zu den Sternen
Оглавление(Oder: Wenn der Weg das Ziel ist)
Ferne Länder und Kontinente, fremdartige Kulturen und Menschen, exotische Tiere und Pflanzen, ungewohntes Klima und ähnliches. Das sind gewöhnlich die Klischees, die einem beim Wort »Expedition« einfallen. Und gewiss gehören auch immer ungewohnte Strapazen dazu.
Aber »Expeditionen« in Deutschland?
Dass das auch ohne die zuvor genannten »Ferne-Klischees« passieren kann, das zeigt diese Geschichte. Die erwähnten »ungewohnten Strapazen«, die bleiben allerdings erhalten.
Eine Geschichte aus den sechziger Jahren der früheren DDR. Eine Geschichte, die heute gewiss auch ähnlich denkbar wäre, doch würde das unter den aktuellen Bedingungen dann eher mit Abenteuerurlaub bezeichnet, würde über jede Menge technisches, logistisches und informatorisches Hinterland verfügen und somit Unwägbarkeiten überschaubar halten.
Dagegen waren das, was sich damals auf heimischen (DDR)-Gewässern abgespielt hatte, wahrlich richtige Expeditionen ins Ungewisse.
Da geht es um die Durchquerung der gesamten ehemaligen DDR im Faltboot. Von der tschechischen Grenze (Elbe) über Havel, … Müritz … bis zur Ostsee, die gesamte Boddenküste entlang vom Darß über Rügen bis Usedom. In einer anschließenden Tour auch bis Rostock/Warnemünde. Alles gepaddelt, teilweise gar gesegelt, in drei Jahren, während dreier langer Studentenurlaube.
Da geht es um Landschaften, um Nacht- und Gewaltfahrten, um Zufälle und »Beinahe-Katastrophen«, um Ängste und Befürchtungen, jedoch auch um einmalige Erlebnisse. Um riesige Seen und kleine und kleinste Kanäle, Bäche und Fließe, um Strapazen und Risiken, um Dutzende von Wehren, die umtragen werden mussten, um Wind, Sturm und Wellen, gar um Hochseeschiffe. Da geht es um Partnerschaften und Befindlichkeiten, und ganz gewiss – nach langer, gerade noch so überstandener Krankheit – auch um Selbstbestätigung. Darum, sich am eigenen Schopf aus einem mentalen »Sumpf« zu ziehen. Da spielt das anfängliche Alleinsein des damals absoluten Wasserwander-Neulings auf dem Wasser ebenso eine Rolle wie das stets »wilde« Zelten, mitunter unbeabsichtigt gar auf Truppenübungsplätzen oder ziemlich regelmäßig auf Kuhkoppeln.
Und alles wurde zudem – ganz »expeditionsgemäß«- aufgezeichnet. Jede der rund 50 Tagesetappen wurde mit Text, Karte, Bildern, Zeichnungen und Skizzen dokumentiert.
Das lagerte dann rund vierzig Jahre in zwei dicken Ordnern im Keller. Das Leben hatte anderes mit dem Protagonisten vor, den es so gehörig aus der Bahn geworfen hatte. (»Sternstunde«)
Somit entstand erst im Jahr 2009, also über vierzig Jahre später, daraus ein ganzes Buch.1
Obwohl es sich bei diesem Buch bereits um eine Kompaktversion aus den unzähligen Einzelbegebenheiten dieser abenteuerlichen Reisen handelte, soll dieses nun nochmals weiter zur folgenden Geschichte »eingedampft« werden.
Ein Versuch, bei dem zwar notgedrungen viele interessante Details auf der Strecke bleiben müssen. Doch ein Versuch, der es bei der Thematik dieses Buches wert schien – gleichsam als Einstimmung auf das Kommende – hier mit aufgenommen zu werden.
Die Planung: Recht abenteuerlich ging es bereits bei den Vorbereitungen der »Expeditionen« zu.
Denn für mich (»jenen jungen Mann« aus der Vorgeschichte) hatte sich nicht nur ein (ohnehin fragwürdiger) Traum zerschlagen, sondern die Voraussetzungen für eine nachhaltige Kurskorrektur des Lebensweges waren denkbar schlecht gewesen. Dass ich nun vom Radrennfahrer ausgerechnet zum Wasserwanderer mutierte, das ist nicht das Bemerkenswerte. Doch dass ich meine »Expeditionen« plante und unternahm, ohne die geringsten Erfahrungen im Wasserwandern zu haben, geschweige denn selbst ein Boot zu besitzen oder gelegentlich in einem gefahren zu sein, dafür bedarf es schon eines gewissen Grades von Verrücktheit. Somit sind nicht nur die teilweise abenteuerlichen Touren selbst, sondern auch deren Umstände das Salz in der Suppe. Denn jeder »Normale« hätte erst einmal klein angefangen und sich dann langsam an größere Brocken gewagt, anstatt, quasi aus dem Stand, gleich ein ganz »großes Rad« zu drehen.
Der Grobplan entstand noch im Krankenhaus (Armeelazarett) auf der Dresdner Loschwitzhöhe. Der ständige Blick auf das Elbtal sowie diverse Bücher hatten dann alles in eine bestimmte Richtung befördert. Wobei bereits in Kindheitstagen die Elbe auf mich eine magische Anziehungskraft ausgeübt hatte, sie bei verschieden Urlauben mit den Eltern für mich eine Art Abenteuerspielplatz gewesen war. Allerdings hatten die oben erwähnten Bücher aus dem Lazarett eine ganz andere Dimension als »nur« einen Fluss aufgezeigt, denn dort ging es um Weltumsegelungen, einer hatte sogar im Faltboot den Atlantik überquert …
Na gut, gewiss müsste man sicher erst einmal »klein« anfangen. Soviel Vernunft war schon da. Und dann … würde man ja sehen. Und jener ständige Blick auf meine im Tal fließende »Jugendliebe« gab dabei entsprechende »Hilfestellung« für den »Anfang«, der da lautete:
Das ganze Land von der Süd- bis zur Nordgrenze im Faltboot durchqueren, hieß die Parole, um die fortan nun alle Gedanken kreisten. Dass es auf der Elbe, anstatt gleich bis Hamburg oder Cuxhaven, nur bis zur Westgrenze ginge, das war für einen jungen DDR-Bürger unstrittig. Da gab es nichts zu überlegen. Auf den Mars konnte man ja schließlich (damals) auch nicht. Also bis maximal zur Havelmündung und dann »irgendwie« quer durch Mecklenburg bis zur Ostsee.
Und offene Ostsee ginge ja auch nicht, da würde scharf aufgepasst, dass keiner in den Westen abhaute, da kämen also maximal die Boddengewässer hinter dem Darß, hinter Rügen und Usedom in Frage. Im Prinzip wäre das landschaftlich wohl ohnehin viel spannender als die offene See, konnte man sich über diese Begrenzungen trösten.
Und wenn man sich die Karte genau anschaute, merkte man bald, dass es unter den damaligen Bedingungen quer durch Mecklenburg gar keine durchgehende Wasserverbindung bis zur Ostsee gab und es deshalb wohl ohne ein, zwei kurze Strecken Landtransport von nur wenigen Kilometern gar nicht ginge. Da müsste man dann vor Ort sehen, ob und wie das zu machen wäre.
Soweit der Grobplan. Ein Plan, der ausreichend Stoff für drei lange Studentenurlaube bot.
Denn während es im ersten Jahr »nur« bis zum Müritzsee ging, gab es Ostsee pur erst im zweiten Jahr. Und im dritten Jahr gleich noch einmal, dann auf anderer Route.
Unnötig zu betonen, dass besonders von den Eltern, die um die Gesundheit ihres gerade einigermaßen genesenden Sprösslings besorgt waren, von solcher Tour abgeraten wurde.
Unnötig zu betonen, dass derartige Ratschläge bei dem jungen Mann, der gerade vom Leben einen gehörigen Dämpfer bekommen hatte und der sich auch mit Hilfe dieser Tour moralisch wieder aufrappeln wollte, dass die gut gemeinten Ratschläge auf taube Ohren stießen.
Die Ausrüstung: Faltboot besorgen (RZ 85, gebraucht – auch DDR-Studenten hatten kaum Geld), dazu minimale Ausrüstungen wie Zelt, Kocher, Benzinkanister, Schlafsack (Von den Eltern »gesponsert«. Motto: »Wenn er sich die Tour schon nicht ausreden lässt, soll er wenigstens nicht frieren!«), Kartenmaterial, Informationen zur Binnenschifffahrt und anderes besorgen.
Dann im Hof, fernab von jedem Wasser, Bootsaufbau ausprobieren. Schien erstaunlicherweise zu klappen, nichts blieb übrig und alles sah hernach tatsächlich wie ein Boot aus. Als nächstes eine kleine Probefahrt auf »richtigem« Wasser. Klappte auch, das Boot war dicht und ließ sich auch mit den Paddeln bewegen, folgte einigermaßen erwartungsgemäß den Steuerausschlägen. Gewiss alles noch etwas unbeholfen, dilettantisch und auch über die Gebühr spritzend. Doch das würde man schon »irgendwie« hinkriegen.
Die »Mannschaften«: Zwei Kumpels waren in den ersten beiden Jahren deshalb nötig, weil nicht jeder der infrage Kommenden volle sechs Wochen unterwegs sein wollte oder konnte. Somit wurde für die erste Hälfte des ersten Jahres mein langjähriger Jugendfreund Heinz aus dem Nachbarhaus in Leipzig, für die zweite Hälfte mein Berliner Studienkollege Klaus erkoren. Im zweiten Jahr folgten zwei andere aus der Seminargruppe, wozu an geeigneter Stelle noch etwas kommt.
Mannschaftswechsel (im ersten Jahr) sollte in Genthin sein. Diese Stadt, die keiner von uns vorher kannte, war auf der Karte nur nach zwei Kriterien ausgesucht worden: Erstens, wie weit die erste Halbmannnschaft bis zum geplanten Wechsel etwa gekommen sein könnte, wozu dieser Ort natürlich Wasseranschluss haben musste (In diesem Fall, am Elbe-Havel-Kanal gelegen). Zum anderen musste zwecks Anreise von Klaus, beziehungsweise Abreise von Heinz Bahnanschluss gegeben sein. Somit konnte es nun also tatsächlich (und endlich!) losgehen. Exakt an meinem Geburtstag.
Und so ging es an diesem Tag in aller Früh und noch im Dunkeln in Leipzig los. Zunächst sollte es mit dem Zug nach Schöna als der letzten deutschen Station vor der tschechische Grenze gehen, dort so zeitig wie möglich der Bootsaufbau erfolgen und dann … ab die Post!
Das Boot hatte ich rechtzeitig vorher per Bahn nach Schöna geschickt.
Der Start schien jedoch zunächst ein gewaltiger Fehlstart zu werden.
Denn der erwähnte Freund Heinz, der gerade bei der Armee war – und man lebte ja in politisch sehr unruhigen Zeiten – dem wurde plötzlich sein (lange beantragter und auch genehmigter) Urlaub gestrichen. Plötzlich eine außerplanmäßige Großübung, hieß die Begründung. Nein, keine Ausnahme sei da möglich! Ende der Durchsage!
Was nun? Eigentlich kein Problem, möchte man meinen. Das Boot einfach zurückgeholt und drei Wochen später eben mit dem Klaus gestartet. Natürlich wäre dann in diesem Jahr nur die zweite Hälfte der geplanten Strecke möglich gewesen. Oder doch nicht? Sollte ich vielleicht die erste Hälfte gar allein fahren und alles beim geplanten Treffpunkt mit Klaus in Genthin belassen? Mutterseelenallein? Und als blutiger Wasserwanderanfänger und mit (damals noch) angeschlagener Gesundheit obendrein?
Doch gegen die geballte Kraft von Vorfreude und Spannung hatten alle die mehr als berechtigten Bedenken keine rechte Chance.
Und so ging es nun tatsächlich los. Allein!
Übersichtsskizze aus dem Original der sechziger Jahre
Der Start: Selbst hierbei begann zunächst alles etwas holperig, obwohl völlig harmlos im Vergleich zur Urlaubssperre des Freundes Heinz. Denn als ich frühmorgens, es war immer noch dunkel, mein Boot in Schöna von der Gepäckaufbewahrung holen wollte, machte mich der freundliche Beamte darauf aufmerksam, dass ich hier noch nicht aufs Wasser könne, weil das andere Ufer noch tschechisch sei. Ich müsse wieder eine Haltestelle zurück nach Schmilka-Hirschmühle fahren, da würde es gehen und der Zug in der Gegenrichtung würde glücklicherweise in wenigen Minuten kommen. Heute frage ich mich, wieso ich dem Hinweis gefolgt war. Denn das hieß ja Boot und alles Gepäck in den Zug reingehievt, eine Haltestelle gefahren und alles wieder raus. Und wenn ich im Morgengrauen die zwei, drei Kilometer dicht am deutschen Ufer entlang gepaddelt wäre, hätte doch kein Hahn nach mir gekräht. Schließlich war es nicht die Westgrenze, sondern die zur befreundeten Tschechei. Aber so war eben der junge, naive Durchschnitts-Ossi damals, und außerdem wollte ich nichts tun, was meine Pläne in irgendeiner Form gefährden könnte.
Jedenfalls, nach Ankunft in Schmilka – und immer noch im Morgengrauen – baute ich schließlich das Boot am Elbeufer zusammen, schob es ins Wasser, verstaute Zelt und alle andere Utensilien, nahm schließlich auf dem Hintersitz Platz und … tat die ersten Paddelschläge im braunen, damals merkwürdig duftenden und mit irgendwelchen Schnitzeln durchsetztem Elbewasser.
Das Gefühl dabei: Unbeschreiblich! So ähnlich musste wohl Neil Armstrong rund fünf Jahre später seinen ersten Schritt auf dem Mond empfunden haben.
Bei der Beschreibung der einzelnen Touren wird es kompliziert. Denn was war aus der Fülle von Einzeleindrücken und Erlebnissen besonders wichtig? Was würde in dieser stark gekürzten Form halbwegs die damalige Situation realistisch wiedergeben? Was dem »Expeditionscharakter« der Fahrten am besten entsprechen?
Zunächst wäre das Alleinsein auf der ersten Hälfte zu nennen. Nicht schlechthin allein zu sein, niemanden zum Austausch zu haben. Das war für mich, der ich vom Naturell her eher ein Individualist als ein Herdentier bin, nicht das Hauptproblem. Zudem die Eindrücke so stark waren, die Konzentration so gefordert wurde, da blieb nicht viel Platz für anderes. Auch die Grundregeln zum Befahren schiffbarer Gewässer, zuvor aus Büchern angelesen und in Form eines kleinen Handbuches mit an Bord, galt es nun umzusetzen. Das Verhalten beim Begegnen großer Frachtschiffe und anderer Sportboote, samt der dafür geltenden Vorfahrtsregeln, spezieller optischer und akustischer Signale, Zeichen an Brücken sowie das Verhalten bei (der damals noch häufigen) Gierfähren und anderes.
Das alles war kein wirkliches Problem. Das Problem begann erst abends oder wenn ich irgendwo zwecks Nachschub an Lebensmitteln oder Benzin für den Kocher in irgendein Dorf musste.
Dann musste ich alles allein lassen, hastete ins Dorf oder in das jeweilige Städtchen und hatte keine Ruhe bis ich wieder auf dem Elbedamm war und von fern erkannte, dass alles noch da war. Am Anfang war das wirklicher Stress, der sich glücklicherweise nach ein paar Tagen etwas legte. Doch als Risiko nahm ich es immer wahr, wenn ich einkaufen musste. Und falls es sich um Benzin für den Kocher handelte, reichte auch kein kleiner Dorfladen (die es heute gar nicht mehr gibt), sondern musste es dann eine kleine Stadt mit Tankstelle sein, auch wenn es sich bloß um einen 2-Liter-Kanister handelte. (Das erste Mal passierte das gleich am Nachmittag des ersten Tages in Pirna, denn ich hatte natürlich kein Benzin aus Leipzig mitgenommen.)
War das ausgestanden, kam die Nacht. Allein. Da wurde das Boot aus dem Wasser gezogen und ein Stück den Hang hochgebuckelt, man wusste ja als Anfänger nicht, wie schnell sich an einem Fluss die Wasserstände ändern könnten. Nach dem Zeltbau und nach dem Essen wurde dann – sicher ist sicher – zumindest während der ersten Tage, noch die Bootsleine durch den Zelteingang geführt und am … Fußknöchel festgebunden. Und ein Hirschfänger lag beim Schlafen immer in Griffweite. Nach ein paar Tagen ließ der nächtliche Stress allerdings nach und ich wurde gelassener. Und allgemein war das Alleinsein des Nachts beim »wilden« Zelten (damals) im Inland kein ernstes Problem. (Heute muss man das wohl anders sehen.) Zugegeben, anfangs war mir ein paar Mal mulmig zumute, als ich gegen den Nachthimmel ein paar Gestalten auf dem Elbedamm auf mich zukommen sah. Obwohl es sich wahrscheinlich dabei auch nur um Spaziergänger gehandelt hatte, für die mein Zelt wohl gar nicht interessant war, wenn sie es überhaupt bemerkt hatten.
Im Ostseeraum freilich galten ganz andere Regeln, über die noch zu sprechen sein wird.
Dass ich oft ungewollt und unwissentlich auf Kuhkoppeln oder gar auf Truppenübungsplätzen gelandet war, das war später eher die Regel als die Ausnahme. Im Gegenteil, mit Kühen wurde ich immer vertrauter und wusste bald, wie ich mit den teilweise neugierigen Tieren umzugehen hatte.
Nur einmal, viel später und bereits an der Ostsee, als wir bereits zu zweit waren, da wurde es ernster, obwohl wir noch mit einem blauen Auge davonkamen und wovon noch die Rede sein wird. Auch mit Truppenübungsplätzen hatte ich im Prinzip nur gute Erfahrungen. Einmal, ich war gerade an Land gegangen, um die Lage wegen eines Platzes für die Nacht zu peilen, da bemerkte ich hinter dem Deich erst in der Ferne eine Sturmbahn und dann unmittelbar vor mir einen sowjetischen Soldaten faul in der Sonne liegend. Es ist fraglich, wer von uns beiden mehr überrascht war? Wir rauchten eine Papirossa zusammen und ich konnte mein bescheidenes Russisch ausprobieren. Trotz beidseitiger Sympathie, dort gleich zu zelten, das hatte ich mir in Unkenntnis möglicher Reaktionen seiner Vorgesetzten dann doch verkniffen.
Dass es bei solchen, größtenteils positiv oder wenigstens glimpflich abgelaufenen Ereignissen auch Ausnahmen gab, wird sich zeigen. Ausnahmen, die das Potenzial eines worst case bargen und die wohl nur durch ein bisschen Glück zum dennoch guten Ausgang geführt hatten.
Soviel zum Thema Alleinsein auf der Elbe. Ein Thema, das zwar immer mehr an Bedeutung verlor, später sich sogar mitunter ein gewisser Leichtsinn einschlich.
Zur Streckenführung: Für jene, die entweder die durchfahrenen Gebiete kennen oder sich aus Interesse die Mühe machen wollen, alles anhand einer Karte zu verfolgen, seien nun ein paar Bemerkungen zur gesamten Streckenführung gemacht. Insbesondere, weil die beigefügte Übersichtsskizze (S. 20) hierfür kaum ausreichen dürfte. Und die anderen, denen diese Details nicht so liegen? Die müssen da eben durch, wofür sie jedoch mit besonderen Einlagen auf der Strecke entschädigt werden.
Vom beschriebenen Start in Schmilka/Sächsiche Schweiz ging es zunächst rund 440 Kilometer bis zur Havelmündung auf meiner »Jugendliebe«, der Elbe, entlang. Dresden, Meißen, Torgau, Wittenberg, Dessau, Schönebeck, Magdeburg, Tangermünde, Arneburg hießen die Städte die dabei eine gewisse Rolle spielten. Bei den Nebenflüssen, an deren Mündungen teilweise gezeltet wurde, waren es die Schwarze Elster beim Dorf Elster, die Mulde bei Dessau und die Saale bei Barby. Kleine und kleinste Flüsschen oder Bäche, die weiter keine Rolle spielten, bleiben außen vor.
Eine Besonderheit dieses Abschnittes scheint mir erwähnenswert:
Die Landschaft an der Elbe wird nach dem malerischen Weinanbaugebiet zwischen Dresden und Meißen etwas eintönig. Die Elbe fließt dort, an Riesa vorbei, mehr oder weniger zwischen zwei Dämmen, die man, im kleinen Boot sitzend, nicht überblicken kann. Jedoch etwa ab Wittenberg/Dessau wird die Landschaft richtig schön. Da fließt sie durch einen wunderschönen Auwald, bildet etwas weiter nördlich mit ein paar Altarmen ein bedeutsames Naturschutzgebiet. (Steckby-Lödderitzer Forst) Dort genehmigte ich mir sogar an einem wunderschönen Sandstrand an einem der Altarme eine Nacht und konnte da sogar das Wirken der letzten Elbebiber (damals fast ausgestorben) in Augenschein nehmen. Die »Hausherren« selbst allerdings nicht. Doch vorher hatte ich das erwähnte, weniger attraktive Stück hinter mich zu bringen. Wenn dazu noch »Kilometerfressen« angesagt ist, weil man bestimmte Ziele in bestimmter Zeit erreichen musste, (Stichpunkt: Treffpunkt mit Klaus in Genthin) da kam mir in der Höhe von Torgau, als der Tag zur Neige ging und ich mich hätte langsam nach einem Platz zum Zelten umsehen sollen, der Gedanke einer Nachtfahrt. Insbesondere hier die Ufer weitflächig mit großen Bruchsteinen stabilisiert worden waren und somit alles andere als zum Zelten einluden:
Also wurde noch mal richtig gegessen, die Spritzdecken festgezurrt und ab ging die Post. Eine helle Sternen- und Mondnacht verhieß einigermaßen gute Sicht und als einziges Risiko dachte ich an die Möglichkeit der Kollision mit Ketten von Gierfähren, die sich aber des Nachts ohnehin nicht in Flussmitte befinden würden. Dass es nach ein paar Stunden Fahrt plötzlich stockdunkel wurde und sich ein heftiges Gewitter entlud, das hatte ich nicht auf der Rechnung gehabt. Da das Gewitter urplötzlich losbrach und dazu von heftigem Sturm begleitet wurde, hatte ich nun die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder zu versuchen an Land zu kommen, mit dem Risiko, bei Dunkelheit, Sturm und Wellengang das Boot auf den spitzen Ufersteinen ernsthaft zu beschädigen – oder zu versuchen, das Gewitter im Boot so gut es ging »auszusitzen«, mit dem Risiko, zu kentern. Und das mulmige Gefühl der Blitze wegen, das versuchte ich (erfolgreich) zu verdrängen. Trotzdem, obwohl ein nächtliches Kentern im großen Fluss auch nicht einladend wirkte, es außerdem inzwischen bereits in Strömen goss, entschied ich mich für Letzteres, der Weiterfahrt.
Und – es ging einigermaßen gut. Das »einigermaßen« bezieht sich dabei nur darauf, dass ich zwar nicht kenterte und mich auch kein Blitz erschlug. Alles andere war jedoch kein Spaß. Denn trotz festgezurrter Spritzdecken saß ich nun bis zum Morgengrauen etliche Zentimeter hoch im Wasser, fror wie ein junger Hund, alle Sachen, einschließlich Ausweis, Geld etc. waren völlig nass. Frierend und hungrig baute ich an der Mündung der Schwarzen Elster nach insgesamt etwa 90 Tageskilometern (sonst auf der Elbe allein im Zweier etwa 30 Kilometer) das nasse Zelt auf, spannte Leinen zum Trocknen meiner Utensilien (für die Geldscheine hatte ich Klammern dabei) – und legte einen Ruhetag ein. Wobei das Wort »Ruhe« auch relativ zu sehen ist, denn ich war, wie später noch so viele Male, auf einer Kuhkoppel gestrandet. Dabei konnte ich feststellen, dass diese eher gemütlich wirkenden Milch- und Fleischlieferanten auch recht neugierig sein können. Doch, nachdem man sich gegenseitig soweit »kennengelernt« hat, dass man vom jeweils anderen nichts Böses zu erwarten hat, kann man sich arrangieren.
Nach dem erwähnten schönen Auwald ab Wittenberg, irgendwo nach Dessau, ereignete sich eine weitere, der weiter oben erwähnten Ausnahmen. Und war die Nachtfahrt noch auf eigene Entscheidung zurückzuführen, kam die folgende Ausnahme völlig unverhofft:
Da war ich zwischen zwei Buhnen an einem aus meiner Sicht schönem Strand an Land gegangen, ohne dem aufgewühlten Sand neben mir besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Das wäre fast ins Auge gegangen. War ich doch (wieder mal) auf einem Truppenübungsplatz gelandet und gerade in dieser Nacht war wohl eine Elbüberquerung mit Schwimmpanzern angesagt gewesen. Wie groß war mein Schreck als ich des Nachts durch mächtiges Gebrumm geweckt wurde, schlaftrunken aus dem Zelt schaute und nur ein paar Meter neben mir die dunklen Ungetüme, aus der Elbe kommend, die Böschuung hinauf brummten. Die Soldaten in den Panzern, egal ob NVA oder Sowjetarmee – das hab ich in der Dunkelheit nicht erkennen können – die hätten in der Nacht niemals mein kleines olivgrünes Zelt bemerken können. Das wärs dann gewesen und es hätte nicht mal für eine Schlagzeile in der Zeitung gereicht, weil derartige Unfälle geflissentlich unter der Decke gehalten wurden. Die Nacht war somit natürlich gelaufen. Nachdem der Pulsschlag sich wieder normalisiert hatte, blieb ich nicht nur solange neben dem Zelt sitzen, bis sich das Panzergedröhn verzogen hatte, sondern bis es begann hell zu werden. Auch dann war nichts mehr mit Schlafen, sondern es wurde gepackt, noch mal die Panzerspuren im Hellen »begutachtet« und dann ging es, nachdenklicher als die Tage zuvor, weiter.
Noch vor Barby und Schönebeck mündet links die Saale in die Elbe. Ich fuhr die Saale gleich »bergauf« ein paar hundert Meter, um dort auf einer Apfelplantage zu zelten. (Das nächste Frischobst gab’s dann erst wieder in Mecklenburg). Nach Magdeburg mit seinem gewaltigen Dom und dem recht hübschen Tangermünde2 kommt bald jene Stelle, wo es damals als DDR-Paddler absolut nicht mehr weiterging: Die innerdeutsche Grenze, die wohl damals am schärfsten bewachte Grenze in der Welt. Natürlich wäre ich die Elbe gerne weiter gefahren, doch das lag außerhalb jeglichen Vorstellungsvermögens.
Also würde es nun bald von der Elbe in die Havel gehen.
Welche »Abschiedszeremonien« da die Elbe mit meinem Boot zelebrierte, das zählte zweifellos zum Thema Ausnahmen, obgleich es dabei nicht ums Leben, jedoch um das jähe Ende der Fahrt gegangen war. Etwa in Höhe der Havelmündung, wo ich ja bald in diesen Fluss abbiegen würde, wollte mir die Elbe offenbar zeigen, dass auch ihr der Abschied von mir schwerfiel:
Beim morgendlichen Packen am letzten Platz an der Elbe in einer idyllischen Buhnennische (etwa gegenüber des Dorfes Werben) und ohne spürbare Strömung und Wind, hatte ich die Bootsleine des bereits im Wasser liegenden und schon weitgehend beladenen Bootes nicht extra festgebunden. Vor dem Start wollte ich hinter dem Damm noch etwas erledigen, was sich später im engen Boot weniger gut machen würde. Warum eigentlich hinter dem Damm? Niemand weit und breit. Seit dem letzten Großeinkauf vor Tagen hatte ich keinen Menschen gesehen. Na gut, so ist der einigermaßen zivilisierte Mensch eben. Jedenfalls, als ich wieder über den Damm kam, … war kein Boot mehr da. Das trieb in der Ferne auf dem Fluss und war gerade im Begriff hinter einer Kurve zu verschwinden. Da gab es nicht viele Möglichkeiten, außer alles stehen und liegen zu lassen und am Ufer elbeabwärts zu sprinten, was das Zeug hielt. Bis plötzlich … ein toter Wasserarm den weiteren Weg versperrte. Ohne groß zu überlegen, ob das vielleicht auch gefährlich sein könnte oder sinnvoll war, sprang ich somit ins Wasser und schwamm nun meinem Boot hinterher. Dass ich mit der Strömung schwamm, nützte mir dabei gar nichts, denn mein Abstand zum Boot wurde nur um soviel geringer als ich schneller schwamm als das Boot mit der Strömung trieb. Erst später kamen mir Zweifel. Denn klüger wäre gewesen, erstmal nur den toten Arm zu durchschwimmen und an dessen anderem Ufer dann an der Elbe weiterzurennen und so viel schneller wieder in Bootsnähe zu gelangen. So aber, längst war mein Startplatz hinter der Kurve verschwunden, hatte ich den Ausreißer nach geschätzten zwei, drei Kilometer angestrengten Schwimmens endlich ein, ging erst einmal an Land (was zudem noch das gegenüberliegende Ufer war) um mich von meinem »Langstreckenschwimmen« etwas zu erholen. Zum Glück war nicht nur das Gepäck schon im Boot gewesen, sondern auch das Paddel. (Was ich hätte machen können, wenn das Paddel noch nicht im Boot gewesen wäre – dazu fällt mir auch bis heute nichts Gescheites ein). Mühsam, weil nun gegen die Strömung, ging es dann zurück. Schließlich an meinem Startplatz angekommen, um dort die restlichen Utensilien einzusammeln, war der Vormittag gelaufen, mein Tagesplan nicht mehr zu schaffen. Noch ein paar Kilometer stromaufwärts in die Havel, bis wieder eine Kuhkoppel zum Zelten einlud. Na egal, noch mal gut gegangen!
Und das mit der nicht festgezurrten Bootsleine? Das passierte mir wirklich nicht wieder.
Und jener überraschende Wasserarm, der das weitere Rennen am Elbufer verhindert hatte?
Das war die frühere Havelmündung, nun nur ein toter Arm. Denn die Mündung hatte man aus Hochwasserschutzgründen in den fünfziger Jahren künstlich um etwa neun Kilometer elbabwärts (Gnevsdorf) verlegt, so dass Elbe und Havel nun dieses Stück, nur durch einen Damm getrennt, fast parallel nebeneinander flossen. Auch dieser zusätzlichen neun Kilometer wegen (für mich natürlich 18), konnte ich, zusammen mit der verlorenen Zeit meines »Schwimmwettkampfes« in der Elbe, mein ursprüngliches Ziel, das etwa in der Gegend von Rathenow hätte sein sollen, an diesem Tag nicht mehr erreichen. Und anstatt dann am Tag darauf schon in Genthin landen zu können, machte ich notgedrungen bereits am Rand von Havelberg Station. Die Stadt an der Havel wählte ich nur deshalb, weil ich dort einen Bahnhof vermutete, von dem aus ich sicher würde Genthin erreichen können.
Die Havel, eigentlich ein idealer Wanderfluss, wegen geringer Strömung auch flussaufwärts, hatte (damals) für mich nur den einen Haken, dass sie auch durch (das damalige) Westberlin führte. Womit wir wieder beim Thema Westgrenze wären.
Es gab da zwar einen Umgehungskanal um Westberlin und ich hatte mir sogar vorher von der Behörde eine schriftliche Genehmigung geholt, um diesen Kanal befahren zu dürfen. (Havel-Kanal, etwa Ketzin bis Hennigsdorf) Ursprünglich – deswegen die Genehmigung – war diese Route ja sogar geplant gewesen. Obwohl, ein paar Tage lang auf schnurgeraden Kanälen zwischen zwei Dämmen zu paddeln, das war gewiss nicht die erste Wahl. Doch gab es eben noch einen anderen, viel wichtigeren Grund, diese Möglichkeit nun zu ignorieren und nach einer anderen zu suchen.
Dieser andere Grund war, nach bisher fast drei Wochen Alleinseins, meinen Studienfreund Klaus auf dem Bahnhof Genthin abzuholen. So wie wir es Wochen zuvor, über Landkarten und Zugfahrpläne gebeugt, abgestimmt hatten: Samstag, den 15. 08. 1964, gegen 16 Uhr! Und Handys gab es damals noch lange nicht, da war schon ein normales Telefon nur etwas für Privilegierte. Da musste man noch klug und vorausschauend planen.
Und eine Gewalttour mit Nachtfahrt, wie schon mal bei Torgau, die wäre theoretisch noch möglich gewesen, um Genthin zu erreichen. Doch hier auf der Havel mit ihren vielen Nebenarmen, Ausbuchtungen und Seen – bei Nacht für einen einsamen Paddler ein aussichtsloses Unterfangen.
Also musste ich wieder Zelt, Boot und Ausrüstung, diesmal jedoch ganztags, alleine lassen und versuchen, irgendwie nach Genthin zu kommen. Wie sich herausstellte gab es von Havelberg aus diese vermutete Bahnverbindung gar nicht, die gab es erst vom etwa fünf Kilometer südlich gelegenen Sandau aus.
In Kürze: Irgendwie und etwas abenteuerlich (teilweise per Anhalter mit drei Nonnen im Auto) gelangte ich gerade noch so zur Zeit nach Genthin, traf Klaus, wir kamen auch am gleichen Tag gegen Abend wieder zurück nach Havelberg und – freudiger Schreck lass nach! – alles war unversehrt. Nicht mal die Kühe auf dem (natürlich wieder) wilden Zeltplatz hatten Interesse gezeigt.
Nun ging es zu zweit weiter, was manches einfacher und unkomplizierter machte sowie – besonders auf künftig stehendem oder nur schwach fließendem Wasser – größere Fortschritte beim »Kilometerfressen« versprach.
Aus genannten Gründen – das Boot lag ja nun nicht wie früher geplant in Genthin, sondern in Havelberg – musste eine notwendigerweise veränderte Streckenführung ausbaldowert werden. Das hieß, nun nicht ab Genthin über Elbe-Havel-Kanal und dem erwähnten Umgehungskanal um Westberlin wieder in die Havel, sondern weiter nördlich »irgendwie« auf Schleichwegen in Richtung märkische Seen.
Da bot sich, zumindest auf der Karte, als Möglichkeit der Abzweig von der Havel zum Gülper See und der Rhin-Kanal nach Wustrau am Neuruppiner See an.
Im Nachhinein keine empfehlenswerte Idee, doch das wussten wir zum Glück vorher nicht. Nicht der eintönigen Landschaft durch das Rhiner Luch (Rhinow, Fehrbellin) wegen, sondern dort warteten sage und schreibe auf nur etwa 30 Kilometer 11 Wehre (in Worten: Elf!) darauf, umtragen zu werden. Eine schweißtreibendes, nicht problemfreies, vor allem ein zeitraubendes Unterfangen. Und die Stimmung killte es obendrein. Statt des geplanten einen Tages brauchten wir bis Wustrau zwei volle Tage.
Irgendwie war es dann doch geschafft und wir befanden uns am Beginn eines wahren Wassersportparadieses.
Waren es die Anstrengungen, das heiße Wetter oder was auch immer, jedenfalls fühlte ich mich am Abend schlapp wie ein nasser Sack, hatte schwere Glieder, dröhnenden Kopf und sogar Fieber. OK, das kann schon mal passieren, normalerweise kein Grund extra darüber zu schreiben. Das Attribut »normalerweise« traf jedoch für mich mit meiner einjährigen Krankenhausvorgeschichte nicht zu. So hatte damals auch alles angefangen und ich war ja gerade noch so von der Schippe gesprungen. (S. »Sternstunde«). Das war wirklich keine gute Nacht, die ich nun erlebte und in der ich mir ausmalte, wie nun weiter, falls es doch wieder … Am nächsten Tag überredete ich Klaus, der von meiner Krankenhaus-Vergangenheit kaum wusste, zu einem Ruhetag. Die wunderschöne Gegend und die Anstrengungen der letzten beiden Tage erforderten keine weiteren Erklärungen. Und am übernächsten Morgen schien zum Glück alles wieder in Ordnung. (Und blieb es bis zum Ende der Reise und es blieb für mich auch unerfindlich, was mich da so kurzzeitig umgehauen hatte und was mir glücklicherweise nicht auf den tagelang einsamen Elbeetappen widerfahren war.)
Und so ging es also weiter.
Jeden der vielen durchfahrenen Seen, Kanäle und Fließe, vom Ruppiner See über die Rheinsberger und Zechliner Gewässer bis zum gewaltigen Müritzsee nun einzeln zu beschreiben, ginge in dieser Kurzversion zu weit.
Wobei für Paddler die kleineren Gewässer und ihre Verbindungskanäle ohnehin sehr viel interessanter sind als die großen, schiffbaren Seen, besonders bei Wind. Die Landschaften sind traumhaft, für Naturfreunde gibt es immer mal wieder ein »Leckerli«, ob nun Seeadler, Reiher(damals noch selten) oder gar Eisvögel. Gelegentlich kommt ein Wehr, das jedoch hier im Wasserwanderparadies nur in seltenen Fällen umtragen werden muss. Oft gibt es dafür Bootsschleppen, kleine Selbstbedienungsschleusen oder auf schiffbaren Gewässern auch die offiziellen Schleusen bei denen man sich entweder an die offiziellen Schleusenzeiten halten … oder den Schleusenwärter mit einer Kleinigkeit »bestechen« musste.
Mitunter sind einige der Fließe so klein und flach, dass man, falls man dazu überhaupt jemanden (Müller oder Schleusenwärter) findet, zum Befahren Zuschusswasser erbitten muss. (Rheinsberger Rhin), um überhaupt fahren zu können. Andernfalls man im Wasser »wandern« und das Boot hinterherziehen muss. (Eine völlig andere Auslegung des Wortes »Wasserwandern«) Mitunter, besonders im nächsten Jahr im Gebiet nördlich der Müritz, kam es auch vor, dass quer über einen mickerigen Fließ oder Bach die Latten eines Weidezauns die Weiterfahrt erschwerten, hinter denen … Kühe im Wasser standen, um zu trinken. Andernorts fuhr man auf einem schmalen Rinnsal durch ewige Schilfwände, bei denen man sich rechts und links mit dem Paddel nicht im Wasser, dafür war es zu schmal, sondern nur noch am Schilf abstoßen musste.
Daneben warten jedoch auch noch andere zeitraubende »Einlagen«:
Sind zwei Seen durch einen schiffbaren Kanal verbunden, dann kann man in den meist unvermeidlichen Schilfrändern die Ein- und Ausfahrten weithin sichtbar durch gewisse Baken erkennen. Kein Problem also die jeweilige Ausfahrt zu finden. Ganz anders, wenn Verbindungen nicht schiffbar sind. Dann wird die Suche nach der Ausfahrt zum Roulette. Wenn man glaubt, eine Lücke im Schilf oder Baumbestand entdeckt zu haben, welche die Ausfahrt sein könnte und volle Kraft voraus in den Schilfgürtel reinfährt, wird man oft (um nicht zu sagen, meist) enttäuscht. Man bleibt stecken, muss aussteigen, bis zum Knie oder auch schon mal bis zum Gürtel im Schilf waten und es erneut an anderer Stelle versuchen. Irgendwann wird man doch mal fündig. Hat man somit den nächsten, der meist kleineren Seen erreicht, hat man diesen in zwar nur kurzer Zeit überquert, um dann wiederum ewig nach dessen Ausfluss zu suchen. Ein paar Mal haben wir für dieses unangenehme, zeitraubende Spielchen Stunden gebraucht. Wenn dazu noch Gemeinschaftsarbeit von Sonne und Mücken angesagt ist, also beide stechen oder es dabei regnet, dann kann man sich gewiss Angenehmeres vorstellen.
Wer jedoch so verbissen an einem »Expeditionsziel« arbeitet, der muss da eben durch. Wenn man sich durchgebissen hat, anfangs ungewohnte Dinge und Situationen zur Tagesroutine geworden sind, dann erreicht man eben auch sein Ziel. Das jedoch hieß im ersten Jahr Waren am Müritzsee. Genau an dieser Stelle sollte es im nächsten Jahr zur zweiten Etappe bis zur Ostsee auch wieder losgehen.
Auch die Müritz hätte wirklich etwas mehr als nur ein paar dürre Sätze verdient. Mit knapp 20 Kilometer Länge und etwa 14 Kilometer Breite fast schon ein kleines Meer. Als wir, von Mirow aus kommend, im Süden einfuhren, hatten wir den See in voller Länge vor uns. Durch den hochsommerlichen Dunst an diesem Tag verschwammen die Nordufer im Nichts und wir kamen uns zeitweise wirklich wie auf dem Meer vor. Zwei Tage blieben uns noch. Am Westufer ging’s in zwei Etappen nach Norden (1.Zielow/Kuhkoppel, 2.Klink/Kuh-koppel). Am zweiten Tag mit unserem kleinen Treiber (Segel) sogar ohne einen Paddelschlag! Den Treiber hatte ja Klaus zusammen mit seinem Paddel mit der Bahn mit nach Genthin gebracht. Diese Segeltour war noch mal ein krönender Abschluss dieses ersten Jahres.
Insbesondere es für uns beide der erste Segelversuch überhaupt war.
***
Genau hier in Waren ging’s also im nächsten Jahr wieder los. Nun jedoch nach Westen und diesmal mit einem anderen Studienfreund (Uwe). Bereits am Nordufer des ersten der großen Seen, des Kölpinsees, bogen wir nach dem Wisentschutzgebiet Damerower Werder nach Norden zum Jabelschen See ab. Schließlich hieß das Ziel ja Boddengewässer der Ostsee. Da konnte man sich nicht nach Schönheit und Bequemlichkeit richten. Da würde man wieder durch so manches Nadelöhr müssen.
Sechs Seen gibt es von diesem Abzweig aus nach Norden, deren Verbindungen immer kleiner werden, zum Schluss nur noch den Charakter eines Straßengrabens haben und meist auch total verschilft sind. Waten und Boot ziehen sind somit etliche Male angesagt. Bis es dann wirklich nicht weitergeht (Dorf Klocksin) und man ein paar Kilometer über Land bis in den Malchiner See muss. Kurz zuvor ging es unter einer Straße sogar nur durch eine große Betonröhre. Da waren wir schon froh, das Boot im knöcheltiefem Wasser gerade noch ziehen zu können und damit der Schlepperei zu entgehen. Doch das Ziel aufgeben und stattdessen lieber in hübscher Umgebung einen gemütlichen Wasserwanderurlaub absolvieren, das kam keinem von uns beiden in den Sinn.
Über ein Pferdefuhrwerk ließ sich der zwar kurze, jedoch unumgängliche Landtransport von etwa reichlich fünf Kilometer reibungslos organisieren. Mit dem recht großen Malchiner See waren wir nun ins Einzugsgebiet der Peene, damit jenseits der Wasserscheide Nord-/Ostsee gelangt. Die Peene brachte uns bald zum noch größeren Kummerower See, der einem bei Wind schon gehörig Respekt einflößen kann. (Knapp 10 Kilometer lang, etwa 4 Kilometer breit) Doch schon in Demmin verließen wir die Peene wieder – der wir am Ende der Fahrt bei Anklam noch mal begegnen würden – und bogen nordwärts in die Trebel ein. Wie schon die Peene, mäandert auch die Trebel als typischer Flachlandfluss gemächlich durch die Landschaft. Einsamkeit pur. Man paddelt angestrengt, kommt aber auf der Karte durch die vielen Flussbögen nur langsam voran. Dann noch einmal ein ähnlich kurzer Landtransport (Bad Sülze) von der Trebel in die Recknitz, diesmal mit einen LPG-Fahrzeug. Da sag einer, die Mecklenburger wären zugeknöpft und stur. Wir hatten jedenfalls davon nichts bemerkt.
Auch die Recknitz ist ein ähnlicher Flachlandfluss wie zuvor die Trebel. Allerdings wartete sie mit einer neuen, unvorhergesehenen Einlage auf, deren Überwindung einen gewissen Einfallsreichtum erforderte:
Die Ufer sind hier meist so flach, aufgeweicht und wabernd, dass die Bauern das Schilf (Stichwort: Reetdächer) nicht vom Ufer aus ernten können. So erfolgt es eben per Boot vom Wasser aus. Das geschnittene Schilf treibt dann langsam den Fluss entlang, bis es sich an einer Drahtsperre hunderte Meter lang staut und von dort irgendwie und irgendwann mal geborgen wird.
Für den normalerweise nicht schiffbaren Fluß ist das für niemanden ein Problem. Wir dagegen mussten durch dieses, von Ufer zu Ufer reichende Schilfbett »irgendwie« durch. Und bei Länge der Staustrecke und der Beschaffenheit der Ufer war ein Umtragen keine praktikable Alternative. Und so kämpften wir uns mühsam durch den „Schilfbrei“ hindurch, verloren dabei soviel Zeit, dass wir zudem hier auch noch nach einem einigermaßen akzeptablen Zeltplatz suchen mussten. Allzu zimperlich durften wir dabei freilich nicht sein, wir waren schon zufrieden als am folgenden Morgen neben der Luftmatratze nicht Wasser gluckerte.
Doch ein Blick auf die Karte zeigt es und wischte alle Bedenken für die Auswahl dieser beschwerlichen Route weg – denn die Recknitz fließt schließlich bei Ribnitz-Damgarten in den Saaler Bodden, damit quasi in die Ostsee. Womit wohl auch der Sinn der beschwerlichen Übung klar sein sollte.
Noch ein Wort zum ständigem »wilden« Zelten. Im Binnenland war das für Wasserwanderer, die ja in der Regel am nächsten Tag wieder weg sind, im Prinzip kein Problem. Natürlich nur, wenn man keine ausgewachsene Abneigung gegen Kühe hatte. Und außerdem gab es nicht allzu viel »Verrückte« die an den unmöglichsten Stellen zelten wollten oder mussten.
Gewiss hätte man in Mecklenburg auch damals gelegentlich einen offiziellen Platz finden können, wenn der zum Strecken- und Zeitplan gepasst hätte. Das aber wäre unter den Prämissen dieser Tour wenig wahrscheinlich gewesen. Zum anderen war man ja schließlich Student und hatte – das war auch damals schon so – natürlich kein Geld. Da konnte man die Zeltplatzgebühren lieber in ein Brot, ein Stück Speck oder Dosenwurst, eine kochfertige Suppe und eine Flasche Bier investieren, um mal kurz das lukullische Durchschnittsangebot auf der Fahrt anzureißen. Von selbst »geerntetem« Obst und Gemüse mal abgesehen. Wozu jedoch, zumindest zwischen den Deichen der Elbe, relativ wenig Gelegenheiten waren. Das wurde erst in Mecklenburg besser und damit der Speiseplan reichhaltiger.
Ganz anders war’s mit dem Zelten an der Ostsee und deren unmittelbarem Hinterland.
Das war nach DDR-Sprachregelung Grenzgebiet, dort galten die bekannten, strengen und allerstrengsten Regelungen. Dagegen zu verstoßen, brachte einen nicht nur in den Verdacht zur Republikflucht, sondern das konnte auch ganz schnell die Bekanntschaft mit Gitterstäben zur Folge haben. Je wahrscheinlicher, je näher man sich »unbefugt« an der Westgrenze herumtrieb.
Andererseits waren offizielle Zeltplätze an der Ostsee so begehrt, dass man sich schon im Januar darum bemühen musste, um eine ohnehin nur geringe Chance zu haben. Bei dem Gesamtkonzept dieser »Expeditionen« also keine praktikable Option.
Also blieb hier erst recht nur das »wilde« Zelten. Nur dass die Plätze hierfür so sorgfältig ausgewählt werden mussten, um auf keinem Fall »erwischt« werden zu können. Denn das hätte leicht das Ende der Fahrt (und mehr) bedeuten können. Am sichersten fühlten wir uns deshalb … unter Kühen. Je mehr, je besser, denn dann kam in der Regel kein Mensch hin.
Gleich am ersten Abend nach der Mündung der Recknitz in den Saaler Bodden wär's fast schief gegangen. Des Risikos zwar bewusst, aber nach langem schwerem Tag todmüde, gingen wir dennoch nördlich von Dierhagen/Wustrow (bereits auf dem Darß, also in „gefährlichem“ Gelände) an Land und wollten gleich am Morgen aus der Gefahrenzone raus über den Saaler Bodden in Richtung Born.
Kaum stand das Zelt auf verwildertem, einsam scheinendem Gelände, da lautete eine unfreundliche Message: »Wenn ihr in einer Stunde nicht weg seid, komm ich mit der Polizei wieder.« Da half kein Bitten und Erklären, dass man doch nur … schon spät, … zu starker Wind … etc.
Also alles wieder gepackt und bei gefährlich starkem Wind erstmal direkt rüber Richtung Festland. In der Abenddämmerung merkten wir, dass wir wahrscheinlich unvermutet (und auch unentdeckt?) auf einem NVA-Flugplatz oder in dessen unmittelbarer Nähe gelandet waren. Zumindest ließen die laufend startenden und landenden Düsenjäger derartige Schlussfolgerung zu. Am nächsten Morgen ging’s deshalb sofort weiter nach Nordost, Richtung Born/Darß. Beim Näherkommen winkte auf der Festlandseite eine »vertrauensbildend« ausschauende … Kuhkoppel, diesmal nicht mit dutzenden, sondern mit hunderten von Kühen. Dass jenes »vertrauensbildend« etwas voreilig war, merkten wir am zweiten Tag, als wir vom Großeinkauf drüben in Born zurückkamen. Am Platz, wo unser Zelt stand, konnten wir aus der Ferne zunächst nur Kühe ausmachen. Beim Näherkommen sahen wir, dass einige diese fremde Etwas als durchaus zum Spielen geeignet erkoren hatten und unser Zelt nur noch einem Häufchen Unglück ähnelte. Doch ließ sich glücklicherweise alles wieder akzeptabel zurechtbiegen und -flicken. Und die Tiere waren ja keinesfalls bösartig, nur neugierig und unternehmungslustig. Und selbst in diesem traurigen Moment gab es Tröstliches, fast schon Spaßiges. Denn bald mussten wir laut lachen, nachdem wir gelernt hatten, die Kühe mit lautem Hundegebell in die Flucht zu schlagen. Nur dass wir uns nun nicht mehr getrauten, länger vom Zelt wegzubleiben. Denn solange wir in der Nähe waren, konnten wir mit unserer »Hundegebell-Nummer« alles recht zuverlässig im Griff halten. Gegen Abend hatten die Tiere mit dem Wiederkäuen ohnehin Wichtigeres zu tun, wozu sie sich in Massen um uns herum ins Gras legten und erst gegen Morgen wieder mobil wurden.
Doch wurde das ab dem nächsten frühen Morgen sowieso unwichtig. Denn was wir an diesem Tag vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit erlebten, da komme ich heute noch ins Schwärmen. (Und der Name »Sternstunde« ist ja im Buch leider schon vergeben.)
Da ging es vom Saaler Bodden hinter dem Darß, über Koppelstrom, Bodstedter- und Barther Bodden, dem riesigen Grabow in Richtung Rügen. Schließlich zur Linken an der Insel Bock, später der Südspitze von Hiddensee, dem Gellen, vorbei, weiter über den Kubitzer Bodden in den Strelasund hinein bis zunächst Altefähr auf Rügen (gegenüber von Stralsund).
So wie schon beim Müritzsee, so wären auch die Touren über die Boddengewässer einen extra Abschnitt wert. Trotzdem, ein paar besondere »Leckerlis« sollten schon sein.
Bemerkenswert an dieser Etappe, die ganze Tour von der Riesen-Kuhkoppel gegenüber Born bis Altefähr, etwa 65 Kilometer, absolvierten wir ohne einen Paddelschlag, bei idealem Wind nur mit dem Treiber bei anfangs leichten, über den Tag immer stärker wehendem Westwind.
Der östliche Teil des Darß, die Insel Bock und andere kleine Inseln waren schon damals bedeutende Naturschutzgebiete. Wir merkten davon, indem wir dort unversehens plötzlich in einer riesigen Herde von Wildschwänen fuhren. Kein ungefährliches Unterfangen, falls diese gerade Junge führen würden. Da wir nicht paddeln brauchten, ließen wir uns mucksmäuschenstill durch die Herde treiben und waren sowohl begeistert über das Erlebnis, doch auch etwas erleichtert, nachdem wir wieder aus der Herde heraus waren. Die allerdings hatte uns mit absoluter Missachtung gestraft.
An der Südspitze von Hiddensee, wo von der offenen See bereits recht hohe Wellen hereingerollt kamen, erhielten wir Besuch von einem Polizeiboot, die sich vergewissern wollten, dass wir keine »Dummheiten« vorhatten und wirklich nur in Richtung Stralsund wollten.
Später, irgendwo im Kubitzer Bodden, wurde plötzlich die Ostsee so flach, dass wir aussteigen und unser Boot im nur knöcheltiefem Wasser ziehen mussten. Nicht nur ein kurzes Stückchen, nein, es war eine richtige »Wasserwanderung«, diesmal im Wortsinn. Zur Rechten in der Ferne das Festland, zur Linken, auf Grund der Größe des Boddens, die (scheinbar) offene See. Irgendwann wurde das Wasser wieder tiefer, in der Ferne erkannten wir auch die Betonnung der Schiffahrtsrinne wieder und segelten nun bei straffem und immer stärker werdendem Wind und beängstigend hohem Wellengang (und ohne Seitenschwerter!) bis Altefähr, wo uns kurz vorm Ziel bei einer starken Bö sogar noch der Mast brach. Es mutete an, als wolle das Schicksal nach diesem wundervollen Tag noch mal zeigen, dass es auch anders könne. Doch ging bis auf den gebrochenen Mast, den wir später notdürftig reparierten, erstaunlicherweise doch noch alles gut und erschöpft und verbrannt aber glücklich bauten wir abseits vom Zeltplatz (wo sonst)Altefähr unser Zelt.
Ich habe später wiederholt versucht, jene »Wanderstrecke« in der Ostsee exakt zu lokalisieren. Es ist mir nicht zufriedenstellend gelungen, beziehungsweise blieb es immer widersprüchlich.
*
In Altefähr fand ein vorher fest geplanter Mannschaftswechsel statt, der an sich schon einen gewissen Höhepunkt der Reise darstellte. Höhepunkt nicht etwa, weil Uwe, der mir auf der Fahrt ein so toller Kumpel gewesen war, nun am nächsten Tag nach Hause fahren würde. Und zuvor hatte ich mit ihm noch den »Ersatzmann« vom Bahnhof abgeholt. Das Besondere dieses Wechsels bestand darin, dass es sich dabei weder um »Ersatz-« noch um »-mann« handelte, sondern um ein Mädchen (Marlies) unserer Seminargruppe, die später sogar meinen Familiennamen annahm und Mutter meiner zwei Töchter wurde. Doch weil das hier schließlich keine Familiengeschichte, sondern die Beschreibung einer außergewöhnlichen Reise werden soll, wird hier auf die weitere Ausschmückung dieser neuen Situation mit Details verzichtet.
Außer, dass wir versuchten, in den letzten zwei Urlaubswochen, nun in unmittelbarer Tuchfühlung zur Ostsee, noch etwas wie Urlaubsfeeling einzubauen. Soweit das eben unter den gegebenen Umständen ging.
Weiter ging es nun also mit »gemischter Mannschaft« durch den Strelasund südostwärts über die Hauptstationen Greifswalder Bodden, Peenestrom bei Wustrow, Achterwasser von Usedom bis schließlich in die Mündung der Penne bis zur Endstation Anklam. Jener Fluss, wo wir ja Wochen zuvor – damals noch mit Uwe – bei Demmin nach Norden in die Trebel abgebogen waren.
Besonders erwähnenswert auf diesem Abschnitt: Die Überfahrt über den riesigen Greifswalder Bodden. Bei hochsommerlichem Dunst und nahezu völliger Windstille fuhren wir, von der Rügenschen Seite aus kommend (Palmer Ort/Zudar), etwa eine Viertelstunde ohne Landsicht, ehe im Süden, zwischen Dänischer Wiek und Lubmin, etwa in Richtung des Dorfes Vierow/Gahlkow, in der Ferne Land auftauchte. Natürlich kann man so etwas im Paddelboot nur bei entsprechend ruhigem Wetter machen und bei normaler Sicht würde man das Land ja auch sehen. (Andernfalls hätten wir uns auf der Festlandseite von Stahlbrode aus, an der Insel Koos vorbei, in Richtung Lubmin an Usedom heranpirschen müssen.)
Anfangs im Peenestrom, später im Achterwasser von Usedom gab es noch ein paar Zeltprobleme unterschiedlichster Art. Zunächst hatten wir nach unserer »Hochseefahrt« noch einen nahezu idealen Zeltplatz unmittelbar am Strand des Greifswalder Boddens (Nähe Spandowerhagen). Dort erwartete uns ein majestätisch auf der Abbruchkante thronender Seeadler, der uns wohl erst als bedrohlich zur Kenntnis nahm und abflog, als wie uns im Boot aufrichteten, um an Land zu gehen.
Die absolute Einsamkeit, was Menschen betrifft, und das tete à tete mit dem Seeadler hatten wir dem dortigen Naturschutzgebiet zu verdanken. Was wir allerdings vorher nicht gewusst hatten, erst der Adler brachte uns auf die Idee. (Unliebsame Besucher hatten wir dadurch auch kaum zu befürchten.)
Dann aber wurde es am nächsten Tag im Peenestrom weniger angenehm und auch nicht ungefährlich. Denn nach langem, vergeblichem Suchen in total verschilften Ufern mussten wir irgendwo nördlich von Wustrow, weil es langsam dämmerte, notgedrungen mit einem winzigen, unverschilften Inselchen als Bleibe für die Nacht vorlieb nehmen. Auch diese »Handvoll« Erde, die da aus dem Wasser guckte, war jedoch so flach, dass wir, der schnell fahrenden und somit beängstigend große Wellen verursachenden Marineschiffe wegen, kaum ein Auge zubekamen. Hinzu kam, obwohl wir mückenmäßig einiges gewöhnt waren, aber einen solch massiven Angriff von ganzen Myriaden auf jedes Stück freie Haut, selbst durch die schnellstens angezogenen Trainingssachen hindurch, hatten wir noch nie erlebt. Und wenn nicht schon die Dämmerung hereingebrochen wäre, hätten wir garantiert vor den blutdürstigen Horden noch die Flucht ergriffen. Auch trug unsere Unkenntnis, in welchem Maße hier die Wasserstände schwanken könnten, dazu bei, dass wir den Morgen zur Weiterfahrt kaum erwarten konnten. Der nächste Tag sollte somit ein ganz ruhiger in der Nähe des Dorfes Ziemitz (Achterwasser/Usedom) werden. Dorflümmels, die wohl glaubten, bei dem dort in der Wildnis zeltenden Pärchens irgendwelche »spektakulären« Beobachtungen machen zu können, verhinderten das jedoch. Zudem hätte unsere primitive Zeltbeleuchtung, die nur aus brennenden Kerzen bestand, dabei fast das Zelt abgefackelt. Die neugierigen »Lümmels« waren zum Glück nur Halbstarke oder noch Kinder gewesen, welche sofort, als ich wutentbrannt aus dem Zelt stürzte, die Flucht ergriffen. Sonst hätte wohl alles auch anders ausgehen können. Der Brandfleck wurde am nächsten Morgen notdürftig geflickt und dann nichts wie weg von diesem ungastlichen Fleck.
Nun war klar, dass der nächste Platz wohl der diesjährig letzte sein würde. Und anstatt, wie zunächst geplant, dafür Lütow oder Görmitz, beides noch recht weitab der Ostsee, anzusteuern, wurden wir noch mal »ganz mutig«. Und so ging es direkt auf das kleine Halbinselchen bei Loddin, unmittelbar auf der Boddenseite hinter Koserow, Kölpinsee und Ückeritz zu. Und obwohl unser Platz gar nicht besonders gut versteckt lag, sogar mit einem »eigenen« kleinen Sandstrand aufwartete, der wohl auch manchen Spaziergänger (oder Schlimmeres) hätte anziehen können, ging alles gut und wir hatten noch ein paar abschließende Erholungstage an der »richtigen« Ostsee. Und mit der 60 Meter hohen Steilküste des Streckelberges dazu noch an einer der spektakulärsten Stellen der ganzen Insel. Eine Stelle, die mich bereits in jüngeren Jahren schon einmal so fasziniert hatte und an die ich Jahrzehnte später unversehens nochmals unter völlig anderen Umständen erinnert werden sollte. (Geschichte »Niagarafälle«) Und wenn wir nachmittags oder abends von der Ostsee zurückgewandert kamen, fanden wir am Zelt nicht nur alles unversehrt vor, sondern wir wurden auch durch keinen unerwünschten, eventuell sogar uniformierten Besuch beglückt.
Nach diesen geruhsamen letzten zwei, drei Tagen, ging’s dann noch mal quer über das Achterwasser in Richtung Peenemündung und noch ein paar Kilometer den Fluss »bergauf« bis Anklam, wo wir bereits in dunkler Nacht am dortigen Bahnhof die auch in diesem Jahr wieder ereignisreiche Tour beendeten.
Damit war das eigentliche Ziel, die völlige Durchquerung der DDR im Faltboot, im Prinzip »abgearbeitet« gewesen.
Doch hatte das vorausgehende Kartenstudium ja ergeben, dass es da noch eine andere Möglichkeit gäbe. Zwar wären mit den damaligen Möglichkeiten nicht die Boddengewässer erreichbar, doch bis in den Rostocker Hafen würde man, wenn alles gut ginge, auch kommen können? So die Idee!
***
Und so ging es im Folgejahr zum dritten Mal los. Diesmal wieder mit jenem Klaus, der schon die zweite Hälfte des ersten Jahres (Stichwort: Treffpunkt Genthin) unverwüstlich absolviert hatte und sich durch neue in Aussicht stehende Unwägbarkeiten wohl nicht abschrecken ließ.
Wie bereits kurz erwähnt, ging es auch wieder in Waren an der Müritz los. Diesmal jedoch durch die komplette »Herzkammer« des Wassersports, über Kölpin-, Fleesen-, Malchower- und Petersdorfer See bis zum Plauer See.
Auf dem Plauer See schafften wir sogar, was uns bisher erspart geblieben war:
Als wir, quasi als Einstand zur diesjährigen Tour, mal wieder segelten … kenterten wir! Hatten wir sogar unsere Supertour über die Boddengewässer vom Vorjahr erfolgreich ohne die Seitenschwerter des Bootes gemeistert, (Die hatten wir aus Platz- und Gewichtsgründen dieses Jahr gar nicht mitgenommen), so erschien uns das auf den »doch nur« Binnenseen erst recht nicht notwendig. Wo wir doch auf dem Saaler Bodden und im Strelasund regelrechten Sturm »ohne« bestanden hatten. Profis wissen, dass nicht die Stärke des Windes, sondern die Konstanz seiner Richtung das Wichtigste dabei ist. Und genau deshalb meist Binnenseen oft tückischer sind als offene See. Leider kenterten wir nach einer extrem starken Bö am Westufer nördlich von Plau, während unser Zelt (natürlich wieder »schwarz«) am Ostufer in der Nähe von Zislow stand, was alles nicht einfacher machte. Später dann, nachdem ein Motorboot unser umgekipptes Boot (zusammen mit uns im Wasser schwimmend) ein Stück geschleppt hatte, hingen hernach dafür neben den nassen Sachen auch Ausweis und Geldscheine auf der Leine. Und der Fotoapparat war natürlich im Eimer. Es wurde später der billigste, für uns gerade noch erschwingliche Ersatz (Pouva Start) gekauft, um wenigstens ein paar Bilder zur Dokumentation der Fahrt zu haben. (Natürlich nur schwarz/weiß und in „Papierkorbqualität“.
Auch diese Lektion des Kenterns hatte gesessen! Geldscheine mussten wir jedenfalls nicht wieder auf der Leine zum Trocknen aufhängen.
Der weitere Weg vom Nordwestufer des Plauer Sees mit Ziel Damerower See war wieder nur mit Fuhrwerk ein paar Kilometer (über das Dorf Karow) per Landstaße zu bewältigen.
Als Ausfluss dieses Sees fungiert hier die Mildenitz, ein ganz reizendes Paddelflüsschen durch zum Teil bezaubernde Landschaften. OK, einige Brocken mussten da auch bewältigt werden, wie die Umgehung eines kleinen Kraftwerkes (Zülow) und anderes. Aber sonst, für Genusspaddler empfehlenswert. (Für Neugierige als Stichpunkte: Goldberger-, Dobbertiner-, Sternberger See.)
Unmittelbar nach der Mündung der Mildenitz in die Warnow kommt mit dem so genannten Warnowdurchbruch ein richtiges Stückchen Wildwasser. Nicht direkt gefährlich, doch der vielen spitzen Steine und Felsbrocken wegen, aufpassen muss man schon.
Auch die Warnow ist – über die Städtchen Bützow (Schiefer Kirchturm) und Schwaan bis schließlich nach Rostock – ein recht angenehmer, unproblematischer Wanderfluss.
Da unsere Urlaubszeit zu Ende ging, wir aber noch ein paar Tage unmittelbar in Ostseenähe verbringen wollten, machten wir (doch wieder) … eine Nachtfahrt. Zuvor, da hatten wir schon eine normale Tagestour seit dem Warnowdurchbruch hinter uns, gingen wir in Bützow noch mal richtig essen und dann ging’s los. Die Warnow, hier ohne jegliche Nebenarme oder zu durchfließende Seen, erlaubte das. Alles ging gut und kurz nach Sonnenaufgang sahen wir bereits die Silhouette von Rostock auftauchen.
Nun wurde es spannend. Wenn man uns hier schnappte, wäre das zwar nicht schön, jedoch so kurz vor dem Ende auch nicht mehr allzu tragisch. Als einzige Möglichkeit zum wilden Zelten im Grenzbereich war uns auf der Karte das äußerste Ostende des Breitlings erschienen. Doch um dahin zu gelangen, müssten wir irgendwie quer über die drei Hafenbecken des Rostocker Überseehafens paddeln. Ob das gut gehen würde?
Schon näherten wir uns auf dem Breitling dem ersten Hafenbecken. Zuvor registrierten wir den Farbumschlag des Wassers von trüb-braun zu grünlich-klar. Wir fuhren in Salzwasser! (Und probierten das natürlich auch mit dem Finger!) Um uns herrschte ein unerhörter Hafentrubel, jede Menge Schiffe und Barkassen – und wir mittendrin. In der Ferne die gewaltige Kabelkrananlage der Warnow-Werft. Ich berührte mit dem Paddel die Stahlhaut eines 10.000-Tonners (das war damals viel), amüsiert schauten Matrosen von oben auf uns herab. Dann das zweite Hafenbecken, dann der Ölhafen. Auf der anderen, der nördlichen Seite sahen wir sogar Kriegsschiffe der NVA liegen. Nichts passierte. Unglaublich! Das kann doch nicht sein, dass uns kein »Offizieller« von irgendeiner Behörde gesehen hatte? Vielleicht waren die auf solch »Verrückte«, die dort im Faltboot zwischen Hochseeschiffen herumgurkten, gar nicht vorbereitet?
Gut, wir waren nicht böse, dass uns kein Polizeiboot eines Besuches für würdig befand. Doch hätten wir uns das Zurechtlegen einiger hanebüchener Ausreden da auch sparen können. So paddelten wir, was die Arme hergaben, um möglichst schnell aus dem Sichtbereich irgendwelcher Grenzer zu gelangen oder deren Aufmerksamkeit vielleicht doch noch zu erregen.
Endlich schien uns die Luft wieder »rein« zu sein. Am äußersten östlichen Ende des Breitlings, sogar noch ein Stück weiter in Richtung Markgrafenheide (Radelbach/Radelsee), inmitten von stark verschilftem Ödland sowie kaum überschaubarer ebenso öder, künstlicher Aufspülflächen suchten wir einen Platz für unser Zelt. Alles Land dort lag nur wenige Zentimeter oberhalb der Wasserlinie. Auf einem Stück, scheinbar ein paar Zentimeter höher gelegen, versuchten wir es dann, traten das allgegenwärtige Schilfgras breit und errichteten, so gut es ging, unsere letzte Bleibe. Einsamkeit pur! Wenn uns hier etwas passierte, niemand würde uns je in dieser Einöde finden. Erschöpft und übermüdet nach der Nachtfahrt und den etwa 90 km der Gesamt-Tagesstrecke war uns zunächst alles egal und wir fielen mitten am Tag erst einmal in einen tiefen Schlaf.
Wir hatten vom Zelt aus etwa je einen Kilometer Richtung Norden bis zum Strand nach Markgrafenheide und etwas mehr nach Osten zu einer urigen Dorfkneipe. Zuvor allerdings ging's vom Zelt aus zunächst stets erst einige hundert Meter durch das Schilfdickicht, wo man anstatt auf Wege oder wenigstens auf Trampelfpade mehr auf Intuition und Gefühl setzen musste.
Leider setzte dann während unserer ohnehin letzten Urlaubstage mehrtägiger Regen ein und nahm uns somit alle Sorgen für Planungen irgendwelcher letzter Unternehmungen ab. Und die genannte Kneipe war als »Rettungsanker« auch nicht das Wahre. Eher ein gewagtes Unterfangen, das bei nächtlicher Heimkehr kaum ohne nasses Schuhwerk ablief. besonders wenn dabei der schilfige Sumpfgürtel nicht das einzige Schwankende war.
Doch hatten diese misslichen Umstände der letzten Tage auch ihr Gutes: Machten sie doch den Abschied leichter.
***
Das waren die Hauptstationen meiner Wasserwanderzeit. Es kamen zwar noch ein paar weitere, kleinere Touren danach, doch keine war so spektakulär oder hatte diesen gewissen »Charme« wie diese beschriebenen drei, um hier mit aufgenommen zu werden.
Danach hatte das Schicksal anderes mit mir vor.
Weshalb besondere Geschichten, die deutlich über den Rahmen einer »normalen« Reise hinausgehen, erst etwa dreißig Jahre später zu verzeichnen sind. Nun allerdings in ganz anderer Form und an teilweise recht fernen Ecken der Welt.
Mecklenburger Wasserwege