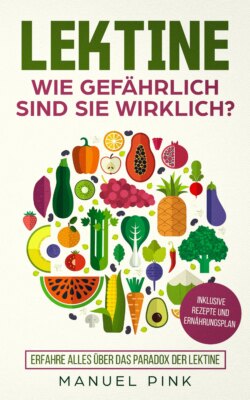Читать книгу Lektine-Wie gefährlich sind sie wirklich? - Manuel Pink - Страница 4
Оглавление2. Begriffserklärung zu Lektinen
In diesem Kapitel erfährst du, was Lektine überhaupt sind, welche Funktion sie besitzen und wo sie vorkommen sowie angewendet werden.
Lektine sind sogenannte Glykoproteine, die Kohlenhydrate binden. Durch ihre vernetzende Wirkung können sie Zellen zusammenfügen, ohne ihre Struktur verändern zu müssen. Gleichzeitig gelten Lektine als Anti-Nährstoffe, die die Verwertung von Lebensmitteln erschweren. Da Lektine die Zellfortsätze der Darmschleimhaut beeinträchtigen, können Nahrungsmittel nicht ausreichend verdaut werden. In Folge dessen verkleinert sich die Darmoberfläche und es kommt zu einer verringerten Nährstoffaufnahme. Nach dem amerikanischen Arzt Steven Gundry sollen Lektine des Weiteren die Darmwand so sehr beschädigen können, dass sie diese durchlöchert und folglich Schadstoffe in die Blutlaufahn durchlässt. In diesem Fall würde das Risiko steigen, dass alle Organe des Menschen von den Schadstoffen befallen werden können.
In der Natur übernehmen Lektine eine Schutzfunktion der Pflanzen gegenüber Insekten, Schädlingen oder anderen Pflanzen- sowie Allesfressern. Du kannst Lektine mit einem natürlichen Pestizid der Pflanzen vergleichen, um die Samen und Früchte in ihrer Wachstumsphase zu schützen. Daher können gerade in Samen ein höherer Lektin-Gehalt gefunden werden. Auch im pflanzlichen Gewebe oder in der Wurzel sind Lektine enthalten. Jedoch ist hier die Konzentration geringer im Vergleich zu den Samen. Beispiele für lektinhaltiges pflanzliches Gewebe sind Zwiebeln, Kartoffeln, Rinde, Wurzelstöcke und Ähnliches.
Grundsätzlich kann der Nutzen von Lektinen für den Menschen sowohl positiv als auch negativ ausfallen. In den folgenden Kapiteln lernst du den Aufbau des toxischen Pflanzenstoffs kennen. Zudem wirst du erfahren, in welchen Lebensmitteln Lektine zu finden sind und wofür Lektine verwendet werden können
2.1. Vorkommen und Verwendung
Dass Lektine in größeren Mengen giftig sein können, hast du in der Einleitung schon erfahren. Jedoch stellt sich die Frage, welche Lektine schädlich sind und in welchen Lebensmitteln sie vorkommen.
Das bekannteste und am weitesten verbreitete Lektin nennt sich das Phasin, welches hauptsächlich in Hülsenfrüchten wie grünen Bohnen oder Erbsen enthalten ist. Wenn du diese Lebensmittel roh verzehrst, kann es zu Erbrechen, Übelkeit und Durchfall kommen. Durch den Garprozess jedoch werden die meisten Lektine aufgrund der Hitze abgebaut und genießbar. Aufgrund der Hitzeeinwirkung können somit die meisten Lektine auch keine Schäden mehr in der Darmwand verursachen. Denn die geringen Mengen an Lektinen verteilen sich über der Darmoberfläche des Menschen und können problemlos ohne bleibende Schäden ausgeschieden werden. Dasselbe gilt ebenso für hitzebeständige lektinhaltige Lebensmittel wie Kartoffeln, Tomaten oder Gurken. Auch Weizenkleie beinhalten Lektine, die der Hitze standhalten können.
Grundsätzlich sollten am Tag nicht mehr als 300 Milligramm Lektin zu sich genommen werden, damit die Gesundheit, nicht gefährdet wird.
In dem Buch von Dr. Steven Gundry werden viele Lebensmittel von vornherein vermeiden, weil sie auf natürliche Weise viel Lektin enthalten.
Dazu gehören:
die meisten Getreidesorten, wie Reis, Weizen, Soja, Hafer oder Kartoffeln
Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen, Linsen und Erdnüsse
Gemüsesorten wie Tomaten, Paprika, Gurken und Zwiebeln
Viele Nusssorten wie Mandeln, Cashewkerne, Walnüsse etc.
Ölsaaten wie Kürbiskerne, Chiasamen, Sonnenblumenkerne etc.
Melonen
Nachtschattengewächse
Kürbisse und Zucchini
Beeren
Alternativ sollen laut Gundry viele Salate wie Spinat, Grünkohl und weiteres grünes Blattgemüse verzehrt werden. Zudem legt er großen Wert auf kaltgepresste Pflanzenöle. Gemüsearten wie Fenchel, Spargel, Kohl jeglicher Art und Algen gehören ebenfalls auch einen lektinfreien Speiseplan. Des Weiteren predigt er nur saisonales Obst zu sich zu nehmen. Der Hintergrundgedanke besteht darin, dass Gundry der Annahme ist, dass nur naturreife Früchte kein Lektin mehr enthalten. Importierte Obstsorten sieht er daher als sehr kritisch an, da sie unreif geerntet und mit synthetischen Chemikalien nachreifen gelassen wurden. Dadurch sei der Lektin-Gehalt signifikant höher.
Fleischhaltige Produkte sollten ebenfalls auf ein Minimum reduziert werden, da das Futtermittel der meisten Industrietiere in der Regel voll mit dem lektinhaltigen und unverarbeiteten Soja ist. Folglich finden sich auch vermehrt Lektine in dem Fleisch, Eiern oder Milchprodukten der Nutztiere wieder. Daher empfiehlt Gundry ausschließlich Wildfleisch zu essen und den Fleischkonsum sowie den Verzehr von tierischen Lebensmitteln auf maximal 1-2 Mal die Woche zu reduzieren.
Neben den Risiken von Lektin konnten jedoch in Studien auch Vorteile des natürlichen Pflanzenpestizids festgestellt werden. Es ist grundsätzlich nicht auszuschließen, dass nahezu alle Wirkstoffe Nebenwirkungen hervorrufen, sobald ein übermäßiger Konsum praktiziert wird. Wie auch schon in dem Kapitel geschildert wurde, führt ein übermäßiger Konsum an rohen Bohnen zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall aufgrund des Lektin Phasin. Jedoch beweisen auch Studein das genaue Gegenteil, bei denen Lektine die Darmfunktion unterstützen und sogar das Krebswachstum hemmen kann. Weiterhin finden bestimmte Lektine auch Einsatz, um den menschlichen Organismus vor Übergewicht und Darmkrebs schützen. Du siehst also, dass Lektine nicht grundsätzlich schlecht sind.
Jedoch muss hier noch erwähnt werden, dass sich Studien aufgrund der unzureichenden Forschungsergebnisse in ihren jeweiligen Resultaten zum Teil widersprechen. Im Kapitel 6 erfährst du eine detaillierte Ausführung verschiedener Studien.
Im medizinischen Bereich werden Lektine zur Bestimmung der Blutgruppen genutzt. Auch in der Krebsforschung sind Lektine im Bestand, um Tumorzellen nachzubilden und Untersuchungen fortzuführen. Zudem zeigen sich Lektine als Extrakt, gewonnen aus Bananen, als äußerst nützlich gegen die Vermehrung von HIV.
Bei den Versuchen in den Studien wurden nur Lektinpräparate verwendet, die in isolierter sowie konzentrierter Form im Reagenzglas zusammen mit Zellkulturen getestet wurden. Dabei fanden keine Experimente weder an dem Menschen oder an dem Tier statt. Für die Ergebnisuntersuchung hat man stattdessen Teststreifen verwendet. Zudem werden in den meisten Fällen Lektine eingesetzt, die nicht als den Nahrungspflanzen stammen oder vom Menschen konsumiert werden. Das generelle Ziel bestand darin, dass versucht wurde, aus synthetisierten Lektinen eventuelle Arzneimittel herzustellen.
In einigen anderen Versuchen mit herkömmlichen Lebensmitteln konnte schließlich herausgefunden werden, dass das Kohlenhydrat Galactose, welches in nahezu allen Obst- und Gemüsesorten enthalten ist, krebsverursachende Lektine bindet. Mit diesem Ergebnis kann darauf geschlossen werden, dass pflanzliche Lebensmittel zwar giftige und gesundheitsschädigende Stoffe beinhalten, jedoch dies ausgeglichen wird durch Stoffe, die vor den Giftstoffen schützen und präventive Schutzfunktionen haben.
Des Weiteren wirken Lektine unterstützend beim Wiederaufbau der Darmwand. Bei entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa kann es von Nutzen sein, die Nährstoffe intravenös über die die Blutbahnen einzuführen. Somit wird der Verdauungstrakt geschont. Jedoch führt eine dauerhafte intravenöse Nährstoffzufuhr dazu, dass die Funktionen des Darms nachlassen und zu einen Abbau der Darmschleimhaut führt. Folglich können Nährstoffe über die feste Nahrung nur noch beschränkt oder gar nicht aufgenommen werden. Lektine wirken hier unterstützend, indem sie sich an die Zellen der verschiedenen Darmregionen heften und den Wiederaufbau der Darmwand begünstigen. Damit kann ein Funktionsverlust verhindert und die Darmaktivität verbessert werden.
Da Lektine auf natürliche Weise Insekten, Parasiten, Pilze oder Bakterien fernhalten, macht sich diesen Vorteil die Landwirtschaft zu Nutze. Insbesondere bei genmanipulierten Pflanzen wird die Anreicherung von zusätzlichen Lektinen gefördert. Dadurch können gefährliche und umweltschädliche Chemikalien im Einsatz gemieden werden und die Ernte bleibt dennoch ertragreich. Der Nachteil liegt hier nahe, dass durch die Genmanipulation der natürliche Lektingehalt nicht mehr gemessen werden kann. Insbesondere für Menschen, die sehr sensitiv auf Lektin reagieren, kann das gravierende gesundheitliche Schäden verursachen.
Über die aktuellen empirischen Studien wirst du aber noch im Laufe des Buches mehr erfahren.