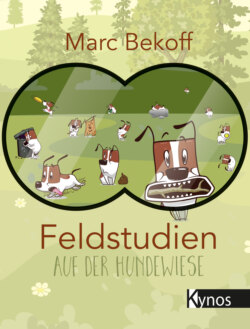Читать книгу Feldstudien auf der Hundewiese - Marc Bekoff - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEINS
Vom Glück, unser Leben mit Hunden zu teilen
Auf den Hundewiesen der Stadt Boulder in Colorado sind Paul und Pina als „Popo-Fans” wohlbekannt. Es ist unschwer, zu erraten, woher der Spitzname kommt: Um bekannte und neue Menschen und Hunde zu begrüßen, steuern sie direkt deren Popo an. Sally und Simba hingegen, „die Schamlosen”, konzentrieren sich erst einmal auf die Schrittgegend, wo sie ganz ungeniert schnüffeln und schnaufen. Zugegebenermaßen habe auch ich schon mehrmals eine derartig enthusiastische Hundeschnauze im Schritt gefühlt, dass ich um meine Stimme fürchtete.
Kimmy, „die Kotfresserin”, hat einen unermüdlichen Appetit auf Exkremente, während Zora „die Zunge” und Shari „die Schleckerin” die Zweibeiner im Hundepark mit der Zunge begrüßen und eine nasse Sabberspur hinter sich zurücklassen.
Ingo und Ines sind „immer in Stimmung”. Fröhlich und ohne zu zögern reiten sie ihren Artgenossen auf, ganz gleich, ob diese männlich oder weiblich, intakt oder kastriert sind. Mit gekonnter Akrobatik steigen sie auf und haben ihren Spaß. Mehr als einmal entlud sich ihr manisches Aufreiten und eher unpassendes Stoßen schon an einem meiner Beine, und regelmäßig schlägt Ines’ Halterin die Hände überm Kopf zusammen und ruft: „Meine Güte, ich hab sie kastrieren lassen, damit sie damit aufhört!” Ines ist ein Beispiel für jene Art Vierbeiner, die ich liebevoll als ADHS-Hund bezeichne: ein Hund mit Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom. Giovanni, der „Phallus-Fetischist”, begegnete mir zum ersten Mal vor einigen Jahren. Ich muss wohl nicht näher erklären, womit er sich – unter den wohlwollenden Blicken seines Menschen – gern die Zeit vertreibt! Als ich Giovannis Herrchen darauf hinwies, dass mir dies nicht recht sei, antwortete er: „Er macht es so gern, also was soll’s …”
Die Schnauzen im Schritt, der Sabber auf der Haut und das ausgelassene Aufreiten resultieren in zahlreichen Fragen und angeregten Gesprächen darüber, warum unsere Hunde gewisse Dinge tun, als gäbe es kein Morgen, und wie wir Menschen damit umgehen sollen.
Ich gebe den Hunden, die mir auf der Hundewiese begegnen, genau wie den Hunden, mit denen ich zusammenlebe, liebend gern Spitznamen. Oft stehen die Namen mit bestimmten Körperteilen in Verbindung: Schließlich dreht sich das Verhalten unserer Vierbeiner häufig um Nasen, Mäuler und Zungen, Beine und Popo. Wenn Hunde einander begegnen oder einen Menschen begrüßen, so nehmen sie auf die unterschiedlichste Art Kontakt auf: Sie sehen einander in die Augen, berühren einander mit der Schnauze und stecken ihre Nasen in die Schrittgegend oder riechen am Popo. Wir alle wissen, dass nichts und niemand vor der Nase eines Hundes sicher ist: Die Hundewiese steckt voller olfaktorischer Geschichten und Daten.
Die Begeisterung der Hunde für Dinge, die wir Menschen meiden würden, unangemessen oder widerlich finden, schmälert unsere Liebe für die Vierbeiner nur selten. So finden etwa „Furzer”-Fredi und „Analdrüsen”-Anton nichts schöner, als ihre Gase und beißenden Gerüche mit anderen zu teilen. Fredi furzt und Anton presst stinkende Klümpchen aus seinen Analdrüsen, die immer wieder am Bein eines Menschen landen. Lacht das zweibeinige Publikum, so sehen die Hunde dies als Aufforderung, ihre liebsten Verhaltensweisen noch öfter zu zeigen: Sie rammen so viele Menschen wie nur möglich mit der Schnauze, versuchen, den Zweibeinern die eigene Zunge in den Rachen zu stecken, lassen links und rechts einen fahren und blasen den Hundewiesenbesuchern begeistert ihren Atem ins Gesicht.7
Ich erinnere mich gut an einen älteren Herrn, der mich im Hundepark zur Seite nahm, um mir hinter vorgehaltener Hand zu erklären, was mit Lucifer, einem Hund, der für seinen üblen Mundgeruch berüchtigt war, vor sich ginge: Lucifers Halterin, meinte er, „sieht es einfach nicht. Ihr Hund hat die Gleich-Krankheit. Sein Maul riecht genau gleich wie sein Hintern. Wenn sie das endlich einsieht, wird’s uns allen besser gehen.”
Was hündischen Mundgeruch betrifft, erzählte mir meine Freundin Kimberly Nuffer eine Geschichte zum Thema „Stinkzungensyndrom” oder SZS:
Wir holten Zelda (Zipper, ZDog) aus dem Tierheim in Aurora. Schon beim ersten Kennenlernen kletterte sie in meinen Schoß und begann herzzerreißend zu winseln, als wir sie wieder in ihren Zwinger zurückbrachten. Als wir sie schließlich abholten, durfte sie eine Woche lang nicht gebadet werden, damit ihre Kastrationsnähte heilen konnten. Im Tierheim war sie wohl auch noch nicht gebadet worden, seit man sie auf den Straßen Auroras aufgelesen hatte. Die Tatsache, dass Zelda nach einem Müll fressenden Streuner roch, hielt mich nicht davon ab, meinem neuen Familienmitglied Zuwendung zu schenken. Sie schlief in unserem Bett und ich kuschelte viel mit ihr. Als die Nähte gezogen waren, setzte ich sie in die Badewanne, was sie dringend nötig hatte. Danach wurde direkt weiter gekuschelt, da ich dabei war, eine innige Beziehung zu Zelda aufzubauen. Dem Lavendelshampoo zum Trotz roch sie auch nach ihrem Bad kaum besser als zuvor. Selbst das Abscheren ihres lockigen grauen Pudelfells schaffte keine Besserung: Der Geruch kam aus Zeldas Maul! Sie roch nach verwesendem Fleisch – anders lässt es sich nicht beschreiben. Wir untersuchten ihre Zähne – sie waren perlweiß, nicht gelb, keine faulenden Stümpfe. Auch ihre Zunge sah gesund und rosa aus, jederzeit bereit, einen Zweibeiner zu küssen. Wir ließen ihre Zähne professionell vom Tierarzt reinigen. Kein einziger musste gezogen werden; ihr Gebiss war in bestem Zustand. Ihr Mundgeruch verschwand nach dem Zähneputzen … jedoch nur einen Tag lang. Auch heute, zehn Jahre später, erinnert Zeldas Mundgeruch noch an verwesendes Fleisch – dem regelmäßigen Zähneputzen, wöchentlichen Baden, biologischem Futter und Pfefferminz-Kaustangen zum Trotz. Manchmal ist es ein wenig besser und manchmal viel schlimmer, aber niemals verschwindet der Gestank vollständig. Das Rätsel bleibt bis heute ungelöst. Um ihr über die Schamgefühle hinwegzuhelfen, die sie empfinden muss, wenn wir uns angewidert wegdrehen, sobald sie uns Küsse gibt, haben wir ihrer Krankheit den Namen Stinkzungensyndrom oder SZS gegeben. Wir können uns keinen treueren, liebevolleren Hund als Zelda vorstellen. Jeder, der sie kennenlernt, will sie mit nach Hause nehmen, weil sie sich im Schoß eines jeden Besuchers zusammenrollt, sobald sich die Möglichkeit bietet. Niemand von uns ist perfekt, und in Wahrheit sind es gerade unsere Fehler, die uns so einzigartig und liebenswert machen. Wir bemühen uns oft, die Fehler auszubessern – und manchmal ist das Einzige, was sie besser macht, sie zu akzeptieren. Ich bin dankbar, dass ich dies von Zelda und ihrem SZS lernen durfte.8
Etwas später sendete mir Ken Rodriguez, Kimberlys Mann, folgendes E-Mail, welches ihm Zelda diktiert haben soll:
Jedes Jahr erkranken Tausende – wenn nicht sogar Millionen – Hunde an SZS. Manchmal schämen sich die Zweibeiner für ihren SZS-Hund und machen ihm Schuldgefühle. Manche Vierbeiner müssen sich von Scharlatanen behandeln lassen. Manche werden so lange beschämt, bis sie weglaufen, um ein gefährliches Leben auf der Straße zu führen, nur um den peinlich berührten Blicken zu entrinnen. Zum heutigen Stand der Wissenschaft ist aber Mitgefühl die beste Behandlungsmöglichkeit. Wir alle müssen uns das stumme Leiden all jener Hunde bewusst machen, die wie ich [Zelda] mit SZS leben.9
Manchmal handelt es sich bei unseren „Problemen” mit Hunden tatsächlich um unsere Probleme. Wie Kimberly und Ken empathisch feststellen: Akzeptanz ist die einzige Lösung. Auch ich wünsche mir hin und wieder, ein Hund würde seinen Kopf wegdrehen, wenn er ausatmet oder aufstößt. Ich hatte bereits Hunde, deren Mundgeruch mir den Atem raubte – im wörtlichen wie im metaphorischen Sinne. Andere Hunde schienen meine Meinung jedoch nicht zu teilen. Aus der Perspektive eines Hundes können sie es kaum erwarten, am Maul eines Artgenossen zu schnüffeln oder den Sabber zu kosten, der über seine Lefzen läuft. Wir wissen zwar nicht genau, warum Hunde dies tun, können aber davon ausgehen, dass sie Informationen über ihr Gegenüber einholen. Einem anderen Tier auf diese Art nahe zu kommen kann auch Teil der sozialen Interaktion sein und dem Aufbau einer Beziehung dienen. Intime Körperstellen und Gerüche, die uns Menschen unangenehm sind, spielen eine große Rolle im Leben eines Hundes.
Immer wieder werde ich gefragt, warum Hunde ihre Schnauze genau an jene Stellen stecken, von denen wir unsere eigenen Nasen tunlichst fernhalten. Oft scheint mein Gegenüber davon auszugehen, dass wir sie davon abhalten könnten, wenn wir sie nur verstehen würden. Hunde schnüffeln an Orten, von denen wir uns nicht einmal im Traum vorstellen können, dass sie interessant wären. Wir begrüßen weder Freunde noch Fremde, indem wir über ihre Lippen schlecken, ihre Nase mit der unseren berühren und an ihren Genitalien riechen oder schlecken. Oft stellen unter Hunden selbstverständliche Verhaltensweisen einen krassen Gegensatz zu dem dar, was unter Menschen salonfähig ist. Unsere Hunde sind jedoch nicht an unseren sozialen Normen interessiert. Eine Bekannte, die den hündischen Sitten relativ offen gegenübersteht, sagte einmal zu mir: „Wenn du eine gute Nase hast, dann setze sie ein!” – und Hunde tun genau das.
Wollen wir also mehr über Hunde lernen, mit ihnen leben und sie lieben, so müssen wir akzeptieren, dass ihr Zugang zur Welt oft über gewisse Körperteile führt. Nur so können wir einen Zugang zum Verstand, zu den Sinnesorganen und Herzen der Hunde finden. Zwar basiert nicht alles, was im kognitiven, emotionalen und moralischen Leben eines Hundes vorgeht, auf Körperteilen, doch gibt es ausgesprochen wenig, das nicht zumindest damit in Zusammenhang steht.
In vielerlei Hinsicht sehe ich mich nicht nur als den Vertrauten der Hunde, sondern auch als jemand, der Gerüchte aufdeckt. Wie Kimberly Beck, eine Freundin und Hundetrainerin, bin davon überzeugt, dass sowohl Ersthundehalter als auch Menschen, die bereits ihr ganzes Leben lang Hunde hatten, davon profitieren, „völlig unvoreingenommen” auf einen neuen Hund zuzugehen. In Kimberlys Organisation Canine Effect dreht sich alles um die Mensch-Hund-Beziehung.10 Wer Hunden völlig unvoreingenommen begegnet, so Kimberly, begegnet jedem Vierbeiner als Individuum, ohne Vorurteile, im Hier und Jetzt und nimmt sich Zeit, eine Beziehung aufzubauen und den Hund richtig kennenzulernen. Ebenso wichtig ist es, uns vor Augen zu führen, dass Gerüchte sowohl den Hunden selbst als auch unserer Beziehung zu ihnen schaden. Wir alle profitieren, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was wir tatsächlich über Hunde und die Hund-Mensch-Beziehung wissen.
Es sollte etwas wunderbar Schönes sein, sein Leben mit einem Hund zu teilen. Natürlich können uns die Vierbeiner, die wie viele andere Tiere auch intensive Emotionen empfinden und frech, klug und launisch sind, vor Herausforderungen stellen. Dennoch sollte das Zusammenleben mit einem Hund in erster Linie eine schöne Erfahrung sein – auch wenn es mitunter laut, stinkig oder frustrierend ist. Die Herausforderungen erinnern uns daran, dass Hunde Individuen sind. Geht man von der großen Anzahl Bücher, Fachpublikationen und populärwissenschaftlicher Artikel aus, die sich damit auseinandersetzen, wer Hunde sind und was ihr Verhalten bedeutet, so besteht wohl auf der ganzen Welt großes Interesse daran, diese faszinierenden Lebewesen zu verstehen.
Die große Frage: Wer sind Hunde?
Domestizierte Hunde sind faszinierende Säugetiere. Wir schufen sie nach unserem Ebenbild und selektieren bis heute Eigenschaften, die uns gefallen oder nützlich erscheinen, obwohl sich diese mitunter negativ auf Gesundheit oder Lebenserwartung auswirken. Es ist kaum zu übersehen, dass Hunde sich in Größe, Form, Gewicht, Farbe, Fell, Verhalten und Persönlichkeit stark unterscheiden.11 Weil Hunde so stark variieren und aus unserem Leben kaum wegzudenken sind, stellen sie ein beliebtes Thema für Studien mit evolutionären, biologischen und ethologischen Schwerpunkten dar. Besonders ihr Sozialverhalten im Zusammenhang mit Spiel, Dominanz, Kommunikation und sozialer Organisation steht oft im Mittelpunkt des Interesses.
Dennoch gingen „ernsthafte Wissenschaftler” jahrelang davon aus, dass es sich nicht lohne, Hunde zu untersuchen – eben weil sie als „Artefakte” galten; ein genetisches Konstrukt des Menschen. Anstatt sich natürlich entwickelt zu haben, sind Hunde Tiere, die von uns Zweibeinern dazu gemacht wurden, was sie sind – auf Basis dessen, was wir wollten oder uns vorstellten. Tierärzte und Gentechniker konnten Hunde erforschen, nicht aber ernsthafte Verhaltenswissenschaftler. Mittlerweile sind wir weit von diesem Ansatz entfernt und zahlreiche renommierte Universitäten konzentrieren sich in verschiedensten spannenden Studien auf die Hunde. Die auf der nächsten Seite abgebildete Grafik zeigt den steten Anstieg der Anzahl veröffentlichter Hundeverhaltensstudien in den letzten dreißig Jahren. Vom Jahr 1995 an wird das Wachstum besonders deutlich.
Immer wieder fällt mir auf, dass regelmäßige Besucher der Hundewiese die Begriffe Domestikation und Sozialisation verwechseln. Hunde haben sich vom Wolf zu einer domestizierten Art entwickelt. Das heißt, dass jeder Hund als Hund zur Welt kommt. Manche Menschen teilen ihr Zuhause mit einem zahmen Wolf und sagen: „Ich habe einen domestizierten Wolf.” Das stimmt so nicht – wenn der zahme Wolf Welpen zur Welt bringt, handelt es sich dabei um Wölfe – um wilde Tiere. Der freundliche Wolf ist ein sozialisiertes Individuum. Ein „domestizierter Wolf” hingegen ist ein Hund.12
Wie der Titel dieses Abschnitts vermuten lässt, möchte ich in diesem Buch der Frage nachgehen, wer (im Gegensatz zu was) Hunde sind. Hunde wehren sich dagegen, sich auf simple Reiz-Reaktions-Maschinen reduzieren zu lassen. Der bekannte russische Nobelpreisträger Ivan Pavlov leistete einen großen Beitrag zur Lerntheorie, bewies allerdings nicht, dass Hunde Automaten sind. Die Evolutionstheorie, detaillierte wissenschaftliche Daten und der gesunde Menschenverstand machen deutlich, dass Hunde weder stupide Maschinen noch simple „Instinktbündel” sind, die hauptsächlich fixe Verhaltensmuster abspielen. Im Gegenteil: Hunde sind intelligente, denkende und fühlende Wesen, die verschiedene Situationen einschätzen können und wie wir eine große Bandbreite an Emotionen empfinden.13 Hunde treffen Entscheidungen darüber, wie sie sich verhalten wollen und machen niemals etwas „ohne Grund”.14 Tatsächlich basieren viele aktuelle Trainings- bzw. Lehrmethoden auf dem großen Verstand und Herzen der Hunde. Wie wir selbst sind sie Säugetiere. Führen wir uns dies vor Augen, können wir bereits viel über sie lernen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass viele Tiere – darunter Hunde, Fische und Insekten – so wie auch wir intelligente und fühlende Wesen sind.15 Im Laufe dieses Buches werden wir uns immer wieder, besonders aber in den Kapiteln sechs und sieben, mit den Köpfen und Herzen der Hunde auseinandersetzen. Zwar stecken sie voller Geheimnisse, doch steht außer Frage, dass sie denken und fühlen. Unser Umgang mit Hunden sollte von diesem von zahlreichen Studien belegten Wissen geleitet werden. Das heißt natürlich nicht, dass wir das Seelenleben der Hunde und anderer Tiere ausschmücken oder übertrieben darstellen müssten, um sie intelligenter erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich sind.16 Aber wir zäumen das Pferd keineswegs von hinten auf (bzw. leinen den Hund nicht von hinten an), indem wir wissenschaftlichen Daten erlauben, unser Mitgefühl für Hunde und andere Tiere zu stärken und ihre Lebensqualität zu steigern.
Die Kurve zeigt, dass die Anzahl der Studien zum Verhalten des Hundes in den letzten dreißig Jahren stetig gestiegen ist. Quelle: Hal Herzog, „25 Things You Probably Didn’t Know about Dogs”; verwendet mit Genehmigung. Hundefoto: flickr user alan schoolar, Creative Commons license CC BY 2.0.
Manche Menschen – glücklicherweise sind diese zunehmend in der Minderheit – behaupten immer noch, dass wir nicht wüssten, was Hunde wollen und brauchen. Ich antworte darauf immer, dass wir dies sehr wohl wüssten: Sie wollen und brauchen eben das, was auch wir wollen und brauchen – Frieden, Sicherheit und ein harmonisches Zusammenleben mit anderen.
Dieses Buch beschäftigt sich auf Basis der aktuellen Forschung mit allem, was wir über Hunde wissen. Mangelt es uns an Wissen, um eine Frage vollständig beantworten zu können – und das ist fast immer der Fall –, so weise ich darauf hin. Um den Lesefluss nicht zu unterbrechen, zitiere ich den Großteil der Studien, auf welche ich mich beziehe, im Anhang. Ich bitte den Leser, dort nachzuschlagen, um mehr zu erfahren. Will man Hunde verstehen und schätzen, so ist es unumgänglich, sich auf Forschungsergebnisse zu stützen, Studien, wissenschaftliche Artikel und Bücher zu zitieren. Andererseits berücksichtige ich auch zahlreiche Anekdoten, die mir Wissenschaftler und andere Menschen erzählt haben.17 Ich gebe Scientist-Journalisten und Autor Fred Pearce absolut recht, wenn er schreibt: „Um die Welt zu verändern, müssen die Wissenschaftler zu Geschichtenerzählern werden.”18 Laien fällt es wesentlich leichter, sich auf Forschungsergebnisse einzulassen, wenn diese auf zugängliche Art und Weise präsentiert werden. Geschichten, in denen wir uns wiedererkennen, sind ausgesprochen effektiv. Ebenso können sie uns darauf hinweisen, was wir alles noch nicht wissen und uns inspirieren, Dinge, die wir für selbstverständlich zu nehmen pflegen, Vermutungen und Dogmen in Frage zu stellen. Vielleicht überrascht es den Leser, festzustellen, dass wir trotz allem, was wir über das Verhalten, die Gedanken und Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse der Hunde wissen, in vielerlei Hinsicht noch im Dunklen tappen. Unsere Daten sind lückenhaft – auch wenn viele populärwissenschaftliche Hundebücher das Gegenteil behaupten.
Die Herausforderung liegt darin, die faszinierenden vierbeinigen Individuen aus einer Perspektive zu verstehen, die ihnen gerecht wird, und das, was wir wissen, in ihrem Sinne einzusetzen. Der Trainingsansatz, der für Waldi funktioniert, ist vielleicht nicht der richtige für Luna, und das, was für Luna klappt, eignet sich möglicherweise nicht für Pluto. Die vielen Hunde, die im Laufe der Jahre mein Zuhause teilten, hatten abgesehen davon, dass sie alle eine Rute, zwei Ohren, zwei Augen, eine Nase, ein Maul und immer Hunger hatten, wenig gemeinsam. Wie ich gern sage: Hüten Sie sich vor dem einen, einzigen und immer gleichen Hund: Dieser ist ein Fabelwesen.
Nicht „der” Hund, sondern mein Hund und dein Hund
Im Laufe dieses Buches betone ich immer wieder, dass es irreführend ist, von „dem” Hund zu sprechen, als wären alle Hunde gleich. Die Unterschiede zwischen einzelnen Vierbeinern – sogar zwischen Individuen derselben Rasse oder Geschwistern – sind unglaublich groß. Ebenso vermeide ich es, zwischen „braven” und „schlimmen” Hunden zu unterscheiden. Meist hängt die Frage, ob wir einem Hund (oder einem Kind) das Label „brav” oder „schlimm” verpassen, viel mehr mit dem Kontext als mit dem Tier an sich zusammen. „Brav” und „schlimm” liegen im Auge des Betrachters, und je nachdem, wen man fragt, können die Kriterien dieser beiden Bezeichnungen ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal beobachte ich, wie Vierbeiner, die ein und dasselbe typische Hundeverhalten an den Tag legen, von einem Halter als „brav” und vom nächsten als „schlimm” bezeichnet werden. Weder für den betreffenden Hund noch für mich machen die beiden Labels Sinn.
Auch darin, wie sehr er sich zu uns hingezogen fühlt, unterscheidet sich ein Hund vom nächsten. Auf die Gefahr hin, manchen Leser mit dieser Information zu erschrecken, muss doch gesagt werden, dass Hunde nicht notwendigerweise unsere besten Freunde sind und uns auch nicht bedingungslos lieben. Natürlich können Hunde uns lieben, mit uns spielen und uns unterhalten, bis wir Tränen lachen. Sie stellen aber auch „Bedingungen” an uns, die eine große Herausforderung sein können – aus diesem Grund floriert die Hundetrainings- bzw. -unterrichtsindustrie.
Und nicht nur das: Jeder Hund kann, genau wie wir, einen schlechten Tag haben, was sich in seinem Verhalten widerspiegelt. Ich erinnere mich an einen Hund namens Cheghi, den ich gut kannte. Bei einem Besuch verhielt er sich nicht wie er selbst: Anstatt ein Energiebündel zu sein, wirkte er ruhig und ein wenig weggetreten. Später fand ich heraus, dass ihm ein Bügeleisen auf den Kopf gefallen war. Sein Mensch glaubte, dass Cheghi Kopfschmerzen oder sogar eine leichte Gehirnerschütterung hatte. Erst einige Tage später war er wieder ganz der Alte: ein überschwängliches Energiebündel. Ein andermal beobachtete ich, wie einer der Hunde, mit dem ich zusammenlebte, nach dem Laufen schnell eine große Menge eiskaltes Wasser trank. Ich bin mir sicher, dass er davon Kopfschmerzen bekam: Er kniff die Augen zusammen und beutelte den Kopf, als wolle er etwas abschütteln. Er wurde ungehalten und schien sich eine ganze Weile lang unwohl zu fühlen. Genauso geht es auch mir, wenn ich nach einer langen Fahrradtour zu schnell eine Flasche Eistee trinke.
Immer wieder erhalte ich E-Mails und Anrufe von Forschern und Hundeliebhabern, die mich um eine aussagekräftige Zusammenfassung dessen bitten, was wir über die kognitiven Fähigkeiten der Hunde wissen bzw. nicht wissen. Verstehen sie uns, wenn wir in eine bestimmte Richtung zeigen? Orientieren sie sich an der Blickrichtung des Menschen? Sind kognitive Fähigkeiten rasseabhängig? Wie schneiden Hunde im Vergleich zum Wolf ab? Diese und viele weitere Fragen bekomme ich immer wieder zu hören.
Ich versuche, sie auf Basis aktueller Forschungsergebnisse zu beantworten – allerdings lassen sich hier keine allgemeingültigen Aussagen treffen. Wir müssen immer die Variablen der entsprechenden Studien berücksichtigen: Wie viele Hunde wurden getestet? Waren es Rüden oder Hündinnen, intakte oder kastrierte Tiere? Wie alt waren sie, und welchen Hintergrund hatten sie? Was genau wurde untersucht, und wo wurden die Hunde getestet? Emily Bray und ihre Kollegen fanden heraus, dass das Temperament eines Hundes, welches sich in einer erhöhten Erregungslage abzeichnet, die Problemlösefähigkeit beeinflusst. Auch konnte die Erregungslage der vierbeinigen Studienteilnehmer von den Forschern manipuliert werden.19 In den Tests, die die Problemlösekapazitäten der Hunde testen sollten, schnitten Familienhunde mit zunehmender Erregung schlechter ab, während Assistenzhunde mit zunehmender Erregungslage besser abschnitten. Die Studie illustriert, dass wir vorsichtig sein müssen, unser Wissen über „den” Hund zu stark zu vereinfachen. Das soll natürlich keine Kritik an den Forschern oder ihrer Arbeit sein – vielmehr handelt es sich um eine faszinierende Tatsache, welche die Wissenschaft rund um die kognitiven, emotionalen und verhaltenstechnischen Eigenheiten der Hunde umso faszinierender und spannender macht.
Ein Hundeexperte wandte sich im Oktober 2016 mit einer Frage an mich, die den Nagel auf den Kopf trifft: „Wer sind die Hunde in all diesen Tests?” Er bezog sich auf die Tatsache, dass die Studien häufig davon ausgehen, dass alle Hunde gleich seien – das sind sie aber ganz und gar nicht. Es ist schlicht unmöglich, zu sagen, dass alle oder auch nur die meisten oder viele Vierbeiner dies oder jenes täten. Ebenso wenig können wir sagen, dass „der Hund” und „der Wolf” einander in diesem oder jenem ähneln oder sich voneinander unterscheiden. Viele Menschen, die ich auf der Hundewiese treffe, wissen dies bereits – und zwar weil sich ihr eigener Hund wie ein einzigartiges Individuum verhält!
Stellt man mir Fragen über „den” Hund, so antworte ich darum oft, dass „der” Hund nicht existiere. Tests in unterschiedlichen Labors und zahlreiche Feldstudien zeigen vor allem eines: dass die Variabilität innerhalb der Spezies Hund unglaublich groß ist. Melissa Howses Masterarbeit zum Verhalten der Hunde in der Quidi-Vidi-Hundezone im kanadischen St. John’s (Neufundland) zeigt dies sehr deutlich. House vergleicht ihre Arbeit mit weiteren in Hundezonen durchgeführten Studien – darunter auch ein zweites, ebenfalls in Quidi Vidi durchgeführtes Projekt.20
Ganz klar: Der Hund als Individuum verdient größere Aufmerksamkeit. In einem Forschungsartikel, der eine Übersicht über sämtliche zwischen 1911 und 2016 publizierten Studien zur Kognition der Hunde liefert, zählen Rosalind Arden und ihre Kollegen nur drei Studien auf, die sich mit individuellen Unterschieden befassen.21 Im Durchschnitt, stellten sie außerdem fest, werden für eine Studie sechzehn Hunde untersucht.
Verständlicherweise wünschen sich Halter häufig eine schnelle Lösung für dieses oder jenes Problem mit ihrem Hund. Jedoch ist eine solche nicht immer realistisch – zu viel hängt von den individuellen Eigenschaften des entsprechenden Tieres ab. Immer wieder äußern meine Gesprächspartner auf der Hundewiese den Wunsch nach einer schnellen Lösung. Ich denke, der beste Tipp, den ich ihnen mit nach Hause geben kann, ist: Den Hund, der ihnen wichtig ist oder den sie genau zu kennen meinen, ganz genau zu beobachten. Im Laufe der Jahre sind mir zahlreiche Hunde begegnet; darunter ein liebenswerter und kuschelbedürftiger Pitbull. Der Mensch am anderen Ende der Leine erzählte mir, dass er sich den Terrier für Hundekämpfe gekauft hatte. Er wollte mit seiner Hilfe Geld verdienen. Als sich sein Hund jedoch weigerte, zu kämpfen, und sie beide ausgelacht wurden, erkannte er, dass sein Gefährte – genau wie alle anderen Hunde – ein einzigartiges Individuum war. Er schwor sich, nie wieder an Hundekämpfen teilzunehmen.
Ich erzähle diese Geschichte nicht, um die Vorzüge von Pitbull Terriern oder anderen Rassen zu diskutieren. Vielmehr soll sie illustrieren, dass ungezügelter „Rassismus” – zum Beispiel die Behauptung, dass alle Hunde einer bestimmten Rasse freundlich oder aggressiv gegenüber Artgenossen seien – ausgesprochen irreführend sein kann.22 Derartige Verallgemeinerungen machen manches einfacher, können im Falle falscher Vorurteile jedoch verheerende Konsequenzen für Hunde einer bestimmten Rasse haben. Mein Freund Marty brachte es auf der hiesigen Hundewiese auf den Punkt: „Kein Hund ist wie der andere.”
In der Praxis ist es unumgänglich, Verallgemeinerung zum Verhalten der Hunde zu vermeiden. James Crosby, ein approbierter Verhaltensberater und pensionierter Polizeileutnant, der zudem einen Mastertitel in veterinärwissenschaftlicher Forensik von der University of Florida trägt, erklärte mir, dass es in seinen Untersuchungen von Todesfällen infolge Hundebissen entscheidend wäre, jeden Fall und jeden Hund individuell zu evaluieren. Es gäbe keine schnellen und allgemeinen Erklärungen für tragische Vorfälle.23
Genauso ungern spreche ich über „den” Kojoten, „den” Wolf, „das” Rotkehlchen” oder „den” Goldfisch. Die Forschung zeigt, dass die Bandbreite innerhalb ein und derselben Art – Wissenschaftler sprechen von intraspezifischer Variation – bei den verschiedensten Tieren, darunter Fische, Insekten und Spinnen, gewaltig groß ist. Wieder und wieder stellten meine Studierenden und ich bei unseren Beobachtungen wilder Kojoten im Grand Teton Nationalpark nördlich von Jackson, Wyoming, fest, dass allgemeine Aussagen über das Verhalten der Kojoten relativ nichtssagend sind – ganz besonders im Zusammenhang mit ihrem Sozialverhalten. Bereits im Alter von drei Wochen zeichnen sich individuell unterschiedliche Temperamentstypen unter den jungen Kojoten ab, die erstmals ihre Umgebung erkunden: Manche sind scheu, andere mutig. Wilde Tiere lassen sich genauso wenig in Schubladen stecken wie domestizierte Hunde: Die Spezies allein kann nicht erklären, wer sie sind und warum sie bestimmte Verhaltensweisen zeigen.
Konzentrieren wir uns auf die wechselseitigen Beziehungen, die wir mit Hunden führen, so erreichen wir ein tieferes Verständnis der Hunde als Individuen und lernen, sie als solche zu schätzen. Wir müssen nicht nur verstehen, wer sie sind, sondern auch, wie sie ihrerseits ein Verständnis davon entwickeln, wer wir sind. Wenn wir Hunde erforschen – dazu gehören auch unsere Beobachtungen auf der Hundewiese –, gehen wir Beziehungen zu ihnen und auch zu anderen Menschen ein. Diese Beziehungen beeinflussen wiederum das, was Hunde tun und auch unser Verständnis ihres Verhaltens. Diese Sichtweise erfordert, dass wir alle Erwartungen und Vorurteile ablegen. Ich versuche immer, mich in die Pfoten, Köpfe und Herzen der Individuen, die mir begegnen, hineinzuversetzen, ihre Höhen und Tiefen von ausgelassener Freude bis hin zu erdrückender Trauer nachzuempfinden und ihnen so viel Empathie entgegenzubringen wie möglich. Hunde teilen häufig mit uns, was sie denken und fühlen – wir müssen nur lernen, sie zu verstehen.
Es wird den Leser kaum überraschen, dass ich mir ständig Gedanken über jene Dinge mache, von denen ich hier schreibe, und mich frage, was in den Köpfen und Herzen der Hunde vor sich geht. Als ich eines Morgens mit dem Rad durch Boulder fuhr, begegnete ich Vivienne Palmer und ihren beiden Gefährten – Bartleby, ein winziger Hund, und Blue, eine riesige Dogge, die ihren kleinen Freund um ein Vielfaches überragt. Ich lächelte, als mir bewusst wurde, dass Bartleby and Blue so unterschiedlich aussahen und doch zur selben Spezies gehörten, hielt an und bat Vivienne, sie fotografieren zu dürfen. Gern war sie einverstanden. Viviennes Gefährten erinnern daran, wie irreführend es sein kann, über „den” Hund zu sprechen.
Bürgerwissenschaft auf der Hundewiese
Was, wenn wir denen, die keine eigene Stimme haben, erst zuhörten, bevor wir für sie sprächen und behaupteten, zu wissen, was sie sagen würden?
Matt Margini24
„Viele Menschen sprechen mit Tieren”, sagte Puuh.
„Ja, aber …”
„Aber nur wenige hören zu”, sagte er.
„Das ist das Problem”, fügte er hinzu.
Benjamin Hoff, Tao Te Puh. Das Buch vom Tao und von Puh dem Bären.25
Hundewiesen und andere Orte, an denen Zwei- und Vierbeiner zusammenkommen – von Gärten über Wanderrouten bis hin zu Radwegen – bergen das Potenzial einer Vielzahl von Begegnungen, Gesprächen und Auseinandersetzungen. Hunde neigen dazu, sich jedem vorzustellen, was wiederum dazu führen kann, dass auch deren Menschen einander kennen lernen. Aus diesem Grund bezeichnen Forscher Hunde oft als „soziale Katalysatoren”.26 Sie brechen das Eis und machen es ihren Zweibeinern einfacher, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ganz besonders scheint dies für Hundeauslaufgebiete zu gelten. Die meisten Halter besuchen die Hundewiese, um ihren Vierbeinern Spaß und Sozialkontakte zu ermöglichen und schließen dabei ganz automatisch auch selbst neue Bekanntschaften.
Worum sich die Gespräche auf der Wiese drehen? Natürlich in erster Linie um Hunde. Meist geht es um Verhalten, Rassen, den Hintergrund der einzelnen Vierbeiner, den Umgang mit Problemen und die Beziehung der Hunde zu deren Menschen. Der aufmerksame Beobachter lernt in der Hundezone nicht nur Neues über seinen eigenen Gefährten, sondern auch über den Umgang von Hunden untereinander, über zwischenmenschliche Beziehungen sowie über die Eigenheiten, Vorlieben und Fähigkeiten all jener Hunde, die um ihn herum über die Wiese tollen.
Vivienne Palmer und ihre Hunde Bartleby (ein vierjähriger Chihuahua-Dackel-Mix aus dem Tierschutz; links) und Blue (eine sechseinhalbjährige Deutsche Dogge aus dem Tierschutz).
Ich ermuntere die Menschen, denen ich begegne, immer dazu, in die Rolle eines Wissenschaftlers zu schlüpfen und aus den Hundewiesen-Besuchen zu lernen, um die eigene Beziehung zu ihrem Hund zu verbessern. In Auslaufgebieten gemachte informelle Beobachtungen können sogar noch größere Auswirkungen haben, indem sie Forscher inspirieren und zum Katalysator systematischer Studien werden. In Kapitel acht wollen wir uns damit auseinandersetzen. Hundewiesen sind ausgezeichnete Schauplätze für Studien in kognitiver Ethologie – der Wissenschaft vom Verstand der Tiere – und Anthrozoologie, der Wissenschaft von der Mensch-Tier-Beziehung.
Bürgerwissenschaft auf der Hundewiese und zuhause kann sogar den Beginn einer Forscherkarriere darstellen. Ein Beispiel dafür ist die renommierte Primatologin und Naturschutzbiologin Jane Goodall, die von ihrem Hund Rusty beeinflusst wurde: Rusty, ein Gefährte ihrer Kindheit, war einer der Ersten, die ihr Interesse an Tieren weckten.27 In Dr. Goodalls eigenen Worten: „Bereits als Kind lernte ich viel über das Verhalten der Tiere: Mein Hund Rusty war ein großartiger Lehrer.”28 Elizabeth Abbott erzählt in Dogs and Underdogs mehr davon, wie Dr. Goodalls Hund den Grundstein ihrer wissenschaftlichen Laufbahn legte:
Rusty lehrte die junge Jane, dass Hunde in der Lage sind, sich an Dinge zu erinnern, auch wenn sie diese nicht mehr sehen können. So konnte er etwa einen im oberen Stockwerk aus dem Fenster geworfenen Ball apportieren, indem er ohne diesen zu sehen eine Reihe strategischer Entscheidungen im Haus und Garten traf, die ihn schließlich zu seinem Ball führten. Rusty hatte einen Gerechtigkeitssinn, der ihn einerseits sein eigenes unerwünschtes Verhalten erkennen und andererseits Janes gelegentliche wütende oder unfaire Reaktionen ablehnen ließ. Er zeigte sich intelligent, wenn es um das Vorführen von Tricks ging und ließ sich gern einen Pyjama anziehen. Lachte jedoch jemand über sein Outfit, so stolzierte er von dannen und zog den Pyjama wie eine Schleppe hinter sich her.
Die wichtigste Lektion, die Rusty Jane lehrte, war, die Behauptungen der damaligen Wissenschaftler, dass Tiere weder mit individuellen Charakteren noch Emotionen oder Intelligenz gesegnet wären, nicht ernst zu nehmen. Stattdessen gab sie ihren Schimpansen Namen – Fifi, Flo, Figan, David Greybeard – und dokumentierte und interpretierte deren Verhalten und Aktivität auf jene Art, die später das Tierverständnis der Wissenschaft revolutionieren sollte. Ihre Vision und ihre Methoden, die einst als anthropomorphe Wissenschaftssünde angeprangert wurden, fanden ihren Weg in den Kanon der wissenschaftlichen Forschung und entwickelten sich schließlich zu deren Goldstandard.29
Bereits 1928 schrieben C.J. Warden und L.H. Warner, zwei Psychologen an der Columbia University: „Ein großer Teil davon, was der durchschnittliche Halter über seinen eigenen Hund sowie Hunde im Allgemeinen ,weiß’, ist Tierpsychologen nicht bekannt.”30 Das Zitat illustriert, wie viel wir von Bürgerwissenschaftlern über Hunde lernen können. Wir beginnen, zu erkennen, in welchem Ausmaß die Beobachtungen von Menschen, die ihr Leben mit Vierbeinern teilen, die rigorosen Daten detaillierter wissenschaftlicher Studien untermauern und ergänzen können. Im Jahr 2015 kam eine Gruppe internationaler Wissenschaftler zu dem Schluss, dass „Bürgerwissenschaftler in Zukunft nützliche Daten sammeln, Hypothesen testen und Fragen beantworten und so konventionelle Praktiken und Versuche zur Psychologie des Hundes ergänzen werden.”31
Vor vielen Jahren erzählte mir eine Frau, dass ihr Hund dazu neige, sich umzusehen und das Hinterbein zu heben, als würde er pinkeln, ohne dies jedoch zu tun. Einige Sekunden später pinkle er einen ganzen Eimer voll. Die Frau meinte, sie hätte den Eindruck, dass er dies nur dann täte, wenn andere Hunde in der Nähe wären. Ich hatte dasselbe Verhaltensmuster bei Hunden und Kojoten beobachtet, ihm aber bisher kaum Beachtung geschenkt. Später untersuchte ich dieses Phänomen gemeinsam mit meinen Studierenden. Wir bezeichneten es als „Trockenmarkieren” und definierten es als Verhalten eines meist männlichen Hundes, der ein Bein hebt, aber nicht pinkelt. Wie wir in Kapitel fünf sehen werden, hatte die Frau mit der Beobachtung ihres Hundes den Nagel auf den Kopf getroffen.
Unser Interesse an Hunden und unsere Leidenschaft für sie zeigt sich auf ganz unterschiedliche Art. So erfuhr ich etwa während einer Radtour mit Rennradfahrer Rohan Dennis, dass dieser die Tätowierung eines Pitbull/Staffie-Mischlings am rechten Bizeps trug. Er hatte sich diese nach der Begegnung mit einem „bösen Clown” stechen lassen, welcher besagten Hund an der Leine führte.32 Ich fragte Rohan, ob er den Hund kenne oder ein Fan dieser Mischung sei. „Nein”, antwortete er. Die Begegnung mit dem Hund hatte ihn auf unerklärliche Art berührt, und er wollte eine Tätowierung, um sich daran zu erinnern. Später schrieb er mir: „Ich wollte damals auch gar kein Tattoo, das eine Bedeutung für mich selbst hatte – ich war erst achtzehn, und in diesem Alter ist man ziemlich naiv dem Leben gegenüber.” Ich mag Rohans Geschichte, weil er sich dafür entschied, diesen Hund in Erinnerung zu behalten, indem er ihn auf seinem rechten Oberarm verewigte. Hunde inspirieren uns und wecken Gefühle – auch wenn wir manchmal gar nicht wissen, warum.
Immer wieder zeigt mir jemand das Tattoo seines Hundes. Hin und wieder sehe ich sogar Tabellen oder Diagramme, die das Verhalten eines Hundes in unterschiedlichen Situationen zeigen. Die entsprechenden Halter lieben, was sie tun, und ich bin mir sicher, dass ihre Hunde von den Beobachtungen profitieren. Auch wenn Sie, lieber Leser, nicht ganz so weit gehen wie Rohan oder die Hobby-Ethologen – ich möchte Sie auf jeden Fall dazu ermuntern, Zeit mit Hunden zu verbringen – mit Ihren eigenen und mit anderen. Lernen Sie die Tiere beobachten und lesen, genau wie diese uns ihrerseits beobachten und lesen lernen. Für den Fall, dass Sie wissen möchten, wie ein Ethologe Tiere beobachtet, finden Sie im Anhang eine kleine Einführung in die Ethologie.
Kurz gesagt: Um das, was ich als die grundlegende Ethologie des Hundes bezeichne, zu entdecken, müssen wir uns darauf konzentrieren, was Hunde wissen, fühlen und tun. Das erfordert es, Hunde lesen zu lernen und soweit wie möglich „selbst zum Hund zu werden”. Ich meine nicht, dass wir uns wie Hunde verhalten sollten – wir müssen nicht an jenen Stellen riechen, an denen sie schnuppern, oder hündische Verhaltensweisen an den Tag legen. Vielmehr glaube ich, dass wir lernen sollten, Hunde zu lesen und deren Perspektive einzunehmen, indem wir sie ganz genau beobachten. Wir kombinieren das, was uns die Wissenschaft zum Verhalten der Hunde sagt, mit dem, was wir Hunde in bestimmten Situationen tun sehen und sehen uns das Ganze durch die Linse des gesunden Menschenverstandes an. Die Herausforderung liegt darin, all diese Perspektiven und die relevanten Daten zu vereinen und sicherzustellen, dass das Ergebnis dem Hund entspricht, den wir vor uns haben. So können wir verstehen, was ein bestimmter Hund fühlt und warum er tut, was er tut. Es gibt immer Neues zu lernen!
Ich möchte kein Blatt vor den Mund nehmen: Ich wundere mich immer wieder, wie selten Halter ihre Hunde wirklich genau beobachten. Noch erschreckender finde ich es, dass auch Trainer – ich bezeichne diese gern als Lehrer – kaum Zeit damit verbringen, Hunde außerhalb des Trainingsplatzes zu beobachten. Das soll natürlich nicht heißen, dass sie ihre Sache nicht gut machten – aber ich zweifle nicht daran, dass es ihr Verständnis von Vierbeinern, Hund-Mensch-Beziehungen und Problemlöseansätze einschränkt, diese immer nur in ein- und derselben Umgebung zu sehen. Wenn wir mit Hunden zusammenleben oder beruflich mit ihnen zu tun haben, ist es unumgänglich, sie in den unterschiedlichsten Situationen zu beobachten. Ihr Verhalten in Wohlfühl-Momenten sowie problematischen Situationen zu beobachten macht nicht nur Spaß, sondern hilft uns auch, zu verstehen, was in ihnen vorgeht.
Dieses Wissen ist weder esoterisch noch akademisch. Vielmehr ermöglicht es uns, unsere Aufgabe – die Aufgabe, für unsere Tiere zu sorgen – besser zu erfüllen. In den Worten von Q. Sonntag und K. Overall: „Objektive Kriterien für artgerechte Tierhaltung sollten auf Basis eines besseren Verständnisses tierischen Verhaltens formuliert werden. Sowohl Halter als auch Experten, die beruflich mit Tieren arbeiten, können dadurch die Bedürfnisse von Hunden und Katzen besser erfüllen und Probleme besser identifizieren. So lässt sich die Lebensqualität der Tiere steigern. Verantwortungsvolle Zuchtkriterien, welche die genetische Vielfalt erhöhen und jene Eigenschaften selektieren, die Hunden und Katzen dabei helfen, ihre Nische in einer sich verändernden Welt zu füllen, sollten im Sinne des Tierschutzes auf wissenschaftlichen Beweisen basieren.”33
Sich um Hunde kümmern: Ein Leitfaden für Zweibeiner
Wie meine Eltern vor vielen Jahren feststellten, dass ich mich als Kind um alle Tiere kümmerte, so ermuntere ich Hundehalter heute immer wieder, sich um ihre Hunde und anderen tierischen Gefährten zu kümmern. Wie ich bereits erwähnt habe, meine ich damit, dass wir uns bemühen sollten, das kognitive und emotionale Leben der Tiere so gut wie möglich zu verstehen. Was wissen sie, und was fühlen sie? Dazu gehört auch, dass wir uns bewusst machen, dass sich unsere Hunde ihrerseits auch um uns kümmern. Dabei dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass wir die Verantwortung für das Wohlbefinden unserer Tiere tragen. Sie sind völlig von uns abhängig. Diese Abhängigkeit bringt eine große Verantwortung mit sich: Sie ist kein Freibrief, all das mit den Tieren zu machen, wonach uns gerade ist. Wir müssen Hunde dafür respektieren und lieben, wer sie sind, nicht dafür, was wir aus ihnen machen wollen.
Der Umgang mit Tieren, den ich mir wünsche, beginnt bei der Sprache, derer wir uns bedienen. Anstatt von Besitzern zu sprechen, spreche ich im Bezug auf Hunde und andere Tieren, die mit dem Menschen zusammenleben, gern von Hundeeltern oder Herrchen und Frauchen. Häufig meinen wir alle Lebewesen mit Ausnahme des Menschen, wenn wir von „Tieren” sprechen. Natürlich gehören auch wir zu den Tieren, und wir sollten stolz auf unsere Zugehörigkeit zur Fauna sein.34 Daran erinnere ich Leser und Zuhörer hin und wieder, indem ich bewusst formuliere: “Tiere – dazu gehört auch der Mensch - …”. Wenn ich von einem individuellen Tier spreche, dessen Name bzw. Geschlecht mir bekannt sind, so verwende ich lieber subjektive Pronomen – er oder sie – als objektive Pronomen wie „es”.35 Direkte Zitate habe ich in diesem Buch jedoch nicht im Sinne meiner präferierten Wortwahl geändert. Gelegentlich nutze ich auch selbst die Worte „Haustier” und „Besitzer”, wenn diese passender oder klarer sind als die Alternative. Dennoch weise ich bereits lange darauf hin, dass Medien, Journalisten und Wissenschaftler darauf achten sollten, dass Sprache unausgesprochene Vorurteile transportieren kann – so etwa ein Verständnis von Tieren als Objekten. Ich freue mich, dass der Trend hiervon wegführt.
In diesem Buch bespreche ich das Verhalten der Hunde mit einem Fokus auf dessen praktische Implikationen: Wie können wir unser Wissen einsetzen, um die Lebensqualität unserer Hunde zu steigern? Wie können wir zugleich ihre individuellen Eigenheiten in die Entscheidungen einfließen lassen, die wir für sie treffen? Wie erkennen wir, was das einzigartige Lebewesen, mit dem wir zu tun haben, braucht und sich wünscht? Entscheiden wir, einen Hund in unser Zuhause und unser Herz aufzunehmen, so sind wir verpflichtet, alles zu tun, was wir können, um ihm ein schönes Leben zu ermöglichen. Für mich handelt es sich dabei um eine Verantwortung, der wir uns nicht entziehen können. Keine Zeit zu haben oder davon auszugehen, dass unser eigenes Leben wichtiger ist als das eines Hundes, ist kein Argument. Schließlich können wir ganz einfach Entscheidungen treffen, die unseren Tieren das ermöglichen, was sie wollen und brauchen. Hunde können uns auch viel über das Leben im Allgemeinen beibringen.
Einerseits handelt es sich beim vorliegenden Werk um ein Hundebuch zum besseren Verständnis, andererseits hoffe ich doch sehr, dass das darin enthaltene Wissen praktische Anwendung findet. Darum finden sich in Kapitel neun, „Ein Leitfaden für Hundeliebhaber”, spezifische Ratschläge zum Umgang und Leben mit Hunden sowie meine Gedanken zu deren Training bzw. Erziehung. Mir wurde sogar geraten, das ganze Buch einen „Leitfaden für Hundebesitzer” zu nennen – aber das wäre nicht ganz richtig. Aus Hundeperspektive ist ein Vierbeiner kein Ding, das besessen werden kann, und „Besitz” kann und soll unserer Beziehung auch gar nicht gerecht werden. Wir besitzen ein Sofa oder einen Elektroherd, und wenn diese Dinge kaputtgehen, reparieren oder entsorgen wir sie, um sie durch neue zu ersetzen. Das Zusammenleben mit einem Hund hingegen ist ein lebenslanges Versprechen, welches voraussetzt, dass wir uns immer wieder neu miteinander befassen.
Gewissermaßen handelt es sich bei diesem Buch auch um einen Leitfaden zur Freiheit: Verstehen wir, was es heißt, als Hund in einer von Menschen dominierten Welt zu leben und dass beim Zusammenleben von Mensch und Hund beide Abstriche machen müssen, so sind wir bereits auf dem besten Weg zu größerer Freiheit für Zweiund Vierbeiner. Die Erkenntnis, dass eine dauerhafte positive und bereichernde Beziehung ein Geben und Nehmen erfordert, führt zu mehr Freiheit für beide.
Ich arbeite zwar nicht als Trainer, bin jedoch ein Wissenschaftler, der sich für eine positive Erziehung einsetzt, die ohne Dominanz oder Einschüchterung auskommt. Allerdings gibt es kein Patentrezept im Hundetraining. Wie Kinder benötigen auch manche Hunde ein wenig mehr Unterstützung im Unterricht, mehr Fürsorge und Liebe als andere, um das Zusammenleben mit Artgenossen oder ihren Menschen zu lernen. Ausnahmslos alle Hunde verdienen zudem einen wertschätzenden Umgang. Wenn ich davon schreibe, was Hunde wollen und brauchen, konzentriere ich mich auf ihre Gefühle als Indikator dafür, wie wir sie behandeln sollten. Intelligenz ist nicht wirklich relevant dafür, wie sehr ein Individuum leidet. Die Frage, ob ein weniger intelligenter Hund weniger leidet als ein besonders intelligenter, ist hinfällig. Wie sehen wir dieses Thema im Zusammenhang mit Menschen unterschiedlicher Intelligenz? Machen wir uns zur Leitlinie, dass alle Geschöpfe dieselbe Leidenskapazität haben. Hunde leiden nicht mehr als Ratten oder Mäuse und nicht weniger als Menschen.
Für diejenigen Leser, die ihr Leben mit Hunden oder anderen Tieren zu teilen vorhaben, sehe ich dieses Buch als präventive Lektüre zum humanen Umgang mit denselben. Es ist nicht genug, dass uns ein Hund (oder anderes Tier) wichtig ist: Wir müssen dieses Gefühl zu Taten werden lassen, um allen Individuen ein glückliches Leben zu ermöglichen. Am Ende dieses Buches findet sich darum ein Aufruf zum aktiven Einsatz für das Wohl der Hunde.
Die Entscheidung, ein Tier in unser Haus und unser Herz aufzunehmen, scheint oft ausgesprochen simpel: Wir suchen einen Gefährten, um ihn zu lieben und hoffen, dass uns dieser ebenfalls lieben wird. Doch die daraus entstehende Beziehung und unsere Verpflichtungen können schnell kompliziert werden. Meine Kollegin Dr. Jessica Pierce bringt dies in ihrem Buch Run, Spot, Run: The Ethics of Keeping Pets auf den Punkt: „Sind Sie bereit dazu, die Lebensqualität eines Mitgeschöpfes zu maximieren?” Eignen sich Ihr Zuhause und Ihre Lebensumstände für ein Tier? Haben Sie die möglicherweise auf Sie zukommenden Kosten in Betracht gezogen? Sind Sie bereit, am Lebensende Ihres Gefährten schwere Entscheidungen zu treffen? Auf den angehenden Hundehalter kommen schwierige praktische und ethische Fragen zu. Manchmal stellen wir fest, dass wir nicht ausreichend darüber nachgedacht haben, was es bedeutet, die volle Verantwortung für das Leben eines Mitgeschöpfes zu übernehmen.
Ein Beispiel – vor allem dafür, wie uns Bürgerwissenschaft und ethologische Beobachtungen auf der Hundewiese helfen können, gute Fragen zu stellen, welche wiederum unsere Hundehaltung beeinflussen und uns helfen, unseren Vierbeinern das bestmögliche Leben zu schenken – ist folgende E-Mail. Meine Kollegin Jessica Pierce erhielt sie im Jahr 2016 und leitete sie mir weiter. Ich möchte sie nun mit all meinen Lesern teilen.
„Mein elfjähriger Enkelsohn adoptierte vor einigen Jahren einen Hund. Er lebt mit seiner Familie in New York City, und ich lebe in New Jersey. Oft gehe ich mit dem Hund spazieren – wir gehen entweder auf die Hundewiese oder in den Central Park. Im Hundeauslauf spielt und läuft er mit den anderen Hunden; manchmal rempeln sie einander richtig wild an. Er schnüffelt an seinen Artgenossen und versucht manchmal, ihnen aufzureiten. Die meisten Hundebesitzer schreiten ein, wenn ein Hund dies versucht.
Im Central Park hingegen läuft er einfach neben mir her. Begegnet uns ein anderer Hund, sieht er diesen kurz an und läuft mit mir weiter. Nur hin und wieder versucht er, mit einem Artgenossen zu spielen.
In letzter Zeit frage ich mich, ob die Art und Weise, wie wir unsere Hunde und Katzen aufziehen – vor allem, wenn wir in der Stadt wohnen – vielleicht nicht richtig ist.
Der Gedanke kam mir, als ich mir die Frage stellte, wie unsere Hunde intellektuell gesehen aufwachsen. Hunde sind domestizierte Tiere. Aber heißt das, dass sie alles von uns, den Menschen, lernen? Gibt es nicht Dinge, die sie von ihren Artgenossen lernen sollten – ganz gleich, ob sie soziale Tiere sind oder nicht? Der Intellekt und das Wissen der Menschen wird von Generation zu Generation weitergegeben und wächst dadurch ständig. Mein Enkelsohn wird sicher einmal viel mehr wissen als ich. Aber sein Hund hat selten Kontakt zu anderen Hunden. Wenn wir nicht auf die Hundewiese gehen, ist er isoliert von seinen Artgenossen.
Ich frage mich also, wie sich ein Hund intellektuell entwickeln kann, ohne Kontakt zu anderen Hunden zu haben, von denen er lernen könnte. Führt das dazu, dass ein Hund schließlich so denkt und sich so verhält wie sein ständiger Begleiter, der Mensch? Außerdem hat der Hund nur die Dauer seines eigenen Lebens, um zu lernen, und kann nicht von all dem Wissen profitieren, welches andere Hunde gesammelt haben.
Ist es die größte Tragödie des Hundes, dass ihm das Lernen von seinen Artgenossen verwehrt wird?“36
Das große Ganze: Hunde in unserer Gesellschaft und Welt
Hunde sind fantastische Geschöpfe und ich schätze all jene Menschen, die sich dafür einsetzen, die Lebensqualität von Hunden im Allgemeinen zu steigern. In einer Welt, die viele Anforderungen an Hunde stellt, ist das nicht einfach. Am Ende dieses Kapitels und am Ende dieses Buches möchte ich mich mit der Rolle der Hunde in unserer Welt im Allgemeinen beschäftigen – schließlich führen viele Diskussionen auf der Hundewiese zurück zu diesem grundlegenden Thema.
Hunde bereichern nicht nur das individuelle Leben ihrer Menschen, sondern inspirieren uns auch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. So organisierte etwa Heinrich Zimmermann, ein Deutscher Schriftsteller und Herausgeber des Mensch und Hund-Magazins, am 4. den ersten Welttierschutztag.37 Bis heute wird dieser jährlich begangen. Ein Dalmatiner namens Pepper spielte eine große Rolle in der Tierschutzgesetzgebung der Vereinigten Staaten: Die Hündin wurde 1965 von einer Farm in Pennsylvania gestohlen und an ein Krankenhaus in der Bronx verkauft, wo sie in einem Herzschrittmacher-Experiment ums Leben kam. 1966 wurde dank Pepper, deren Schicksal das Mitgefühl der Menschen weckte, das Tierschutzgesetz ins Leben gerufen. Die Dalmatinerhündin half uns, zu erkennen, dass alle Spezies fühlen und leiden.
Immer wieder helfen uns Hunde dabei, eine Kluft zu überbrücken. So ist etwa eines der wenigen Dinge, worüber sich die Demokraten und Republikaner im US-amerikanischen Kongress einig sind, dass die Abgeordneten ihre Hunde ins Kapitol mitbringen dürfen. Dies ist bereits seit dem 19. Jahrhundert üblich. Im August 2016 wählte die Stadt Cormorant in Minnesota Duke, einen neunjährigen Pyrenäenberghund, zum dritten Mal zum Bürgermeister.38 In der Zeit danach hörte ich von vielen Menschen, dass sie es für eine ausgezeichnete Idee hielten, Regierungspositionen mit Hunden zu besetzen.
Hunde sind „in”, wie ich gerne sage. Knapp achtzig Millionen amerikanische Haushalte – das sind 65 Prozent aller US-amerikanischen Haushalte – leben mit einem Haustier zusammen. 44 Prozent der Haushalte haben einen Hund.39 Ganze 78 Millionen Hunde leben als Haustiere in den Vereinigten Staaten. Das heißt, dass sich mit Hunden auch ein gutes Geschäft machen lässt, und die Menge dessen, was aus amerikanischen Brieftaschen in den „Hundesektor” fließt, ist gewaltig. Amerikaner geben jährlich beinahe 70 Milliarden Dollar für ihre Tiere aus; darunter 30 Milliarden für Futter und mehr als 17 Milliarden für veterinärmedizinische Versorgung.40
Das Leben mit Hund kann teuer sein: Die jährlichen Kosten belaufen sich auf geschätzt 1.600 Dollar.35 Und nicht nur das: In den USA steigt der Betrag, der für die medizinische Versorgung von Haustieren ausgeben wird, schneller als jener, der für den Menschen selbst ausgegeben wird:41 Zwischen 1996 und 2012 stiegen die Ausgaben des Kauf von Haustieren, Sanitätsmaterial und tierärztliche Versorgung um 60 Prozent, während die Ausgaben für die medizinische Versorgung der Menschen um nur 50 Prozent stiegen.42 Zudem sind Menschen auf der ganzen Welt dazu bereit, ein Risiko einzugehen, um eigene oder fremde Haustiere zu retten, wenn deren Leben in Gefahr ist.43
In vielen Ländern der Welt steigt die Zahl der Hundehalter. Im Jahr 2012 gab es 35 Millionen Hunde in Brasilien, 27 Millionen in China und 15 Millionen in Russland. In Indien verdoppelte sich die Anzahl der Hundehalter seit 2007 oder wuchs sogar noch stärker, und in Venezuela und den Philippinen stieg sie um 30 Prozent oder mehr.44
Hunde nehmen für den Menschen eine Sonderstellung ein: Wir sehen und behandeln sie anders als andere Tiere. Manche Menschen priorisieren die Versorgung ihrer Hunde sogar gegenüber anderen Familienmitgliedern45 und eine Studie zeigt, dass Kinder sich mit dem Familienhund besser verstehen als mit ihren Geschwistern.46 Vielleicht ist das auch gar nicht verwunderlich: Die Forschung verrät uns auch, dass die soziale Unterstützung durch einen Hund in schwierigen Zeiten den Stress Jugendlicher stärker reduziert als die Gegenwart eines Elternteils.47 Zudem machen viele Menschen ihren Wohnort davon abhängig, wie tierfreundlich dieser ist, und immer öfter werden die Bedürfnisse von Familienhunden bereits in der Planung von Wohngebäuden und Siedlungen berücksichtigt.48
Leider folgt daraus nicht, dass die heutigen Hunde verwöhnt werden. Sie sind zwar „in”, doch wie so viele andere Tiere sind sie die Opfer einer vom Menschen dominierten Ära. Diese wird als Anthropozän oder Zeitalter des Menschen bezeichnet. Tatsächlich könnte man das Anthropozän die „Ära der Unmenschlichkeit” nennen: Es gibt zu viele Menschen, und andere Tiere ziehen allzu oft den Kürzeren oder hängen, im Falle des Hundes, am kürzeren Ende einer ohnehin schon sehr kurzen Leine.
All den Hunden, die ihr Zuhause bestens versorgt mit ihrer zweibeinigen Familie teilen, zum Trotz wird vermutet, dass etwa 75 Prozent aller Hunde kein Zuhause haben. Sie leben ein hartes Leben in Schmutz und Elend, sind schwer krank und leiden große physische und psychische Schmerzen.49 In Yangon, Myanmar, leben etwa 120.000 mit Tollwut infizierte Streuner, die immer wieder Kinder angreifen.50 In Taiwan wurden 2015 etwa 10.900 Streuner eingeschläfert, und 2016 starben 8.600 Tierheimhunde aufgrund von Krankheiten und anderen Ursachen.51
Hunde werden nicht nur von Menschen vernachlässigt, sondern auch auf direktere Art und Weise geschädigt: Sie werden in Kämpfen eingesetzt, in Hunderennen zu Tode gehetzt oder dazu gezwungen, in Shows und Filmen aufzutreten.52 Sogenannte Designerhunde wie Labradoodles und Goldendoodles sind derzeit sehr populär. Allerdings kann das bewusste Kreuzen zweier Rassen, um bestimmte Eigenschaften zu erhalten, auch zu unerwünschten bzw. gesundheitsschädlichen Eigenschaften führen.53 In Schottland ist die Nachfrage nach Designerhunden so groß, dass viele ohne Genehmigung züchten. Mark Rafferty, der Vertreter einer schottischen Tierschutzorganisation, stellt fest, dass die Hunde von vielen als „Wegwerfgüter” gesehen werden.54
Nach wie vor werden Hunde gezüchtet, für die die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie aufgrund von Inzucht und Selektion von Eigenschaften, die ihnen das Atmen oder Gehen erschweren, ein kurzes und unglückliches Leben haben werden.55 In der Zucht dieser Hunde wird „Schönheit über Gesundheit gestellt … und das geht auf Kosten der Empathie.”56
Menschen geben Millionen Dollar dafür aus, ihre Falten loszuwerden. Andererseits produzieren wir absichtlich Hunde mit faltigen Gesichtern, von denen wir wissen, dass sie leiden und jung sterben werden. Und das ist noch lange nicht alles. An der A&M University in Texas werden bewusst Hunde mit Missbildungen gezüchtet, um verschiedene Formen von Muskeldystrophie zu erforschen. Viele dieser Hunde sind bereits im Alter von sechs Monaten schwerst behindert, und wenige werden älter als zehn Monate.57 Das ist wahrlich keine Art, den „besten Freund” des Menschen zu behandeln! Ich weise auch gern darauf hin, dass manche Menschen ihre Hunde zu Tode lieben. So liegt etwa die durchschnittliche Lebenserwartung Französischer Bulldoggen bei 2,5 Jahren für Rüden und 3,8 Jahren für Hündinnen.58
Wenn sich ein Hund nicht immer wie unser bester Freund verhält, sollten wir uns ins Gedächtnis rufen, dass wir, die Menschen, auch nicht die besten Freunde der Vierbeiner sind. Weder Hunde noch Menschen lieben bedingungslos. Es mag zwar schwierig sein, einen Hund zu finden, der nicht zumindest eine gewisse Freundlichkeit an den Tag legt – aber Hunde unterscheiden zwischen Menschen, genau wie wir zwischen Hunden unterscheiden. Manche Hunde gewinnen in Folge schlimmer Misshandlungserfahrungen nie wieder das Vertrauen, welches eine Voraussetzung dafür ist, einen Menschen oder Artgenossen bedingungslos lieben zu können.59
Es muss auch wiederholt werden, dass Hunde sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene stärker von uns abhängig sind als wir von ihnen. Elise Gatti, eine Studentin an der University of Utah, stellte in einer Mail an mich fest: „Wir sind der ganze Lebensinhalt unserer Hunde, aber sie sind nur ein kleiner Teil unseres Lebens.”60 Ich bin ganz ihrer Meinung, und wir sollten diese Tatsache niemals vergessen. Diese Abhängigkeit verpflichtet uns dazu, unseren Hunden ein schönes und glückliches Leben zu ermöglichen.
Dabei stellt sich die Frage, wie gut wir wirklich darüber Bescheid wissen, was in den Köpfen, Herzen und Nasen unserer Gefährten vor sich geht. Was bedeutet es, ein Hund zu sein?
Beginnen wir damit, wie Hunde ihre fünf Sinne einsetzen, um die Welt zu verstehen. Wie Hunde die Welt wahrnehmen ist natürlich untrennbar damit verbunden, wie sie sich verhalten und was sie in verschiedenen Situationen tun. Um uns bewusst zu machen, wie es ist, ein Hund zu sein, müssen wir verstehen, wie Hunde sehen, hören, tasten, schmecken und vor allem riechen. Hunde sind Tiere, deren Nase nichts verborgen bleibt.