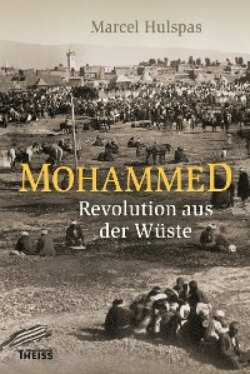Читать книгу Mohammed - Marcel Hulspas - Страница 10
3 Arabien und die Araber
ОглавлениеDies ist das Monument von Imru al-Quais, Sohn von Amr, König aller Araber.
Inschrift auf Imru al-Quais’ Grab in Syrien
Die Arabische Halbinsel liegt eingeklemmt zwischen dem Roten Meer im Westen und dem Persischen Golf im Osten. Der Form nach erinnert sie an ein sinkendes Schiff: Im Westen ragt der Vordersteven hoch auf aus dem Meer, 1200 Kilometer östlich gleitet das Achterdeck langsam unter den Wasserspiegel des Persischen Golfs. Das Rote Meer ist gut zwei Kilometer tief. Daran grenzen mit Gipfeln bis zu drei Kilometern das Hedschas-Gebirge und der Jemen mit Dutzenden schlafender Vulkane. Hinter den Gebirgen ostwärts liegen ausgedehnte Hochebenen, dahinter flache Fels- und Sandwüsten bis an den Persischen Golf – ein warmes, extrem salziges Meer, kaum tiefer als achtzig Meter.
Fast nirgends auf der Arabischen Halbinsel fällt mehr als zehn Zentimeter Regen pro Jahr. Im Westen, wo die Berge die Wolken aufhalten und leerschütteln, und an der Südküste von Oman, über den die Monsunregen hinwegziehen, fällt mehr Regen als in den östlichen Gebieten. Im Westen findet man zwischen den Bergrücken einige große und fruchtbare Oasen, im Osten sind es weitaus mehr. Dieser Westen, der Hedschas, war immer der am dünnsten besiedelte und unwirtlichste Teil der Halbinsel. Doch es ist zugleich der Teil, in dem die Geschichte dieses Buches sich zum großen Teil abspielt. Die höchsten Bergspitzen und auch die fruchtbarsten Gebiete der Arabischen Halbinsel befinden sich südlich des Hedschas im heutigen Jemen. Die Römer nannten diese Südwestspitze nicht zufällig Arabia Felix, das glückliche Arabien. Die Mitte und der Osten der Halbinsel kennen keine hohen Gebirge; die Landschaft dort besteht aus dürren Steppen, Fels- und vor allem (zu drei Vierteln, um genau zu sein) Sandwüsten. Die größte zusammenhängende Sandwüste, in der jährlich weniger als fünf Zentimeter Regen fällt, ist Riub al-Khali, das „leere Viertel“, im Südosten. Nördlich davon, im Herzen der Halbinsel, liegt eine ausgedehnte Sand- und Steinwüste, unterbrochen von großen Oasen. Noch weiter nördlich liegt eine zweite große Sandwüste, die Syrische Sandwüste, die nordöstlich und nordwestlich in Steppenlandschaft übergeht. In der nördlichen Steppe lebten die meisten Araber in der Nähe der fruchtbaren, dicht bevölkerten Täler großer Flüsse, des Euphrat und Tigris im Osten und Norden sowie des Asi oder (griechisch) Orontes und des Jordan im Westen.
Die Flusstäler wurden im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung von den Römern (später sprechen wir von Byzantinern) und den Persern beherrscht. Richtige Grenzen gab es nicht. An den Steppenrändern waren Armeeposten eingerichtet, von wo aus die Soldaten die arabischen Stämme im Auge behielten. Bauern und Stadtbewohner in den Flusstälern trieben Handel mit den Arabern und viele Araber siedelten sich in ihrer Mitte an, wodurch sich die ethnischen Unterschiede im Laufe der Jahrhunderte verwischten. Dieselben Bauern und Stadtbewohner hatten jedoch, vor allem in Zeiten der Dürre, unter den Überfällen arabischer Banden zu leiden, die immer wieder aus der Steppe auftauchten. Für die lokalen Machthaber stellten die Grenzgebiete der Steppen und Wüsten ein schwer kontrollierbares Gebiet dar. Die wirksamste Methode zur Verhinderung der Überfälle war es, Verträge mit einem oder mehreren in der Nähe lebenden Stämmen zu schließen und sie aufzufordern (und zu bezahlen), andere Stämme auf Abstand zu halten. Solche Vereinbarungen kosteten Geld und Waffen, doch im Prinzip funktionierte dieses System jahrhundertelang gut. Allerdings passierte es durch ausbrechende Konflikte der verschiedenen arabischen Stämme untereinander, dass jener Stamm, mit dem Verabredungen getroffen worden waren, von einem anderen Stamm überwältigt und verjagt wurde, mit dem dann wieder neue Verabredungen getroffen werden mussten. Man konnte den Vertragspartnern natürlich besonders viel Geld und Waffen zukommen lassen, sodass sie es schafften, andere Stämme zu bestechen oder zu überwältigen. Doch die Kehrseite war, dass die Grenzstämme leicht zu stark und selbstständig wurden.
Auf der Arabischen Halbinsel lebten Dutzende, wenn nicht gar Hunderte verschiedene Stämme, große und kleine, machtlose und sehr mächtige. Ein Stamm bestand im Prinzip aus mehreren Familien, den Clans. In der arabischen Gesellschaft war der Clan die wichtigste Einheit. Wer aus irgendeinem Grund ohne die Unterstützung seines Clans leben musste, hatte es schwer. Denn den Mitgliedern des eigenen Clans beizustehen, war man moralisch verpflichtet. Wenn eines von ihnen beleidigt wurde, verwundet oder getötet, war das eine Sache, die den gesamten Clan anging. Ein Stamm hatte etwa den Charakter einer Koalition, eines Bundes verschiedener Clans.
Verwandtschaft kam in der arabischen Kultur eine sehr große Bedeutung zu. Clan und Stamm waren ein unverzichtbarer Teil der eigenen Identität. Um ein Beispiel zu geben: Mohammed hieß mit vollem Namen nach seinem Vater, Großvater und Urgroßvater Mohammed ibn (Sohn von) Abdallah ibn Abd-al-Muttalib ibn Haschim. Haschim war der Clan, zu dem er gehörte, und dieser Banu (Clan oder Stamm, wörtlich: Söhne von) Haschim gehörte wiederum zum Stamm Quraisch. Oft behaupteten Stammesmitglieder, dass ihr Stamm, ebenso wie ein Clan, einen gemeinsamen Vorfahren hatte, einen Mann, der der Vorfahre aller Stammväter aller angehörigen Clans sei. Aber eine solche Behauptung war historisch meist nicht haltbar; sie war eher ein Zeichen der Verbundenheit. So sollten die Quraischiten einen Stammvater mit Namen Qusaiy gehabt haben. Doch aus der Überlieferung geht hervor, dass Quraisch eine neuere und nicht wirklich stabile Koalition von Clans war, die einst die Stadt Mekka erobert hatte und sie seitdem regierte. Wenn ein Clan aus irgendeinem Grund von einem zu einem anderen Stamm ‚umstieg‘ (was keine Ausnahme war), erforderte das die notwendige kreative Überlegung und ein genealogisches Puzzle, denn der Clan musste in irgendeiner Weise in den Stammbaum des neuen Stamms aufgenommen werden.
Stämme konnten sich ihrerseits wieder zu noch größeren Einheiten zusammenschließen, die meistens als ‚Föderationen‘ bezeichnet wurden. Solche Föderationen stellten eine Macht dar, mit der man jetzt zu rechnen hatte – was auch für die umgebenden Herrscher galt. Doch zu einem Zusammenschluss aller (oder wenigstens der meisten) arabischen Stämme zu einer einzigen ‚Arabischen Föderation‘ ist es nie gekommen. Dass es möglich oder sogar notwendig sein könnte, haben viele eingesehen. In den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung wuchs langsam das Bewusstsein, dass die Araber ein großes Volk bildeten. Doch von einer kulturellen und sprachlichen, geschweige denn politisch-militärischen Einheit war nie die Rede. Es gab Ansätze dazu, aber dieser Einigungsprozess vollzog sich erst nach dem Aufkommen des Islam, also im 7. und 8. Jahrhundert.
Die Regionen an den Rändern der Arabischen Halbinsel waren am dichtesten bevölkert, sie waren reich und dynamisch – und sie richteten ihren Blick vor allem nach außen. Die Jemeniten beispielsweise spielten eine wichtige Rolle im interkontinentalen Handelsverkehr. Ihre Hafenstädte wie Makhwan, Madabaan und Dhoe Awaan (das heutige Aden) wurden von großen Handelsschiffen aus Ägypten, Afrika und Indien angelaufen. In der Region selbst wurde Weihrauch produziert, der zu Beginn unserer Zeitrechnung landeinwärts mit Karawanen nach Norden transportiert wurde, wodurch viele Stämme davon profitieren konnten. Doch unter römischem Druck übernahm danach der Schiffsverkehr diese Rolle. Die arabischen Stämme entlang der Süd- und Ostküste sorgten für ihren Anteil an dem Handel zwischen Indien und dem Persischen Reich. Auch für sie hatte das Ausland eine viel größere Bedeutung als das arabische Binnenland. Die Mehrheit der Araber in den nördlichen Steppen richteten ihr Interesse kulturell und wirtschaftlich auf die dicht bevölkerten Städte entlang der großen Flüsse.
Dort in diesen Randgebieten machten die Araber Bekanntschaft mit neuen Religionen. Jüdische und christliche Händler, Handwerker und Missionare siedelten sich mitten unter ihnen an, und viele Araber bekehrten sich zu einer dieser beiden monotheistischen Religionen. Jemen war sogar lange Zeit ein jüdisches Königreich. (Davon wird später noch die Rede sein.) In den Dörfern und Städten entlang der Küsten des Persischen Golfs lebten viele Christen. Zum Teil waren es Emigranten aus Mesopotamien, daneben aber hatten sich viele Araber zum Christentum bekehrt. Alle arabischen Stämme im Norden bei den großen Flüssen bekehrten sich in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung zum Christentum. Nur in den ärmeren Gebieten des dünn besiedelten arabischen Binnenlandes verehrten viele Stämme weiterhin die traditionellen Götter. Es gab dort nur wenige Städte, denn es war vor allem das Reich der Beduinen – nomadisierender Stämme und Clans, oft nicht mehr als einige Hundert. Sie zogen von einer Oase zur nächsten, um ihre Dromedar- und Ziegenherden mit Wasser und Nahrung zu versorgen. Die wirtschaftliche Grundlage der Beduinen war der Verkauf von Vieh und Tierhäuten und die Begleitung von Karawanen. Händler, die eine Karawane planten, taten gut daran, Beduinenstämme, denen sie unterwegs begegnen könnten, nicht zu unterschätzen. Sie mussten Vereinbarungen mit ihnen treffen, um Zugang zu den wichtigen Routen und Oasen zu bekommen und um sicher zu sein, dass sie eine Unterkunft und Schutz vor anderen Beduinenstämmen (mit denen nichts verabredet war) oder Räuberbanden erhalten würden. Die Haltung der sesshaften Araber gegenüber Beduinen war zwiespältig. Einerseits hielten sie die Beduinen für unkultiviert und unzuverlässig: In ihren Augen waren es Wüstlinge und Erpresser. Zugleich aber gab es die ‚romantische‘ Überzeugung, dass gerade die abgehärteten, kaum mit der Kultur rund um Arabien in Berührung gekommenen Wüstenbewohner noch unberührt waren und sich in Lebensweise und Charakter noch am wenigsten von den ursprünglichen Arabern entfernt hatten.
Es stellt sich die Frage, wann unter den Arabern das Bewusstsein entstand, dass es so etwas wie eine arabische Nation gab, ein Volk von ‚Arabern‘. Eine Nation ist nach einer der vielen Definitionen eine Gemeinschaft von Menschen, die dieselbe Kultur besitzen oder sich jedenfalls als Angehörige derselben Kultur betrachten und von der Bedeutung dieser gemeinsamen Kultur überzeugt sind. Dabei geht es vor allem um eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Religion. Der Ausdruck ‚Araber‘ ist jedenfalls sehr alt. Er taucht bereits im 8. Jahrhundert v. Chr. auf. In dieser Zeit versuchten die Assyrer (ein Volk, das vom Oberlauf der Flüsse Euphrat und Tigris stammte), ihren Einfluss bis zu den Oasen im Nordwesten Arabiens auszudehnen. Insbesondere ging es um die Oase Tema im äußersten Nordwesten des heutigen Saudi-Arabien, einem Knotenpunkt der Karawanenstraßen. Assyrische Quellen berichten, sie hätten dort die „Samsi, die Königin der Araber“ besiegt. Wir wissen nichts von dieser Königin über ganz Arabien. Das assyrische Wort Arab bedeutete etwas wie Wüstenbewohner oder Nomaden. Das Wort hat sich über die Jahrhunderte hinweg erhalten.
Die Sprache allerdings, die wir als Arabisch bezeichnen, scheint nicht vor dem 1. Jahrhundert n. Chr. entstanden zu sein. Zu der Zeit wurden auf der Halbinsel viele Sprachen gesprochen, die alle zur semitischen Sprachfamilie gehörten. Die wichtigste Sprache war Aramäisch, das im Norden Arabiens gesprochen wurde. Innerhalb des Byzantinischen Reiches war Aramäisch die Volkssprache in Mesopotamien, Syrien und Palästina. Die Regierungselite und kirchliche Elite sprach Griechisch. Weiter östlich, im Persischen Reich, sprach das einfache Volk ebenfalls Aramäisch, die Elite Persisch.
Die ältesten überlieferten Inschriften, die als Vorläufer des Arabischen angesehen werden, datieren um das 4. Jahrhundert v. Chr. Sie wurden in Nordwestarabien gefunden und werden als Altarabisch bezeichnet. Diese Sprache besaß keine eigene Schrift. Die Verfasser der Inschriften benutzten das sogenannte dedanitische Alphabet (nach dem dort befindlichen blühenden Königreich Dedan, das eine eigene Sprache und Schrift besaß). Um das 1. und 2. Jahrhundert entstand das ‚klassische‘ Arabisch. Die ältesten Inschriften in dieser Sprache stammen vermutlich aus Karjat al-Fau, einer Stadt im tiefen Südwesten Arabiens, die über lange Zeit ein wichtiges Bindeglied der Karawanenroute zwischen dem Jemen und dem Norden darstellte. Auch diese Inschriften wurden mithilfe ‚geliehener‘ Buchstaben geschrieben, und zwar in der südarabischen Schrift. Als ein Jahrhundert später das klassische Arabisch im Norden auftauchte, ‚lieh‘ man sich dazu die nabatäisch-aramäische Schrift, die damals in Petra verwendet wurde.
Die zahlenmäßige Zunahme der Inschriften zeigt die größere Verbreitung des Arabischen in dieser Zeit. Das war vermutlich dem anwachsenden innerarabischen Handelsverkehr zu danken, wodurch das Bedürfnis nach einer gemeinsamen Umgangssprache entstand. Die Wahl fiel dabei offenbar auf das Arabische. Um diese Zeit muss hier und da das Gefühl entstanden sein, dass es etwas wie ein arabisches Volk oder eine arabische Nation existierte. In der Zeit benutzten die höher entwickelten Bewohner des nördlichen Arabien den Ausdruck ‚Arabisch‘ für die eigene Sprache und zugleich das Volk, das diese benutzte. Sie wurden sich also einer gemeinsamen Kultur bewusst. Danach entstand bei der Elite auch der Wunsch nach einer gemeinsamen Geschichte zu Abstammung oder Ursprung der Araber: ein ‚Abstammungsmythos‘.
Sehr viel bewirkte diese intellektuelle Denkarbeit vorläufig nicht; die verschiedenen Stämme befehdeten sich weiterhin, sei es wegen alter Wunden, neuer Streitigkeiten oder aber, weil sie von den Römern und Persern gegeneinander ausgespielt wurden.
Im 1. Jahrhundert n. Chr., als die Römer und die Perser sich zum ersten Mal direkt gegenüberstanden, lagen zwischen diesen beiden erbitterten Gegnern noch etliche kleine Königreiche, die als notwendiger Puffer fungierten. Doch nachdem in Persien die aggressive Dynastie der Sassaniden an die Macht gekommen war, wurde ein Pufferstaat nach dem anderen von den beiden Großmächten verschluckt. Auch versuchten sie, möglichst viele arabische Stämme zu eigenen Zwecken zu nutzen. Die Römer schlossen eine Vereinbarung mit einem starken Stamm, der das heutige Jordanien beherrschte und den sie (im Griechischen, der Amtssprache) ‚Sarazenen‘ nannten. Dieser Name wurde letztlich, als der Stamm selbst längst verschwunden war, der Name aller Araber. Auch die Perser suchten nützliche arabische Verbündete. Anfangs waren das die Tayyi, was im Osten schließlich die allgemeine Bezeichnung für Araber wurde.
Um die Sarazenen beziehungsweise Tayyi an sich zu binden, versahen beide Großmächte die Stämme mit Geld, Waffen und Nahrung. Dafür mussten die Stämme das Grenzgebiet bewachen und die lokalen Bauern und die Stadtbevölkerung beschützen, indem sie die weiterhin nomadisierenden Stämme unter Kontrolle hielten. Wenn sie selbst angegriffen wurden, konnten sie auf militärische Unterstützung rechnen, aber dafür (und das war für die Großmächte viel wichtiger) erwartete man von ihnen, dass sie Soldaten für die römischen respektive persischen Armeen lieferten. Arabische Söldner waren begehrt: Sie waren abgehärtet und mit Pferden vertraut und stellten somit eine vorzügliche Kavallerie dar. Die Beziehung zwischen den Stammeshäuptern und dem Römischen Reich wurde so eng, dass die Römer die Stammeshäupter (im Griechischen Phylarchen) immer mehr wie hohe Beamte innerhalb des Reiches behandelten. Dennoch sorgte gerade diese neue arabische Elite am Ende für große Probleme.
Um das 3. Jahrhundert herum verschwanden die Tayyi von der Bildfläche und die Perser schlossen Verträge mit den Lakhmiden, einer Stammeskoalition unter Führung des mächtigen Clans Nasr in den Steppen westlich von Euphrat und Tigris. Die Byzantiner wechselten von den Sarazenen unter anderem zu den Salih und am Ende des 5., Anfang des 6. Jahrhunderts noch einmal zu anderen Verbündeten. Der spätere Geschichtsschreiber Ibn Habib erklärt dies folgendermaßen:
„Salih hatte die Angewohnheit, bei den Mudar und anderen arabischen Stämmen, die in ihrem Gebiet siedelten, im Namen der Römer Steuern zu erheben. Die Ghassan landeten dort in Scharen auf ihrem Weg nach Syrien, und als sie sich dort niederließen, sagte Salih: ‚Wenn ihr Steuern zahlt, könnt ihr bleiben, wenn nicht, werden wir euch bekämpfen.‘ Die Ghassan weigerten sich und die Salih kämpften mit ihnen und schlugen sie. Zu der Zeit war Thalaba ibn Amr der Führer der Ghassan. Sie [die Salih] besteuerten sie [die Ghassan] weiterhin, bis Djid ibn Amr den Steuereintreiber von Salih tötete. Da riefen die Salih [ihre Kämpfer] zu den Waffen, genau wie Ghassan, und sie trafen sich an einem Platz namens Muhaffaf, und Ghassan vernichtete sie. Der Herrscher der Römer [wahrscheinlich Kaiser Anastasios, reg. 491–518] fürchtete, sie würden sich auf die Seite der Perser schlagen und schickte deshalb [einen Botschafter] zu Thalaba, der sagte: ‚Ihr seid ein tapferes und großes Volk und ihr habt den stärksten und größten Stamm der Araber vernichtet. Ich ernenne nun euch an ihrer Stelle und werde euch einen Vertrag zwischen uns und euch schreiben: Wenn arabische Räuber euch überfallen, werde ich euch mit 40.000 bewaffneten römischen Soldaten unterstützen. Und wenn sie uns überfallen, müsst ihr 20.000 Soldaten liefern, und ihr müsst euch aus dem Kampf zwischen uns und den Persern heraushalten.“
Um 530 entstand in dem Gebiet Syrien–Jordanien unter Führung der Ghassan eine Stammeskoalition, die mit den Byzantinern verbunden war. Diese ‚Ghassaniden‘ wurden von dem Clan der Jafniden dominiert, der im (heutigen) Südwestsyrien und auf den Golanhöhen siedelte. Um ihre Macht zu vergrößern und die Ghassaniden stärker an sich zu binden, gaben die Byzantiner den jafnidischen Herrschern großartige Titel. Der byzantinische Geschichtsschreiber Prokopios berichtet beispielsweise, dass Kaiser Justinian (reg. 527–565) ihnen den Titel ‚Führer der Sarazenen in Palästina‘ verliehen hatte. Damit übten sie nach Ansicht des Kaisers auch Macht über die Araber in Palästina aus. Später bekam der Jafnide al-Harith ibn Jabala den Titel ‚König von Arabien‘. Der Geschichtsschreiber Prokopios berichtet, weshalb das geschah:
„Mundhir, der den Titel König trug, war der Alleinherrscher aller Sarazenen in Persien, und er war jederzeit in der Lage, mit seinem gesamten Heer die römischen [byzantinischen] Gebiete zu überfallen, wenn er es wollte. Kein einziger der Kommandanten römischer Truppen, die sie duces nennen, noch irgendein Führer der Sarazenen, die mit Rom verbunden und Phylarchen genannt wurden, war mit seinen Mannschaften stark genug, sich Mundhir gegenüberzustellen, denn die Truppen in den verschiedenen Distrikten stellten keine echten Gegner dar. Deshalb machte Kaiser Justinian al-Harith ibn Jabala, der über die Sarazenen in [der Provinz] Arabien herrschte, zum Befehlshaber möglichst vieler Stämme und verlieh ihm den Rang eines Königs [Basileus]. Das hatte noch kein Römer bisher getan.“
Die Spannungen zwischen Römern und Persern führten dazu, dass Lakhmiden und Ghassaniden sich immer wieder gegenüberstanden. Zugleich aber profitierten beide Stammeskoalitionen von dem andauernden Konflikt. Sie wussten, dass sie unentbehrlich waren, und konnten immer höhere Forderungen stellen. Dank des unaufhörlich fließenden Stroms an Geschenken und Gunstbezeugungen und möglicherweise auch durch die Migration von Stämmen aus Zentralafrika in diese Gebiete hob sich der Wohlstand des nördlichen Arabiens im Laufe des 6. Jahrhunderts beträchtlich. Die Macht der Stammeskoalitionen reichte wahrscheinlich nicht bis in die großen Städte, in denen kaiserliche Beamte das Sagen hatten, doch besaßen die Reichsten unter ihnen dort prächtige Paläste. Ausgrabungen zeigen, dass sich auch die arabischen Niederlassungen und Städte in diesen Jahrzehnten vergrößerten und wohlhabender wurden.
Führende Araber – Stammeshäupter, reiche Händler, hohe Beamte – nahmen im Laufe der Jahre immer mehr persische beziehungsweise byzantinische Gewohnheiten an. Und sie bekehrten sich zum Christentum. Ein großer Sieg der christlichen Kirche im 5. Jahrhundert war die Bekehrung der Jafniden zum monophysitischen Christentum. Sie wurden vorbildliche Gläubige. Jeden Winter zog der Clan aus der Hauptstadt al-Djabiya (auf den Golanhöhen) nach Rusafa in Nordsyrien zum Grab des heiligen Sergius, eines bedeutenden syrischen Heiligen. Im Griechischen hieß diese Stadt auch Sergiopolis. Doch hinter dieser Bekehrung steckte ein Plan. Die Ghassaniden trieben die Organisation der monophysitischen Kirche voran. Um 542 ersuchte al-Harith ibn Jabala Kaiserin Theodora, zwei Bischöfe für seine Untertanen zu entsenden. Das war in jener Zeit keine ungewöhnliche Bitte. Bischöfe waren im Prinzip Beamte, die vom kaiserlichen Hof angestellt wurden, und Theodora stand den Monophysiten positiv gegenüber. Mit der Ernennung dieser beiden Bischöfe begann nach allgemeiner Ansicht der Aufbau der monophysitischen kirchlichen Hierarchie. Sie ernannten eine ganze Reihe bischöflicher Kollegen für andere Gebiete, in denen viele monophysitische Christen lebten. Die konnten oft nicht in den großen Städten bleiben, wo sich die offiziellen diophysitischen Kirchenvorsteher aufhielten, und zogen stattdessen in kleinere Städte oder Klöster. Währenddessen beobachteten die ghassanidischen Herrscher sehr genau, was in ‚ihrer‘ monophysitischen Kirche vor sich ging. Sie finanzierten neue Kirchen und beschäftigten sich aktiv mit theologischen Fragen und wichtigen personellen Ernennungen. Eigentlich strebten sie danach, in der monophysitischen Kirche dieselbe Rolle zu spielen wie der Kaiser in der diophysitischen Kirche. In ihren Augen sollte der Monophysitismus das ‚arabische Christentum‘ werden.
Der zunehmende Wohlstand und die Übernahme fremder Gewohnheiten, wozu auch die Religionen gehörten, führten zu Protesten. Schriftsteller und Dichter fingen an, die ‚ursprüngliche‘ arabische Kultur zu verherrlichen. Die Araber, so sagten sie, sollten nicht ihre Nachbarn imitieren, sondern ihre eigenen Gewohnheiten und Gebräuche wiederentdecken und kultivieren. Khalifu („Mach es anders!“) war es, was sie wollten. „Anders“ bedeutete in diesem Zusammenhang: nicht so wie die Byzantiner oder Perser, sondern nach ursprünglicher arabischer Art. Aber was war diese ‚ursprüngliche‘ Art nun genau? Die Suche nach dem, was ‚echt‘ arabisch war, führte zur Verherrlichung der vermeintlich ‚urarabischen‘ Tugenden wie Einfachheit und Ehrgefühl und in der Konsequenz zu größerer Beachtung der gemeinsamen Vergangenheit und ihrer Verherrlichung. Leider war völlig unklar, wer ihr gemeinsamer arabischer Stammvater gewesen war und wo das Land ihrer Herkunft gelegen hatte. Für viele der sie umgebenden Völker war das keine Frage. Die Griechen und die Römer hatten immer behauptet, dass sie vom Halbgott Prometheus geschaffen waren, und die Römer konnten dem noch hinzufügen, dass sie von dem trojanischen Helden Aeneas abstammten. Die Perser behaupteten, sie seien einst im (heutigen) Iran von Göttern erschaffen worden. Die Juden sagten, dass sie von Isaak, dem Sohn Abrahams, abstammten, einem Nachkommen von Sem, dem ältesten Sohn Noahs. Die Christen stellten kein gesondertes Volk dar, denn alle Christen stammten von Überlebenden der Sintflut ab, von den Söhnen Noahs.
Und die Araber? Auch sie konnten, wenn sie denn wollten, ihre Abstammung in der Bibel finden. Darin stand, dass die Völker der arabischen Wüste von Ismael abstammten, einem anderen Sohn Abrahams. Doch diese Version war natürlich nur interessant für Araber, die Christen oder Juden geworden waren. Die polytheistischen Araber wollten mit der Bibel nichts zu tun haben. Dazu kam, dass die bekehrten Araber auch nicht wirklich glücklich gewesen sein können mit dem Bild, das die Bibel von den Arabern übermittelt. Abraham hatte Ismael mit Hagar, einer ägyptischen Sklavin, gezeugt. Danach hatte er im Auftrag Saras, seiner Frau, wenn auch mit Zustimmung Gottes, Mutter und Sohn in die Wüste geschickt. Gott hatte Abraham dabei versprochen, Ismael würde der Stammvater eines großen Volkes werden. Doch er war nie seinem Bruder Isaak (Gen 16,1–13; 21.8–20) gleichgestellt. Mit anderen Worten: Die Araber waren der Bibel zufolge den Juden nie ebenbürtig.
Die arabischen Dichter und Geschichtenerzähler, immer auf der Suche nach einer Alternative zu dieser erniedrigenden Bibelgeschichte, machten dankbar Gebrauch von einer ganzen Anzahl Traditionen, denen zufolge die arabischen Stämme im Norden zu einem großen Teil aus dem Süden stammten. Eine Geschichte spielte dabei eine wichtige Rolle: die vom Untergang des Königreiches Saba. Im äußersten Süden, weit entfernt von aller korrumpierenden Kultur, war einst ein mächtiges arabisches Königreich untergegangen. Ursache dafür war der Einsturz des riesigen Staudamms von Marib, von dem ganz Saba abhängig war. Im Koran finden wir folgende Version des Dramas:
„Für die Sabbäer lag einst ein Zeichen in ihrem Wohnort: zwei Gärten, rechts und links. ‚Esst von den Gaben eures Herrn! Und danket ihm!‘ Ein gutes Land. Und ein Herr, der bereit ist zu vergeben. Sie aber wendeten sich ab. Da schickten wir gegen sie des Dammes Wassermassen und tauschten ihnen ihre beiden Gärten ein gegen zwei andere mit Dornbuschfrüchten, Tamarisken und geringem Bewuchs an Zizyphus. So vergalten wir ihnen, dass sie undankbar waren. Bestrafen wir jemanden – außer den, der undankbar ist?“
(Sure 34,15–17)
Dem Koran zufolge wurden die Einwohner von Saba bestraft, weil sie beschlossen hatten, dass ihre Karawanen nicht mehr an den traditionellen Raststätten rasten sollten:
„Wir machten zwischen ihnen und den Städten, die wir gesegnet hatten, Städte, die deutlich sichtbar waren, und machten die Reise zwischen ihnen abschätzbar: ‚Reist umher zwischen ihnen in Sicherheit, bei Nacht und bei Tage!‘ Da sprachen sie: ‚Unser Herr! Vergrößere die Strecken unserer Reisen!‘ Und sie frevelten gegen sich selbst.“
(Sure 34,18–19)
Der Koran zeigt, dass die Geschichte vom Untergang Sabas allgemein bekannt war:
„[…] da machten wir sie zur Legende und rissen sie ganz und gar in Stücke. Siehe, darin liegen wahrlich Zeichen für einen jeden, der sich standhaft zeigt und dankbar ist.
(Sure 34,19)
Saba ist ein anderer Name für Jemen. Und der Staudamm von Marib hat wirklich existiert. Die Reste dieses eindrucksvollen, von Menschenhand errichteten Staudamms sind noch immer im Wadi Athanah, etwa 150 Kilometer östlich der heutigen jemenitischen Hauptstadt Sanaa zu bewundern. Der Damm gehörte zu einem großen Bewässerungssystem, das jahrhundertelang den Wohlstand des Königreiches Himyar sicherte. Er hielt das Wasser zurück, das in der Regenzeit durch das Wadi floss, und das gesammelte Regenwasser wurde dann während der Trockenzeit genutzt, um die Äcker in der weiten Umgebung zu bewässern. Der Damm (und alles, was dazugehörte) machte Himyar zu einem wichtigen Exporteur von Agrarprodukten. Doch ein so riesiger Damm muss fortwährend instand gehalten werden. Es können Risse oder Verschiebungen auftreten und hinter dem Damm sammeln sich große Mengen Schlamm, Sand und Steine an, die regelmäßig entfernt werden müssen, weil das Wasser andernfalls von Jahr zu Jahr höher steigen würde. So hoch, dass der Damm brechen kann. Der Damm von Marib ist daher auch mehrmals eingestürzt und anschließend wieder aufgebaut worden. Der älteste Damm datiert auf viele Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung, danach sind immer wieder Reparaturarbeiten vorgenommen worden. Ein wirklich katastrophaler Dammbruch fand 455 n. Chr. statt. Etwa ein Jahrhundert später ließ König Abraha ihn wieder aufbauen, doch war die Macht von Himyar zu dem Zeitpunkt bereits Vergangenheit.
Ein Dammbruch bedeutete Elend. Die örtlichen Bauern und Händler hatten die Wahl zwischen Hungern und Abwarten, bis das Bewässerungssystem wieder instand gesetzt war, oder Fortziehen. Dammbrüche bedeuteten also Flüchtlingsströme in nördliche Richtung und diese Menschenströme bildeten wahrscheinlich die Inspiration für die Erzählungen, dass die Nordaraber (die de facto meistens aus Zentralasien kamen und den Wohlstand des Nordens gesucht hatten) von den Herrschern Himyars stammten.
Einst, so erzählen die Geschichten, herrschte in Saba der mächtige König Amir ibn Amir. Seine Frau, Tarifat al-Khair, war eine Priesterin. Eines Tages warnte sie ihren Mann, dass der Damm von Marib durchzubrechen drohte. Sie sagte ihm, sie müssten mit ihrem Stamm fortziehen. Amir traf heimlich Vorbereitungen für eine Auswanderung, doch einem anderen Stamm, den Azd, kam dies zu Ohren und er tat dasselbe:
„Amir ibn Amir zog mit seinen Kindern, seiner Familie und allen Mitgliedern seines Stammes fort, ebenfalls die Azd. Gott allein weiß, wie viele Menschen, Pferde, Kamele, Stiere, Kühe und andere Haustiere er mitnahm. Sie nahmen alles Wasser mit, das sie finden konnten und verwüsteten alle Länder, durch die sie zogen […]. Sie zogen dann zum Hedschas und von da zerstreuten sie sich, jeder Stamm zog in ein Gebiet seiner Wahl. Im Vertrauen auf Amr ibn Amirs Bruder zogen einige nach Sarwat, andere entschieden sich für Mekka oder Umgebung, und wieder andere reisten bis Syrien oder Persien.“
Auch die Azd, heißt es, hätten sich über ganz Arabien zerstreut. Kurz vor ihrem Auszug hatte ihnen ein Wahrsager prophezeit:
„Diejenigen unter euch, die arm, aber geschickt sind […], müssen nach Marr gehen. Wer ein Gebiet sucht, in dem er sich dauernd niederlassen will […], muss den Schatten der Palmen von Yathrib aufsuchen. Wer gute Sachen und vergorenes Getränk will […], muss nach Bostra oder al-Awir in Syrien gehen. Und wer schöne Kleider und Reitpferde und Chancen auf Reichtum und Glück will, der möge sich in den Irak begeben.“
Die Ghassaniden und Lakhmiden stammen angeblich von den Azd ab:
„Während Amr, begleitet von seinen Leuten, und die von den Azd den Weg nach Norden verfolgte, wich einer der Zweige der Azd, die Ghassaniden, vom Ziel der Truppe ab, um nach Syrien zu ziehen. Als sie sich dort dauerhaft niedergelassen hatten, gab der Kaiser von Byzanz ihnen die Macht über die Araber des Landes Scham (Syrien/Palästina). Al-Harith ibn Amr war der Erste, der den Thron des Landes Scham bestieg […]. Andere Mitglieder der Azd, die mit den Ghassaniden verwandt waren, gingen in den Irak. Sie beherrschten das Land und bekamen vom König der Perser die Macht über die Araber in diesem Gebiet.“
Der Mythos, die nördlichen Herrscher seien südlicher Herkunft, wurde letztlich allgemein akzeptiert. Wenn Islamwissenschaftler später die Herkunft der arabischen Stämme beschreiben, benutzen sie üblicherweise die Formulierung: ursprüngliche Bewohner und Neuankömmlinge, und Letztere zogen vom Süden nach Norden. Al-Asmaʾi, Historiker des 8. Jahrhunderts, fasst diese Migration folgendermaßen zusammen:
„Sie [die südlichen Stämme] kamen in kein Land, ohne das [dort lebende] Volk des Landes zu berauben. Kussai nahm Mekka [vom Stamm] Jurhum; Aus und Khazradsch nahmen Medina von den Juden; der Clan von Mundhir [die Nasriden] nahmen den Irak von seinem Volk; der Clan von Jafna nahm Syrien von seinem Volk und herrschte über sie; und die Nachkommen von Imran ibn Amr ibn Amir nahmen Oman von seinem Volk. Bis zu dem Zeitpunkt waren all diese [Eroberer] den Königen von Himyar gehorsam gewesen.“
Der islamische Historiker und Mohammed-Biograf al-Tabari (gest. 923) fasst in seinen Annalen (Tarich ar-rasul …, „Geschichte der Propheten, Könige und Kalifen“) zusammen, was sich in Ostarabien ereignete:
„Einige arabische Stämme [aus dem Süden] versammelten sich in Bahrain. Sie vereinigten sich zu Bundesgenossen unter dem Namen Tanuch […] und schworen, einander beizustehen und zu helfen. Diese Araber von Bahrain richteten ihren Blick auf das irakische Land. Sie wollten die Nicht-Araber überwältigen, um das Land und das angrenzende Arabien zu erwerben und mit ihnen zu teilen. Die arabischen Stammeshäuptlinge nutzten die Uneinigkeit der parthischen Prinzen und beschlossen, in den Irak zu ziehen. […] Viele Mitglieder der Tanuch ließen sich in Anbar und Hira nieder. […] Der erste Herrscher aus ihrer Mitte war Malik ibn Fahm […], danach sein Bruder Amr ibn Fahm […], danach Dschadhima al-Abrasch.“
All diese tradierten Erzählungen enthalten einen Kern Wahrheit. Zu einer wirklichen massenhaften „Völkerwanderung“ von Süd nach Nord, wie die Überlieferung glauben machen will, ist es aber wahrscheinlich nie gekommen. Doch steht fest, dass regelmäßig Clans oder Stämme aus Zentral- sowie Südafrika nordwärts zogen, um dort ihr Glück zu suchen, und dabei die dort lebenden Bewohner verdrängten. Es ist beispielsweise auffallend, dass viele arabische Inschriften im epigrafisch nördlichen Arabisch aus dem 2. und 3. Jahrhundert im Norden fast keine bekannten Namen von Stämmen oder Clans enthalten; die scheinen alle verschwunden zu sein. Inzwischen treffen Historiker in den südlichen Inschriften aus derselben Zeit im epigrafisch südlichen Arabisch durchaus Namen von Stämmen und Clans an, die wir aus späteren Quellen kennen. Einige der nördlichen Stämme sind vermutlich von Stämmen und Clans aus dem Süden zerschlagen worden, wie beispielsweise die Salih von den Ghassaniden vertrieben wurden. Die meisten werden jedoch in den südlichen Stämmen aufgegangen sein. Die letzte, vielleicht größte dieser Migrationswellen von Nord nach Süd fand im 7. Jahrhundert nach dem Tode Mohammeds statt. Der Gegensatz zwischen „alten“ und „neuen“ Arabern, der durch diese Migration vor allem in Palästina und Syrien entstand, war jedenfalls sehr hartnäckig. Noch viele Jahrhunderte später stellte der Unterschied zwischen den ursprünglich aus dem Norden stammenden vereinigten Quais und den aus dem Süden stammenden Yamans eine Quelle von Konflikten dar.
Die südliche Herkunft, so fanden Schriftsteller und Dichter, schuf Verpflichtungen. Die nördlichen Herrscher mussten alles daransetzen, dass die alte arabische Kultur in Ehren wiederhergestellt wurde. Die Araber waren verkommen, klagten sie, weil sie sich die dekadente byzantinische und persische Kultur zu eigen gemacht hatten. Sie fieberten jetzt nach Gold und Besitz; sie besaßen kein Ehrgefühl und ihr Arabisch steckte voll von ausländischen Lehnwörtern. Sie sollten die „ersten Araber“ zum Vorbild nehmen, al arab al-ula (oder auch al-Arabya, arabisch sprechende Araber). Sie waren bestenfalls „arabisierte Araber“: al-arab-al-musta ʿriba (oder al-arab-al-muta ʿariba, die sich selbst arabisch machenden Araber). Echte Araber strebten nach dem alten, reinen Leben in der Wüste. In langen, erzählenden Gedichten, den Qasidas, beschrieben Dichter die Ayyam al-Arab, die „Tage der Araber“. Damals war nur eines wichtig: die Ehre des Clans und des Stammes.
Die bekannteste Sammlung dieser Lyrik ist die Mu ʿallakat („die Hängende“, so genannt, weil dieser Gedichte einst als Zeichen der Ehrerbietung an der Kaaba aufgehängt wurden. Sie wurden erst nach 700 von einem gewissen Hammad gesammelt). Es handelt sich um sieben Gedichte von sehr berühmten vorislamischen Dichtern, und zwar das jeweils beste ihrer Gedichte. Aber diese sieben sind sich in Inhalt und Struktur sehr ähnlich. Jedes Gedicht beginnt mit der Beschreibung eines verlassenen Lagers; der Dichter entdeckt, dass seine Geliebte soeben weggegangen ist. Er nimmt die Verfolgung auf, und während seiner Suche (zu Pferd oder auf dem Kamel) beschreibt er etwa die Schönheit der Natur, sein eigenes Leben, die Vortrefflichkeit oder Freigebigkeit seines eigenen Stammes (Essen an Hungrige verteilen ist ein regelmäßig wiederkehrendes Thema). Ob es sich hier wirklich um vorislamische Lyrik handelt, ist nicht gesichert. Es ist kaum zu bezweifeln, dass die sieben Dichter (Imru al-Qais, Tarafa, Antara, Zuhair, Labid, Harith und Amr) wirklich existiert haben, aber die Ähnlichkeit der sieben Qasidas ist so groß, dass zumindest eine spätere Bearbeitung anzunehmen ist. Doch es bedeutet, dass dieser ‚romantische‘ Blick auf das ursprüngliche arabische Leben sehr alt sein muss. Ein beliebtes Thema in den Qasidas sind übrigens die Heldentaten des Stammes Maʾad. Wir wissen fast nichts über diesen Stamm oder diese Koalition, aber vorislamische Dichter konnten ihre gloriosen Siege nicht genug rühmen, so wie sie später leidenschaftlich von den Siegen des Propheten erzählten. (Und wie das mit berühmten Namen oft geschieht: Sie müssen zusammengefügt werden. Eine Person namens Maʾad hat einen prominenten Platz in Mohammeds Stammbaum bekommen.)
Der Aufruf Khalifu („Mach es anders!“) und das wachsende Interesse für die arabische Geschichte, Sprache und Kultur war vermutlich die Ursache für eine andere wichtige Entwicklung im 6. Jahrhundert: die Entstehung eines arabischen Alphabets. Die Araber begriffen, dass sie, was das betrifft, ‚hinterherhinkten‘. Alle Völker um sie herum hatten eine eigene Sprache und ein eigenes Alphabet; sie aber mussten ihre Sprachen noch mithilfe ‚geliehener‘ Alphabete schreiben. Das musste geändert werden. Die ersten Versuche zur Entwicklung einer arabischen Schrift wurden wahrscheinlich von christlichen Arabern unternommen. Wie wir sahen, hatten sich die Ghassaniden nach ihrer Bekehrung zum monophysitischen Christentum schnell zum Beschützer dieser Religion entwickelt. In diesem Kreise muss das Bedürfnis an Übersetzungen religiöser Texte aus dem Syrisch-Aramäischen, der Umgangssprache in Nordsyrien, ins Arabische entstanden sein, und offensichtlich entstand dabei der Gedanke, dafür eine eigene Schrift zu entwickeln. Das arabische Alphabet ist kurz nach 500 in Nordwestarabien auf der Grundlage der nabatäisch-aramäischen Schrift entwickelt worden. Die ersten Texte wurden höchstwahrscheinlich auf Pergament, Papyrus oder anderen vergleichbaren Materialien geschrieben, doch wir besitzen keine Inschriften. Die älteste ist 532 datiert und wurde in Zabad, 60 Kilometer südöstlich der Stadt Aleppo, also in ghassanidischem Gebiet, entdeckt. Es ist die Ergänzung einer griechischen und syrisch-aramäischen Inschrift, die zur Einweihung eines dem heiligen Sergius gewidmeten Heiligtums angebracht worden war. Auf einen zweiten Text, datierend aus dem Jahr 528/529, stieß man in Jabal Sais, 30 Kilometer östlich von Damaskus. Darauf finden wir einen Hinweis auf den ghassanidischen ‚König‘ al-Harith. Eine dritte, datierend etwa aus dem Jahr 570, ist eine griechisch-arabische Inschrift in Harran. Darin wird der Bau eines Heiligtums für den heiligen Johannes beschrieben, das ein gewisser Scharahil ibn Zalim in Auftrag gegeben hatte.
Diese Schrift war für die arabische Kirchen- und Regierungselite bestimmt: Zeichen von Selbstständigkeit und vielleicht der Versuch, eine eigene Verwaltungssprache zu entwickeln, vergleichbar mit dem Griechisch der großen Kaiser im Westen. Und aus dem ghassanidischen Gebiet verbreitete sie sich über Arabien. Der Tradition zufolge soll der (christliche) Schreiber Adi ibn Zaid, ein berühmter Dichter und hoher Funktionär am persischen Hof, das arabische Alphabet um das Jahr 575 bei den Lakhmiden eingeführt haben. Wir wissen, dass es einige Jahrzehnte später auch in Mekka benutzt wurde. Der Historiker al-Baladhuri (gestorben 892) berichtet, dass zur Zeit des Entstehung des Islams siebzehn Einwohner der Stadt das Alphabet benutzten. Darunter müssen auch, so denken wir, die Schreiber gewesen sein, die die Offenbarungen aufgeschrieben haben.
Das erste arabische Alphabet war sehr einfach; es hatte keine Zeichen für Vokale (doch das war in der Zeit nicht ungewöhnlich) und bestand aus nur 15 Zeichen, Konsonanten also. Erstaunlich ist, dass das Arabische eigentlich etwa 28 Konsonantenphoneme kennt. Viele dieser Zeichen repräsentieren also mehrere Klänge. Ein Text, der unter Verwendung eines solch ‚kargen‘ Alphabets geschrieben wurde, kann also nicht ohne reiche Erfahrung vorgelesen werden. Der Vorleser muss eigentlich schon wissen, was dort steht. Er muss den Text gehört und gewissermaßen auswendig gelernt haben, sodass er den geschriebenen Text wiedererkennen und mühelos lesen kann. Wenn er den Text nicht (wieder) erkennt, muss er die Wertigkeit der Zeichen raten und dabei selbst entscheiden, welche Vokale dazugehören. Diese Freiheit war auf die Dauer lästig und unerwünscht. Im Laufe der Jahre wurde das erste Alphabet daher auch um immer mehr Lesezeichen erweitert, um Konsonanten zu erkennen und Vokale anzudeuten. Ein anderes Problem war es, dass im 6. Jahrhundert weder eine standardisierte arabische Orthografie noch eine standardisierte Grammatik des Arabischen existierten. Auch das führte oft zu Verwirrung. Beides sollte erst am Ende des 8. Jahrhunderts von dem berühmten persischen Sprachwissenschaftler Sibawayhi erstellt werden.
Die Blüte der arabischen Kultur dauerte bis gegen Ende des 7. Jahrhunderts. Die Ursache waren die sich verschlechternde wirtschaftliche Situation und der überraschende Untergang der Ghassaniden wie auch der Lakhmiden. Dem jafnidischen Herrscher Mundhir, Sohn ‚König‘ al-Hariths, gelang 570 in der Schlacht bei Ain-Ubag noch ein Sieg über die Lakhmiden. Doch eskalierte ein Konflikt mit den Byzantinern, weil Kaiser Justinian II. (reg. 565–578) sich angeblich weigerte, den arabischen Truppen ihren Sold auszuzahlen, auf den sie ein Anrecht hatten. Mundhir ließ danach die Lakhmiden drei Jahre ungestraft schalten und walten, sodass sie den Byzantinern mehr als ein Problem bereiteten. Er hoffte, dass er Justinian auf die Art zwingen konnte, einen neuen, günstigeren Vertrag mit ihm zu schließen. Das gelang ihm. Es kam zu einer neuen Vereinbarung. Mundhir zeigte danach seinen guten Willen, indem er 577 gegen die Lakhmiden zu Felde zog und ihre Hauptstadt al-Hira plünderte. Aus Dankbarkeit verlieh der Kaiser ihm den Ehrentitel „Unterkönig aller Araber“. Aber es ging nur ein paar Jahre gut.
Religiöse Streitigkeiten entbrannten. Im Jahre 580 kam Mundhir, de facto der Führer der monophysitischen Kirche, zu einem Konzil nach Konstantinopel, das Dio- und Monophysiten versöhnen sollte. Ihm überreichte Justinians Nachfolger Maurikios (der Mann, der 602 von Phokas ermordet werden würde) ein kostbares Diadem. Aber die erhoffte religiöse Versöhnung blieb aus. Als Kaiser Maurikios im Jahre 582 wieder gegen die Perser zu Felde zog, kämpfte Mundhir auf seiner Seite. Es gelang ihm noch einmal, die Lakhmiden zu besiegen, aber Maurikios selbst wurde zurückgeschlagen und der Kaiser verdächtigte Mundhir des Verrats. (Mundhir hatte vielleicht etwas Falsches getan oder aber Maurikios brauchte schlicht einen Sündenbock.) Im Jahr 584 beschied Maurikios Mundhir nach Konstantinopel. Der kam auch, denn sein Nichterscheinen wäre einem Aufstand gleichgekommen. Er wurde gefesselt und mit seiner Familie nach Sizilien verbannt.
Als Mundhirs Sohn Nuʿmaan das erfuhr, stellte er ein Heer zusammen und plünderte Bostra (Bosra), die byzantinische Hauptstadt in Syrien (im äußersten Südwesten des heutigen Syriens). Hierauf erteilte Maurikios auch ihm den Befehl, nach Konstantinopel zu kommen. Nuʿmaan gehorchte und Maurikios teilte ihm mit, sein Vater dürfe zurückkehren, wenn er jetzt die Perser überfallen würde. Nuʿmaan weigerte sich und ging. Daraufhin wurde auch er gefangen genommen und nach Sizilien transportiert. Diese ‚Enthauptung“ des Königreichs der Ghassaniden hatte schwerwiegende Folgen: Aller Einfluss, den sie sich aufgebaut hatten, und alle Verträge, die sie mit anderen Stämmen geschlossen hatten, waren auf einen Schlag hinfällig. Der byzantinische ‚Verrat‘ erzeugte böses Blut. Dem christlichen Chronisten Michael dem Syrier nach fiel das Königreich der Ghassaniden in 15 kleine Fürstentümer auseinander, „von denen die meisten die Seite der Perser wählten“.
Zur selben Zeit bekamen die Perser große Probleme mit ihren eigenen arabischen Vasallen, den Lakhmiden. Um die Ursachen des Konflikts zu verstehen, müssen wir drei Jahrhunderte zurückgehen. Die Lakhmidische Koalition, die vom dem Clan Nasr dominiert wurde, wird bereits in einer Inschrift in Pakuli genannt (an der heutigen irakisch-iranischen Grenze). Darin berichtet der sassanidische König Narseh (reg. 293–302), dass seine Macht von „Amr, dem König der Lakhmiden“, anerkannt würde. Als die Perser um 297 wieder einmal von den Römern geschlagen worden waren und zur Anerkennung eines demütigenden Friedens gezwungen wurden, beschloss Imru al-Qais, der Sohn Amrs, das Chaos in Persien auszunutzen. Er bemannte eine Kriegsflotte und plünderte die Städte auf der persischen Seite des Persischen Golfs. Aber das Chaos dauerte nicht lange. Schapur II., der neue persische Herrscher, organisierte eine Strafexpedition und verwüstete Imru al-Qais’ Hauptstadt al-Hira. Danach zog er, wie es heißt, an der Ostküste entlang über Mittelarabien bis nach Yathrib (dem späteren Medina) und kehrte dann nach Persien zurück.
Imru al-Qais floh nach Syrien. Er starb 328. Sein Grab hat man in al-Namara gefunden, südöstlich von Damaskus. Der Text auf dem Grab ist insofern interessant, als die Sprache zwar Arabisch ist, der Steinmetz aber dafür die Schrift eines Volkes aus der Nachbarschaft benutzte, die der Nabatäer. Dort steht:
„Dies ist das Monument von Imru al-Qais, Sohn von Amr, König aller Araber, der beide Teile von al-Azd und Nizar und ihre Könige beherrschte, und der Madhij strafte, sodass er ihn erfolgreich schlug im bewässerten Land von Nadschran, dem Reich der Shammar. Und er regierte Maʾad. Und kein König hat seine Leistungen erreicht bis zum Augenblick, da er wohlhabend starb im Jahr 223 [der nabatäischen Zeitrechnung], am siebten Tag des Monats Kislul.“
Imru al-Qais nennt sich stolz „König aller Araber“ (oder auch „aller arabischen Stämme“). Das legt nahe, dass Nasr (sicher nicht als Einziger) bereits im 4. Jahrhundert nach einem arabischen Königreich unter seiner Führung strebte. Der Text meldet eine Expedition nach Nadschran, der christlichen Stadt im Süden Arabiens. Wir werden noch sehen, dass nicht ausgeschlossen ist, dass er dort gewesen ist.
Die Perser und Lakhmiden schlossen Frieden und es kam sogar zu sehr guten Beziehungen. Gleich ihren byzantinischen Feinden vergaben sie dabei wohlklingende Titel. Chosrau I. nannte Mundhir III. ibn Nuʿmaan (reg. 504–554) „Herrscher über Bahrain, Oman und Yamama“ (also über die arabische Ostküste und Zentralarabien). Die Perser nannten ihn irgendwann sogar Herrscher über die gesamte Westküste inklusive der Karawanenstadt Taʾif bei Mekka, doch war dieser Titel wohl eher als Aufforderung an die Adresse von Mundhir III. gerichtet, dieser Region mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Das Ende der Nasr (und des ‚Königreichs‘ der Lakhmiden) wurde wahrscheinlich durch die oben bereits erwähnte Niederlage im Jahr 582 gegen den ghassanischen Mundhir und die Bekehrung Nasrs zum nestorianischen Christentum eingeläutet. (Die Anhänger Nestors hatten sich vor allem in Mesopotamien niedergelassen, waren daher Nachbarn.) Dieser Schritt muss ein empfindlicher Schlag gegen die mächtigen zoroastrischen Priester am persischen Hof gewesen sein, denn die führten gerade in der Zeit eine erbitterte Kampagne gegen Juden und Christen. Als in Persien 594 ein Bürgerkrieg ausbrach, wählten die Lakhmiden die Seite von Bistam, dem Gegner des jungen Prinzen Chosrau. Anfangs erschien das vernünftig: Bistam siegte und Chosrau floh über Armenien nach Konstantinopel. Damit schienen die Verhältnisse geklärt. Doch Maurikios kam dem Flüchtling zu Hilfe, überfiel Persien und setzte den jungen Prinzen Chosrau II. auf den Thron. Danach konnten die Lakhmiden es Chosrau natürlich nicht mehr recht machen. 602, das Jahr, in dem Maurikios ermordet wurde und Chosrau das Byzantinische Reich überfiel – angeblich, um den Tod seines Beschützers zu rächen –, ließ Chosrau Nuʿmaan vergiften. Die Stämme der Lakhmidischen Föderation wurden von da an von einem persischen Gouverneur verwaltet. Doch brach faktisch in der nordöstlichen Region Arabiens das Chaos aus – genauso, wie das zuvor im Westen nach dem Fall der Ghassaniden geschehen war. Die sogenannte Chronik von Seert berichtet:
„Nachdem Chosrau auf verräterische Art Nuʿmaan ibn Mundhir, König der Araber, und seinen Sohn vergiftet hatte, brachen die Araber in den Reichen der Perser und der Römer ihre Verträge und zerstreuten sich, jeder nach seinem Willen. So wurden sie stark und richteten viel Unheil in den Provinzen an, und so [verhielten sie sich] bis zum Aufkommen des islamischen Gesetzgebers.“
Die aufrührerischen Stämme, von denen der anonyme syrische Chronist berichtet, erwiesen sich als unangenehme Feinde. Der persische Gouverneur Nakhirjan geriet mit mehreren Stämmen aneinander, darunter mit dem mächtigen christlichen Stamm Bakr. Chosrau, der sich heftig gegen die Byzantiner wehren musste, stellte ein kombiniertes persisch-arabisches Heer zusammen, um mit dieser Koalition abzurechnen. Aber die Schlacht von Dhu Qar (etwa im Jahr 610) endete in einem gloriosen Sieg für den Stamm Bakr und seine Verbündeten. Dieser Sieg bewirkte, wie es scheint, einen gewaltigen Aufschwung für das arabische ‚Bewusstsein‘. Die Schlacht bei Dhu Qar ist in die Geschichte eingegangen als ein großer Sieg ‚der‘ Araber über die Perser. Der bereits genannte al-Tabari beschreibt die Schlacht als „die erste Konfrontation, in der die Araber mit den Nicht-Arabern abrechneten“.
Es war also möglich. Eine starke arabische Koalition konnte das mächtige Persische Reich besiegen. Araber brauchten keine Ohnmächtigen mehr zu sein auf dem Schachbrett der Byzantiner und Perser. (So wenigstens möchten die Araber es sehen.) Das eben Beschriebene war nicht nur den Ghassaniden und Lakhmiden passiert, sondern auch den Königen von Himyar. Denn: Es war nicht der Damm von Marab, der den Untergang Himyars herbeiführte. Das geeinte arabische Königreich war nicht der Überschwemmung zum Opfer gefallen. Es war im Kampf der beiden Großmächte zerrieben worden.