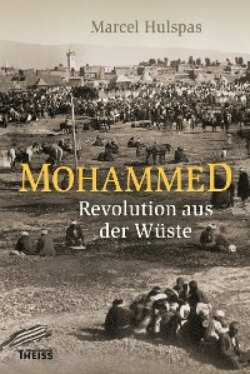Читать книгу Mohammed - Marcel Hulspas - Страница 8
1 Das verhängnisvolle Jahr 602
ОглавлениеIm vierzehnten Regierungsjahr von König Chosrau und dem zwanzigsten Regierungsjahr von Kaiser Maurikios erhob sich die byzantinische Armee in Thrakien gegen den Kaiser und setzte einen Mann namens Phokas als ihren König auf den Thron. Nachdem sie gemeinsam nach Konstantinopel gezogen waren, ermordeten sie den Kaiser und seinen Söhne und setzten Phokas auf den Thron des Reiches. Danach zogen sie nach Thrakien, um den Feind aufzuhalten.
So der armenische Geschichtsschreiber Sebeos. Das Byzantinische Reich hatte schon so manche politische Krise und Palastrevolution erlebt. Aber dieser Staatsstreich im Jahre 602 war anders. Zum ersten Mal in der Geschichte des Reiches wurde ein regierender christlicher Kaiser ermordet. Außerdem ließ Phokas dessen fünf Söhne umbringen. Dieses beispiellose Blutbad war der Auftakt zu Entwicklungen, die weitreichende Folgen haben sollten.
Chosrau war König der Könige im Persischen Reich. Die Perser waren die Erzfeinde der Byzantiner. Die byzantinischen Kaiser wiederum befanden sich oft in der schwierigen Lage, ihre Aufmerksamkeit (und ihre Armeen) gleichzeitig nach Osten und nach Westen lenken zu müssen; Gefahr drohte von den Persern und zugleich von den Stämmen in Thrakien (dem heutigen Bulgarien und Rumänien). Die Truppen in Thrakien, die unter Phokas’ Leitung standen, waren offenbar unzufrieden mit der Unterstützung aus Konstantinopel. Daher beschlossen sie, einen der ihren zum Kaiser zu machen, einen, der ihren Interessen besser dienen würde: ihren eigenen Befehlshaber. Aber Kaiser Maurikios saß schon zwanzig Jahre lang auf dem Thron, was für byzantinische Verhältnisse eine beachtliche Leistung war, ein Zeichen, dass er sein Geschäft verstand. Auch hatte er sich in diesen zwanzig Jahren durch strategische Besetzung der wichtigen Posten mit treuen Gefolgsleuten im ganzen Reich eine stabile Machtbasis aufgebaut. Und die waren nun nicht bereit, sich Phokas zu unterwerfen.
Schon bald entstand das Gerücht, Maurikios’ ältester Sohn habe dem Blutbad entkommen können. Sebeos berichtet:
„Nun hatte Kaiser Maurikios einen Sohn, genannt Theodosios, und das Gerücht ging durch das ganze Land, Theodosios sei entkommen und zum persischen König geflohen. Also entstand große Unruhe unter den Römern. In der Hauptstadt, in der Stadt Alexandrien in Ägypten, in Jerusalem und Antiochien und in allen Teilen des Landes griffen die Menschen zu ihren Schwertern und ermordeten sich gegenseitig. Kaiser Phokas erließ den Befehl, alle Rebellen zu töten, die seine Herrschaft nicht anerkannten. Viele Menschen wurden in der Hauptstadt getötet. Er sandte einen Prinzen namens Bonos mit Truppen nach Antiochien, Jerusalem und allen Teilen des Landes. Dieser zog los und eroberte Antiochien und Jerusalem, und fast alle Städte des Landes wurden mit dem Schwert verwüstet.“
Der Staatsstreich führte also zu einem blutigen Bürgerkrieg. Und das war erst der Anfang. Der persische König nutzte das Chaos im Byzantinischen Reich zu einem Angriff. Und dieser Angriff sollte dem Byzantinischen Reich fast zum Verhängnis werden. Doch sollte er zugleich den Weg freimachen für einen neuen Kaiser: Herakleios, den vielleicht größten aller byzantinischen Kaiser. Dieser sollte den Kampf mit den Persern aufnehmen und sie schließlich nach einem 25 Jahre währenden Krieg schlagen.
Dieser gigantische Krieg wird allgemein als der letzte große militärische Konflikt der antiken Welt angesehen. Als die Lage sich beruhigt hatte, waren beide Reiche aber derartig geschwächt, dass die ganze Region fast mühelos einer völlig neuen Macht in die Hände fallen konnte: den Arabern. Diese führten einen neuen Glauben ein, den Islam. In Gang gesetzt wurden all diese Entwicklungen also von dem Staatsstreich im zwanzigsten Regierungsjahr von Maurikios, im November des Jahres 602.
Was für ein Reich war dieses Byzantinische Reich eigentlich? Das Römische Reich dehnte sich auf dem Höhepunkt seiner Macht von England bis weit in den Mittleren Osten aus. Es war das Reich von Julius Cäsar, von Kaiser Augustus, Kaiser Nero und weiteren berühmten Namen. Es umfasste das gesamte Mittelmeer, das man daher auch stolz Mare nostrum nannte: unser Meer. Ein Reich, das im Laufe der Zeit so groß geworden war, dass es unmöglich von der einen Hauptstadt, von Rom, regiert werden konnte. Die Römer waren sich dessen sehr wohl bewusst. Wenn das Reich von zwei Seiten bedroht wurde – von den Germanen und Goten aus dem Westen und von den Persern aus dem Osten beispielsweise – war es für einen einzigen Kaiser unmöglich, im Osten und Westen gleichzeitig schnell und effizient zu handeln. Dann musste er die eine Hälfte des Reiches vorübergehend ihrem Schicksal überlassen. Deshalb fasste Kaiser Diokletian den radikalen Entschluss, sein Reich in zwei Teile aufzuteilen.
Diokletian (Regierung 284–305) bestimmte seinen erfahrenen General Maximian zum Kaiser des westlichen Teils, während er selbst über den östlichen Teil herrschte. Damit verlor Rom seine Funktion als Hauptstadt: Maximian wollte mehr im Zentrum seines westlichen Teils residieren und machte Mailand zur Hauptstadt, Diokletian aber verlegte seinen Thron nach Nikomedia (dem heutigen Izmit, unweit des heutigen Istanbul). Gemeinsam versuchten sie, ein anderes Problem zu lösen, mit dem das Römisch Reich seit Jahrhunderten kämpfte: das Problem der Thronfolge. Wenn ein Kaiser gestorben war, ob ermordet oder auf dem Schlachtfeld gefallen, brach oft ein blutiger Machtkampf aus, der immer wieder die Einheit des Reiches in Gefahr brachte. Um dem vorzubeugen, bestimmten Diokletian und Maximian bereits ihre künftigen Thronfolger: Galerius und Constantius Chlorus (späterer Beiname: „der Blasse“). Diese beiden erhielten den Titel Cäsar und durften ebenfalls einen Teil des Reiches regieren. Von da an hatte das Römische Reich also eigentlich vier Kaiser.
Im Jahre 305 war der große Augenblick gekommen: Diokletian und Maximian traten gleichzeitig zurück, Galerius und Constantius wurden die neuen Kaiser des Oströmischen bzw. Weströmischen Reiches. Kein Staatsstreich, kein Blutbad, kein Krieg. Es war eine vollkommen friedliche Machtübertragung. Für römische Verhältnisse eine beachtliche Leistung. Aber am Ende war Krieg doch wieder unvermeidlich.
Um die zukünftige Beziehung zwischen den beiden Reichsteilen zu sichern, war verabredet worden, dass Constantius’ Sohn Konstantin am Hof von Diokletian in Nikomedia aufwachsen sollte. Konstantin wurde 305 also ein Untertan von Galerius. Doch ging er davon aus, dass er Kaiser des westlichen Teils werden würde und fühlte sich dort in Nikomedia letztlich nicht wohl. Heimlich flüchtete er in den Westen zu seinem Vater Constantius, der sich zu der Zeit in Britannien aufhielt. Dadurch verschlechterte sich die Beziehung zwischen Galerius und Constantius. Eigentlich hätten sie in gemeinsamer Beratung zwei neue Nachfolger bestimmen müssen, wie es Diokletian und Maximian getan hatten, was aber nicht geschah. Nach Constantius’ Tod riefen die Truppen in Britannien seinen Sohn Konstantin zum Nachfolger aus. Galerius weigerte sich, Konstantin anzuerkennen, doch die Provinzen Britannien und Gallien schlugen sich auf seine Seite. Nach einer langen Reihe von Kriegen, zuerst im Westen (wo Konstantin mit einigen Thronanwärtern abrechnen musste) und später im Osten, konnte Konstantin sich im Jahr 325 wieder einziger Kaiser des gesamten Römischen Reiches nennen. Diokletians „Experiment“ war fehlgeschlagen.
Konstantin kehrte jedoch nicht nach Mailand oder Nikomedia (oder Rom) zurück, sondern beschloss, eine neue Hauptstadt zu gründen. Dazu wählte er die Hafenstadt Byzanz (Byzantion) am Bosporos, nicht weit entfernt von Nikomedia, und gab ihr seinen eigenen Namen: Constantinopolis (Konstantinopel). Konstantin war ein tatkräftiger Regent und Konstantinopel entwickelte sich schnell zu einer wahren Weltstadt. Doch in den nun folgenden Jahrzehnten meldete sich das alte Problem der Unregierbarkeit des riesigen Reiches wieder. Die beiden Reichsteile wuchsen immer weiter auseinander und 395 teilte Theodosius II. das Reich wiederum in zwei Teile und setzte dort seine beiden Söhne Honorius und Arcadius ein. Danach sollte das Reich nie wieder eine Einheit werden.
Honorius erbte den westlichen Teil, Arcadius den Osten, inklusive Kontantinopel. Der westliche Teil wurde im darauffolgenden Jahrhundert von einer ganzen Anzahl germanischer Stämme überrannt. Der letzte westliche Kaiser, Romulus Augustus, wurde im Jahre 476 von Odoaker, einem germanischen Heerführer, abgesetzt. Danach existierte nur noch das Oströmische Reich, was in etwa dem heutigen Griechenland, dem Balkan, der Türkei, Syrien, Israel und Ägypten entsprach, dazu noch ein ganzes Stück von Afrika. Im Osten reichte es bis weit hinein nach Mesopotamien (dem heutigen Irak). Dort befand sich auch die stark bewachte Grenze zu Persien. Der Fall des westlichen Reiches fand im Osten keine nennenswerte Beachtung. Wirtschaftlich hatte man dem westlichen Teil des Reiches ohnehin keine große Bedeutung beigemessen. Sie, im Osten, waren die einzigen echten Römer! Die Historiker aber bezeichnen das Oströmische Reich ab 476 als das Byzantinische Reich, um deutlich zu machen, dass es sich sehr wohl vom ‚alten‘ Römischen Reich unterschied. Nach Byzanz also, das Konstantin zu seiner neuen Hauptstadt gemacht hatte.
Im nun folgenden Jahrhundert bis etwa zu Phokas’ Staatstreich im Jahre 602 gab es für das Byzantinische Reich glanzvolle Jahre, doch es hatte auch Katastrophen zu durchstehen. In zunehmendem Maße musste man sich gegen die Überfälle der Steppenvölker wehren, die aus Asien und Osteuropa bis zum Balkan und manchmal sogar bis vor die Tore Konstantinopels vordrangen. Das Problem war nicht neu: Die gefährlichste Attacke um 400 herum war die der Hunnen gewesen. Den Byzantinern war es letztlich gelungen, sich freizukaufen, worauf die Hunnen weiter Richtung Westeuropa zogen. Und dann kam die Beulenpest. Die Wissenschaftler sind sich bis heute nicht einig, woher diese Krankheit ursprünglich gekommen war, höchstwahrscheinlich aus Indien. 541, bei dem ersten, dem verheerendsten Ausbruch, wurde die Krankheit zuerst in Ägypten festgestellt, in der Hafenstadt Pelusium. Schon bald tauchte sie in den großen, überfüllten (und schmutzigen) Städten Alexandrien und Konstantinopel auf, danach in Syrien, wo die dritte große Stadt des Reiches lag: Antiochien. Danach erreichte die Krankheit Mesopotamien und um das Jahr 545 Persien.
Konstantinopel musste bereits im Sommer 542 mit der Beulenpest kämpfen. Innerhalb von vier Monaten starb schätzungsweise die Hälfte der 500.000 Einwohner. Auch der damalige Kaiser Justinian erkrankte, genas jedoch. Der Historiker Prokop, der sich während des ersten Ausbruchs der Krankheit in der Stadt aufhielt, schreibt, dass „die ganze Menschheit fast völlig ausgerottet wurde“. Zuerst begrub man die Leichen, doch bald musste man sogar die Türme der Stadtmauern mit ihnen füllen. Noch später versenkte man sie im Meer. In den darauffolgenden Jahrzehnten sollte die Pest noch einige Male ausbrechen und immer wieder viele Opfer fordern.
Eine weitere ‚Plage‘, von der das Byzantinische Reich regelmäßig heimgesucht wurde, bildeten die religiösen Konflikte. Nicht nur zwischen den Juden und den Christen, sondern unter den Christen selbst gab es immer stärkere Spannungen. Das Christentum war im 4. Jahrhundert die dominierende Religion im Römischen Reich geworden, doch am Ende des Jahrhunderts, also noch bevor der östliche und der westliche Teil eigene Wege einschlugen, war in der Kirche ein heftiger Konflikt ausgebrochen über die alte Frage: Was war Jesus nun genau? Ein Gott, ein Mensch oder beides? Der Kern des Problems war, dass der (Erz-)Engel Gabriel Maria verkündigt hatte, sie würde einen Sohn gebären, und auf Marias Frage, wie das möglich sei, geantwortet hatte: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich beschatten.“ Darum solle das Kind „Sohn Gottes“ genannt werden (Lk 1,35). War er damit ein Gott? Oder war Jesus ein Mensch von Fleisch und Blut und hatte als normaler Mensch auf der Erde gelebt? Der Apostel Paulus rang schon mit dieser Frage und nannte Jesus in seinem 1. Brief an die Korinther „den letzten Adam“. Beide, Adam und Jesus, waren keine normalen Sterblichen, sondern waren von Gott ins Leben gerufen (wobei Paulus hinzufügt, Adam sei von der Erde, irdisch, während Jesu Leib vom Himmel sei, geistig; 1 Kor 15,45). Der Evangelist Johannes betrachtete Jesus als eine rein geistige Erscheinung, verursacht durch Gottes Wort: „Das Wort ist Mensch geworden“ (Joh 1,14). Aus dieser Diskussion entstand die offizielle Lehre der Kirche, die besagte, dass Christus der Sohn Gottes sei und zugleich Teil der göttlichen Dreieinigkeit (Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist). Und zu seiner „Natur“ hieß es: Christus war nicht ausschließlich Gott und nicht ausschließlich Mensch; er war beides. Aber auch wieder nicht halb Gott, halb Mensch. Jesus hatte, wie es offiziell hieß, zwei „Naturen“; eine göttliche und auch eine menschliche (im Griechischen dyo physeis, und deshalb hieß es „Dyophysitismus“). Wie diese Verbindung aber genau aussah, war den meisten Menschen nicht deutlich.
Etwa um das Jahr 400 verfocht der spätere Bischof Nestorius von Konstantinopel eine bestimmte Anschauung, die zu gewaltigen Konflikten führen sollte. Nestorius rang darum, die Rolle Marias zu verstehen. Konnte ein Mensch einen Gott gebären? Er löste die Frage, indem er sagte, Maria sei nur die Mutter des menschlichen Jesus gewesen, nicht des göttlichen. Doch es war die Zeit einer großen Marienverehrung und Nestor wurde demzufolge heftig angefeindet. Sein größter Widersacher war Bischof Kyrill von Alexandrien, der meinte, Nestorius habe die göttliche und die menschliche Natur Christi zu stark auseinandergezogen. Kyrill beschrieb Christus als „eine einzige fleischgewordene Natur von Gottes Wort“. Christus habe also nicht aus zwei „Naturen“ bestanden, sondern sei eine mystische Transformation der einen, einzigen göttlichen Natur von Gottes Wort zu einem dynamischen Ganzen. (Diese Auffassung ist unter der Bezeichnung Mia- oder Monophysitismus bekannt.)
Um den Streit zu beenden, berief Kaiser Theodosius II. das Konzil zu Ephesus (431) ein, auf dem zur Verwunderung vieler Zeitgenossen Nestorius exkommuniziert wurde. Maria wurde offiziell zur Theotokos, der Gottesgebärerin, ausgerufen. Hiermit hatte Alexandrien jetzt die geistliche Führung der Kirche inne. Von Anfang an spielten regionale Gegensätze in dieser Diskussion eine große Rolle. Regionen, die sich gegen die kaiserliche Macht auflehnten, suchten auch auf theologischem Gebiet eine eigene Richtung. Es ist also nicht erstaunlich, dass die Christen der dritten großen Stadt des Reiches, Antiochien, Nestorius’ Lehre treu blieben. Nach seiner Verurteilung verzogen sich viele seiner Anhänger, die ‚nestorianischen Christen‘, in die Randgebiete des Reiches oder ins persische Mesopotamien.
Nun folgten Versuche, zu einer für alle akzeptablen Formulierung zu gelangen, und inzwischen kamen andere Bischöfe und Geistliche mit wieder anderen Lösungen. Wie etwa Eutychios, nach dessen Meinung die göttliche Natur des Christus seine menschliche Natur gleichsam verschluckt habe. Eutychios wurde exkommuniziert und später wieder rehabilitiert. Seine Gegner, die zuerst triumphiert hatten, wurden nachträglich exkommuniziert. Das Chaos wurde immer größer, bis Kaiser Markian im Jahre 451 das Konzil von Chalcedon einberief. Es wurden gewaltige Anstrengungen unternommen, den Frieden wiederherzustellen. Bischof Dioskoros I. von Alexandrien, Anhänger des Monophysitismus, wurde abgesetzt, allerdings nicht exkommuniziert. Auf Bitten von Kaiser Markian formulierten die Bischöfe, wie man sich die beiden Naturen vorstellen sollte: Christus war „zwei Naturen in einer Person und Hypostasis“, wobei letzteres soviel wie „Einheit“ bedeutete. Auf diese Formulierung wollten sich die Anhänger Kyrills nicht einlassen. Die Kirche im Westen unter Führung des Bischofs von Rom war einverstanden und auch die christlichen Einwohner Palästinas stimmten zu. Doch die Christen in Syrien, Ägypten, in Aksum (heute im Norden Äthiopiens, das damals gerade christlich geworden war) und das entfernte Armenien verwarfen den Spruch des Konzils.
In dem darauffolgenden halben Jahrhundert bekämpften sich die Bischöfe weiterhin. (Und auch die normalen Gläubigen wollten sich beteiligen: 457 wurde ein von Konstantinopel bestimmter Bischof von einer wütenden Menge in Alexandrien gelyncht.) Alle kaiserlichen Versuche, zu einer für jeden akzeptablen Lösung zu kommen, blieben erfolglos.
Anfang des 6. Jahrhunderts war die kaiserliche Geduld mit den Monophysiten erschöpft. Dabei mochte die Tatsache mitspielen, dass das Byzantinische Reich im Banne der Endzeit lebte. Es würde nicht mehr lange dauern, dann würde Gottes Schöpfung 6000 Jahre alt sein. Dann würde Christus auf die Erde zurückkehren. Darauf musste sich das Reich vorbereiten, unter anderem, indem es mit den ketzerischen Strömungen ein Ende machte. So wurde 529 die ‚heidnische‘ Neuplatonische Akademie von Athen endgültig geschlossen. Die Monophysiten wurden anfangs vorsichtiger behandelt. Kaiser Anastasios I. unternahm noch einige Versuche, den endgültigen Bruch zu vermeiden. Sein bekanntester Versöhnungsversuch war 512 die Verbreitung eines alten Hymnus, des Trishagion, mit einem kurzen Satz, dass es der Gott Christus gewesen ist, der am Kreuz gelitten hat. Das Volk von Konstantinopel wollte davon nichts wissen, es empörte sich und zwang Anastasios zu demütigenden Büßergesten im Hippodrom. Danach musste er sich auch noch gegen den gefährlichen Versuch des Heermeisters Vitalian wehren, der ihm den Thron streitig machen wollte.
Eine religiöse Versöhnung schien danach ausgeschlossen. Spätere Nachfolger von Anastasios I., Justin I. und Justinian I., setzten die Monophysiten unter Druck, wodurch sich der Konflikt nur noch mehr verschärfte. Justinian musste vorsichtig operieren, um dem Reich keinen Schaden zuzufügen. Die Monophysiten bekamen Unterstützung aus den höchsten Kreisen – zum Beispiel von seiner eigenen Frau Theodora. Etwa um das Jahr 540 erteilte sie dem aus Alexandrien verbannten Patriarchen Theodosius die Erlaubnis, zwei monophysitische Priester zu Bischöfen zu weihen. Einer von ihnen, Theodoros von Arabien, ging zu den arabischen Christen, der andere, Jakob Baradeus, ließ sich in Edessa (dem heutigen Şanlıurfa im Südosten der Türkei) nieder. Er selbst weihte noch mehr Priester und Bischöfe. Dank Theodora und wahrscheinlich mit schweigender Zustimmung Justinians konnten die Monophysiten in der Mitte des 6. Jahrhunderts ihre eigene kirchliche Organisation aufbauen.
Die Historiker sind sich nicht einig, wieweit die vielen aufeinanderfolgenden Pestepidemien die Schwächung des Byzantinischen Reiches verursacht und damit die verhängnisvollen Ereignisse nach 602 befördert haben. Oft wird die Ansicht geäußert, dass sie der byzantinischen Wirtschaft stark geschadet hätten. Das ist zwar naheliegend, eindeutige Beweise aber fehlen. Dagegen gibt es überzeugende Hinweise, dass die religiösen Konflikte sehr zum Verfall von Byzanz beigetragen haben. Sie verursachten eine tiefe Kluft zwischen der Elite in Konstantinopel und den ‚ketzerischen‘ Randgebieten des Reiches. Doch der stärkste Grund der Instabilität war zweifellos die dritte ‚Plage‘: die unaufhörlichen Kriege mit dem Persischen Reich.
Während seiner Expansion in östliche Richtung im 1. Jahrhundert v. Chr. machte das Römische Reich an den Ufern von Euphrat und Tigris Bekanntschaft mit den Parthern. Die Parther waren ein ursprünglich ostiranisches Volk, das zu der Zeit über das Persische Reich herrschte. Die Römer operierten vorsichtig; sie begriffen, dass sie es hier mit einem gefährlichen Feind zu tun hatten, der sich nicht wie irgendein kleines Königreich einschüchtern ließ. Im Jahre 53 v. Chr. fasste der römische General Marcus Licinius Crassus jedoch den Entschluss, Mesopotamien, die fruchtbaren Ebenen zu beiden Seiten von Euphrat und Tigris dem Römischen Reich einzuverleiben. Dafür brauchte er die Parther nur in die Richtung ihres Mutterlandes zurückzudrängen – eine furchtbare Fehleinschätzung. In der berüchtigten Schlacht bei Carrhae wurden die Römer vernichtend geschlagen. Auch Crassus selbst und sein Sohn kamen dabei ums Leben. Von da an war Krieg zwischen Rom und Persien – dieser eine Krieg, den die Römer nicht gewinnen konnten. Starke Kaiser eroberten Gebiete, die schwächere Kaiser wieder preisgeben mussten. Im Jahr 226 wurde die Situation für die Römer geradezu lebensgefährlich, als die letzte parthische Dynastie (die Asarkiden, die das Persische Reich immer recht locker regiert hatten) von der viel fanatischeren Dynastie der Sassaniden vertrieben wurde. Die träumten von einem Persischen Reich, das wieder ebenso groß und mächtig sein würde wie sieben Jahrhunderte zuvor, in den Tagen von König Kyrus dem Großen. Damals hatte sich die persische Macht vom Indus bis nach Ägypten und bis ans Ägäische Meer ausgebreitet. Das wollten die Sassaniden wieder erreichen. Und das bedeutete, dass die Römer weggefegt werden mussten.
Der erste Sassanidenkönig, Ardaschir I., sorgte vor allem für die Stabilisierung seines Regimes und die Zentralisierung der Verwaltung. Sein Sohn, Schapur I., versetzte den Römern im Jahr 224 die ersten empfindlichen Niederlagen. Er eroberte Syrien und plünderte Antiochien. Danach musste er einer römischen Gegenoffensive weichen, aber 244 schlug er wieder zu und konnte dabei Kaiser Gordian III. besiegen. Sechzehn Jahre später, im Jahr 260, nahm er bei einem der vielen Überfälle sogar einen römischen Kaiser (Valerian) gefangen. Aber es gelang den Sassaniden nicht, die Römer zu vertreiben. Vielmehr gerieten die beiden Supermächte drei Jahrhunderte lang immer wieder aneinander.
Im Jahr 532 schien ein Ende der Auseinandersetzungen zu kommen. Der byzantinische Kaiser Justinian I. und der persische König Chosrau I. Anuschirwan unterzeichneten einen Vertrag ‚des ewigen Friedens‘. Doch der Friede war nur von kurzer Dauer. Im Jahr 561 schloss derselbe Chosrau noch einmal einen Vertrag mit den Byzantinern – und wieder hielt der Frieden nicht, diesmal, weil die Armenier revoltierten. Armenien, hoch im Norden, in Transkaukasien, war ein christliches, den Persern unterworfenes Königreich. Als die Perser ‚ihr‘Armenien überfielen, überfiel Justinian I. das Persische Reich. Der Coup misslang. Chosrau trieb die Byzantiner wieder zurück. Das hätte das Ende für Justinian bedeuten können, doch Chosrau starb drei Jahre danach; und in Persien brach ein erbitterter Machtkampf aus. Die Byzantiner konnten aufatmen. Das Ergebnis dieses Machtkampfes sollte von großer Bedeutung für die kommenden Ereignisse sein. Wir nähern uns dem verhängnisvollen Jahr 602.
Chosraus offizieller Nachfolger, sein Sohn König Hormizd IV., wurde schnell ausgeschaltet. Deshalb schafften die Angehörigen dessen Sohn, der ebenfalls Chosrau hieß, heimlich aus dem Land. Der junge Chosrau kam zuerst nach Armenien, danach nach Konstantinopel. Kaiser Maurikios sah jetzt seine Chance, die Perser zu schwächen. Er schickte seinen Bruder mit einer Armee nach Persien, um den jungen Chosrau doch noch auf den Thron zu setzen. Andere Aufständische schlossen sich an und tatsächlich ging Maurikios’ Plan auf. Chosrau wurde Chosrau II., der neue König von Persien. Zum Dank für die Hilfe überließ er Maurikios große Teile seines Reiches, darunter auch Armenien. Als Phokas im Jahr 602 Maurikios und seine Söhne ermorden ließ, war Chosrau empört: Sein byzantinischer Beschützer war ermordet worden! Sofort erklärte er Phokas den Krieg. Es bleibt allerdings offen, ob das nur geschah, um den Tod des Maurikios zu rächen.
Im März 603 marschierte die persische Armee – diesmal unter Chosrau II. – noch einmal in Armenien ein, während eine zweite Armee den Norden Mesopotamiens überfiel. Der Krieg dauerte jahrelang. Phokas konnte keine schlagkräftige Verteidigung organisieren. Er musste sich gegen den aufständischen General Narses wehren, ein Mitglied der alten Garde des Maurikios, die sich in Edessa verschanzt hatte. Narses wurde von den Persern bedroht und unternahm einen Einigungsversuch. Dabei machte er geschickt Gebrauch von dem Gerücht, der Sohn des Maurikios sei noch am Leben. Sebeos schreibt:
„[Chosrau II.] überfiel sie frühmorgens, überraschend. Einige fielen durchs Schwert, andere ergriffen die Flucht. Einige, die zum Euphrat geflüchtet waren, starben dort; einige wurden verfolgt. König Chosrau näherte sich dem Stadttor, damit ihm geöffnet würde und er hineinkönnte. Da legte Narses einem jungen Mann ein königliches Gewand an, setzte ihm eine Krone aufs Haupt und schickte ihn zu Chosrau mit den Worten: ‚Dies ist Theodosios, der Sohn des Maurikios. Habt Mitleid mit ihm, wie sein Vater Mitleid mit Euch hatte.‘“
Narses wollte gemeinsam mit Chosrau nach Konstantinopel, um diesen „Sohn des Maurikios“ auf den Thron zu setzen. Chosrau behandelte den kleinen Theodosius mit königlichen Ehren und nahm ihn mit nach Ktesiphon (am Tigris, in der Nähe des heutigen Bagdad). Danach hat man nie wieder etwas von dem jungen Mann gehört. Phokas ließ Narses kurz darauf umbringen. Chosrau II. startete im Jahr 606 eine neue Offensive und drang bis weit ins Land Syrien vor. Eine Stadt nach der anderen fiel in persische Hand. Um die zusammenbrechende östliche Front zu stärken, zog Phokas möglichst viele Truppen aus Thrakien ab, was die Lage jedoch nicht besserte. Die Perser drangen bis nach Kleinasien vor. In Konstantinopel wusste man: Phokas muss verschwinden, und zwar so schnell wie möglich.
Es gab eine Möglichkeit. Herakleios, einer der von Maurikios eingesetzten Unterkönige und Herrscher über Nordafrika, lehnte sich gegen Phokas auf. Seine Anhänger eroberten Alexandrien. Phokas schickte von Konstantinopel aus eine Flotte, die Alexandrien vom Meer aus erobern sollte, was aber misslang. Stattdessen segelte im Oktober 610 eine Kriegsflotte in die entgegengesetzte Richtung: von Alexandrien nach Konstantinopel. Sie stand unter dem Befehl von Herakleios, dem Sohn des Herakleios. Als er den Fuß an Land setzte, hatten Mitverschwörer in Konstantinopel bereits die notwendige Vorarbeit geleistet. Der junge Herakleios hatte die Stadt schnell unter Kontrolle. Als Erstes räumte er Phokas selbst und alle, die ihn allzu begeistert unterstützt hatten, aus dem Weg. Danach schickte er den Persern eine diplomatische Delegation. Jetzt gäbe es keinen Grund mehr, weiterzukämpfen, ließ er Chosrau wissen. Phokas, der Mörder des Maurikios, sei tot. In dem Moment wurde offensichtlich, um was es dem persischen König in diesem Krieg in Wahrheit ging. Er ließ die Gesandten umbringen und gab so unmissverständlich zu verstehen, dass er nicht die Absicht hatte, die Waffen niederzulegen: Hier lag eine einzigartige Chance, ein für alle Mal mit den Byzantinern abzurechnen. Es ging um alles oder nichts.
Der Kampf ging also weiter. Im Jahr 611, nach langer Belagerung, eroberte Chosrau II. Antiochien. Danach kehrte er nicht um, sondern zog weiter westwärts. Herakleios vertrieb Chosrau im Jahr darauf zwar aus Kleinasien, doch sein Überfall auf Syrien wurde eine völlige Niederlage. Und ein Jahr später, 614, fielen Syrien und Palästina endgültig in persische Hand. Im darauffolgenden Jahr stieß Persien zuerst bis nach Kleinasien vor und von dort bis an den Bosporus, direkt gegenüber Konstantinopel. Herakleios wollte verhandeln oder zumindest Zeit gewinnen, doch Chosrau witterte schon seinen Sieg und forderte die völlige Übergabe. Herakleios musste Christus abschwören und von nun an die persischen Götter verehren.
Schließlich zogen die Perser sich wieder aus Kleinasien zurück, um im Jahr 624 mit einem viel größeren Heer zurückzukehren. Es wurde Zeit für die endgültige Vernichtung. Sie hatten einen Vertrag mit den Awaren geschlossen, einem Volk, das schon seit geraumer Zeit das Byzantinische Reich von Thrakien aus bedrohte. Perser und Awaren griffen gleichzeitig an: die Perser aus dem Osten, die Awaren aus dem Westen. Zwei Jahre lang war die Stadt vollständig eingeschlossen. Nur die byzantinische Flotte konnte noch etwas ausrichten und die Stadt vom Meer aus mit Lebensmitteln versorgen. Zwei Jahre lang hing die Zukunft des Byzantinischen Reiches am seidenen Faden. Herakleios ergriff seine letzte Chance. Er verließ die Stadt mit einem kleinen, aber sehr gut trainierten Heer. Er würde den Kampf im Norden fortsetzen. Keiner hätte in diesen bangen Jahren von einem Sieg über die Perser auch nur zu träumen gewagt, geschweige denn von einem Zusammenbruch des Persischen Reiches. Und niemand hätte prophezeien können, dass unmittelbar darauf wieder eine andere Weltmacht auf der Bühne erscheinen würde – direkt aus der Arabischen Wüste. Doch jeder begriff, dass dies nicht ein normaler Krieg war. Die Existenz des Christentums stand auf dem Spiel.