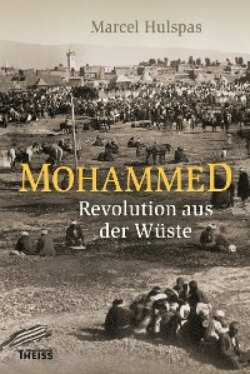Читать книгу Mohammed - Marcel Hulspas - Страница 6
Einleitung
ОглавлениеEr behauptet hartnäckig, dass sie [die Schrift] von Gott auf ihn herabgekommen sei.
Johannes von Damaskus
Wer war Mohammed? Wer war dieser Prophet, von dem die Araber sprachen? Und welche Offenbarung sollte er ihnen gebracht haben? Kam die wirklich von Gott? Eine Offenbarung auf Arabisch, für die Araber? Die Bewohner Palästinas und Syriens – Juden und Christen – konnten es kaum glauben. Er musste ein Betrüger sein, ein Lügner. Aber es war höchst unklug, das laut zu sagen.
Im Jahre 634 hatte alles angefangen. In dem Frühjahr waren urplötzlich riesige arabische Armeen aus dem Süden aufgetaucht. Eine war in der Gegend um Gaza auf eine byzantinische Armee gestoßen, doch die war kein ernst zu nehmender Gegner. Die Byzantiner ergriffen die Flucht und die Araber plünderten danach den ganzen Landstrich. Sie sagten, sie kämen „von Mohammed“. Der sei ihr Prophet. Man hatte keine Ahnung, wovon sie sprachen.
Im Jahre 636 rückten sie nach Norden vor, nach Damaskus und weiter. Kaiser Herakleios mochte einige Jahre zuvor das mächtige Persische Reich in die Knie gezwungen haben – jetzt aber war er unfähig, die plündernden Horden zu vertreiben. Als sie sich der Stadt Homs näherten, konnte er sie noch durch schnelles Eingreifen zurückdrängen und es kam zu einer richtigen Schlacht. Doch die Byzantiner leisteten sich taktische Fehler und wurden auseinandergetrieben. Wieder zogen die Araber Richtung Homs. Letztlich ergriff Herakleios die Flucht und zog nach Westen in seine Hauptstadt Konstantinopel. Würde er jemals zurückkehren, fragten sich alle. Würde er den Glanz des alten Reiches wieder herstellen können? Und viele fragten sich auch: Welche Verbrechen hatten sie begangen, dass ihnen dieses grausame Schicksal zuteilwurde? Sophronios, Patriarch von Jerusalem und ein Gefangener in seiner eigenen Stadt, wusste, warum Gott die wilden „Sarazenen“ auf sie losgelassen hatte: Die Christen hatten gesündigt und Gott gab ihnen den verdienten Lohn. In seiner Predigt zum Dreikönigstag 636 (oder 637) wetterte er gnadenlos:
„Das ist der Grund, weshalb die rachsüchtigen und Gott hassenden Sarazenen, deren verwüstende Gräueltaten klar und deutlich von den Propheten vorhergesagt wurden, Orte zerstören, die ihnen verboten sind, Städte plündern, Felder verwüsten, Dörfer niederbrennen, heilige Kirchen in Brand stecken, die heiligen Klöster erobern, den Kampf mit den byzantinischen Armeen aufnehmen, die gegen sie zu Felde ziehen, und die im Kampf eroberte Kriegsbeute horten und einen Sieg nach dem anderen erringen.“
Der Kaiser kam nicht zurück. Die jüdischen und christlichen Bewohner Syriens und Palästinas hatten kaum Kontakt zu ihren neuen Herrschern. Und von dem Glauben der Araber verstanden sie so gut wie gar nichts. Die arabischen Herrscher ihrerseits interessierten sich nicht für die Religionen ihrer Untertanen. Christen und Juden – für sie war das ein und dasselbe. Sie nannten sie die „Leute des Buches“, das hieß, dass ihre Propheten ihnen schon viel früher Gottes Offenbarung gebracht hatten. Doch danach waren sie Gott untreu geworden. Sie, die Araber, hatten von ihrem eigenen Propheten Mohammed die definitive, die perfekte Offenbarung empfangen. Und Mohammed hatte gesagt, sie müssten die „Leute des Buches“ mit Respekt behandeln. Sie durften ihren Glauben behalten und mussten für ihren Schutz eine Sondersteuer zahlen, die Dschizya. Doch es ging nicht darum, sie zum Islam zu bekehren. Denn der Koran, die perfekte Offenbarung, war in arabischer Sprache herabgesandt worden, galt also ausschließlich für die Araber.
Natürlich war es doch möglich, Muslim zu werden. Gottes Botschaft war im Prinzip für die ganze Menschheit bestimmt. Doch die Araber hatten die nötigen Hindernisse aufgebaut. So befanden sie, dass jemand, der Muslim werden wollte, zuvor ein Abkommen mit einem Araber schließen musste; dann wurde er ein Mawla, das hieß, dass er zum Stamm gehörte. Es war, mit anderen Worten, etwas Außergewöhnliches, ein unerhörter Schritt, zu dem niemand ermuntert wurde. Kurz, in den ersten Jahrzehnten nach der Eroberung gingen die arabischen Herrscher und ihre Untertanen einander vor allem aus dem Weg. Das änderte sich erst unter der Herrschaft des berühmten Kalifen Abd al-Malik ibn Marwan.
Abd al-Malik (regierte 685–707) kam nach zwanzig Jahre dauernden heftigen Flügelkämpfen innerhalb des islamischen Reiches an die Macht. Dieser erste Bürgerkrieg (die Tradition spricht von der ersten Fitna) brach im Jahre 656 aus. Anlass dafür war, dass Uthman, der dritte Kalif seit dem Tode Mohammeds (reg. 644–656), wichtige Regierungsposten vorzugsweise mit Mitgliedern seiner eigenen Familie besetzte. Dagegen erhoben sich Truppen im Irak und in Ägypten; sie zogen nach Medina, der damaligen Hauptstadt. Uthman wurde in seinem Palast ermordet. Die Aufständischen bestimmten daraufhin Ali, Mohammeds Schwiegersohn, zum neuen Anführer. Der ließ jedoch die Mörder Uthmans unbehelligt und zog sich damit den Zorn der wütenden Aischa zu, einer der bedeutendsten Witwen des Propheten, sowie Muawiyas, des Gouverneurs von Syrien und späteren Kalifen aus der Umayyaden-Familie (und Verwandten Uthmans). Ali besiegte Aischa in der „Kamelschlacht“, wurde danach aber selbst von Muawiya geschlagen und kurz darauf von Extremisten ermordet. Danach blieb es einige Jahre lang relativ ruhig. Muawiyas Versuch, Konstantinopel vom Meer aus zu erobern, misslang. Nach seinem Tod (680) musste sein Sohn Yazid mit mehreren Aufständen fertig werden, einem unter Führung von Alis Sohn Hussein. Dieser wurde in der Schlacht bei Kerbela vernichtend geschlagen. Der Kampf um die Macht im islamischen Reich setzte sich auch nach Yazids Tod (683) fort, bis zwei Jahre danach Abd al-Malik in Syrien an die Macht kam. Dieser tatkräftige Kalif schloss rasch Frieden mit den Byzantinern, dirigierte seine Truppen ost- und südwärts und schlug alle Feinde. Das war der Beginn der Umayyaden-Dynastie, die bis zum Jahr 750 an der Macht bleiben sollte. (Später wurden sie von den Abbasiden verjagt, die eine neue Hauptstadt bauen ließen: Bagdad.)
Als er endlich der unbestrittene Amir al-Muminin („Führer der Gläubigen“) war, stand Abd al-Malik vor der schweren Aufgabe, ein Reich zu einer Einheit zu schmieden, das großteils von Christen und Juden und von nur wenigen Muslimen bewohnt wurde, die überdies zutiefst zerstritten waren. Vor allem die besiegten, aber durchaus nicht verschwundenen Anhänger Alis und seiner Familie (die Schiat Ali, „Alis Partei“, oder auch Schiiten) stellten eine fortwährende Bedrohung dar. Um die Einheit zu stärken, startete Abd al-Malik ein groß angelegtes Programm zur „Arabisierung“ der Gesellschaft. So führte er beispielsweise ein Maß- und Gewichtssystem ein, das traditionellen arabischen Einheiten entlehnt war. Er reformierte ebenfalls das Münzsystem. In die neuen Münzen ließ er die Schahada, das Glaubensbekenntnis, prägen: „Es gibt keinen Gott außer Gott, Mohammed ist der Gesandte Gottes“. Außerdem wurde der Islam auf diesen Münzen als Din al-Haq bezeichnet: „die wahre Religion“. Damit zwang er seine nichtmuslimischen Untertanen, Geld mit einer für sie gotteslästerlichen Botschaft mit sich zu führen. (Möglicherweise wurde er dazu allerdings von Justinian II., dem byzantinischen Kaiser, provoziert, der im Jahr 695 neue Goldmünzen mit dem Abbild des Christus herausbrachte. Byzantinische Münzen wurden auch in der islamischen Welt verwendet.)
Abd al-Malik wollte den Islam aus einem in sich gekehrten, exklusiv arabischen Glauben zu einer selbstsicheren, selbstbewussten Religion machen, zu einer Nachfolgerin des Judentums und des Christentums. Bezeichnend dafür war sein Beschluss, auf dem Tempelberg in Jerusalem ein islamisches Heiligtum zu errichten, den Felsendom. Es wurde keine Moschee; das Gebäude hat die achteckige Form, wie wir sie auch oft bei einem Martyrium antreffen. Doch es enthielt kein Grab; dieser Ort sollte verehrt werden. Islamischen Gelehrten zufolge war dies die Stelle, von der aus Mohammed seine Himmelsreise angetreten hatte. Aber auch für die Juden war es ein besonderer Ort. Dort hatte einst der Tempel Salomos gestanden und die Juden träumten davon, ihn genau an dieser Stelle wieder aufzubauen. Ihrer Meinung nach musste dieser Ort leer bleiben. Abd al-Malik kümmerte das nicht. Der Felsendom war zudem eine Provokation für die Christen. Der Kalif ließ nämlich arabische Texte an den Mauern anbringen, die besagten, Christus sei nicht der Sohn Gottes, etwa: „Sprich: ‚Er ist Gott, der Eine, Gott, der Beständige, er zeugte nicht und wurde nicht gezeugt, und keiner ist ihm ebenbürtig.‘“
Der Text stimmt mit der Sure 112 überein. Sie gehört zu den ältesten Teilen des Korans, die wir kennen. Auch Mohammed selbst wird in den Texten des Felsendoms, wenn auch nur ein einziges Mal, genannt: „Mohammed ist der Gesandte Gottes“ (vgl. Sure 33,40). All diese Texte sind offenbar auf die Christen gemünzt. Damit war die Botschaft dieses Gebäudes klar: Die Juden und die Christen sollten wissen, wohin sie gehörten und wohin nicht. Der Islam war die allen anderen überlegene Religion.
Die Christen in Syrien und Palästina wurden unruhig. Sie stellten fest, dass dieser geheimnisvolle Glaube der Araber keine unbedeutende, zweitrangige Erscheinung, sondern gefährliche Ketzerei war. Um 690 schrieb der Mönch Anastasios Sinaites den Hodegos, ein Buch mit Anweisungen zur Diskussion eines Christen mit Arabern über das, was er „die falsche Auffassungen der Sarazenen“ nennt. Wenn man Ketzer bekämpfen will, schreibt er,
„dann muss man damit anfangen, ihre falschen Vorstellungen zu verwerfen. Wenn wir beispielsweise mit Arabern reden wollen, müssen wir damit anfangen, jeden zu verurteilen, der sagt: ‚Zwei Götter‘, oder jeden, der sagt: ‚Gott hat einen Sohn gezeugt‘“.
Das war offensichtlich die größte Kritik der Muslime an den Christen: Sie verehrten nicht einen einzigen, sondern zwei Götter (nämlich auch Jesus als den Sohn Gottes), und sie behaupteten, dass Gott einen Sohn habe. Gab es Christen, die den Arabern zu widersprechen wagten? Nach dem Hodegos ist es eine Zeit lang ruhig. Doch dann, etwa vierzig Jahre später, erscheint plötzlich die Pege gnoseos des Johannes von Damaskus, ein scharfer Angriff auf den Islam.
Johannes von Damaskus war Priester, Mönch oder Kirchenvorstand, in den Quellen finden sich unterschiedliche Angaben. Wir wissen nicht, wann er geboren wurde, doch muss er vor dem Jahr 754 gestorben sein, denn in diesem Jahr wurde er während des ikonoklastischen Konzils in Hiereia posthum zum Ketzer erklärt. In diesen Dokumenten wird er als „Mansur“ bezeichnet, ein arabisches Wort, das ‚geholfen‘ bedeutet (womit meistens gemeint ist: von Gott, bei einem Sieg, es bedeutet also auch so etwas wie ‚Sieger‘). Wenn das zutrifft, war er vielleicht der Enkel von Mansur ibn Sarjun, dem Schatzmeister am Hof des Kalifen in Damaskus zu der Zeit, als die Araber die Stadt eroberten. Und dann muss er der Sohn von Sarjun ibn Mansur gewesen sein, Sekretär am arabischen Hof in Damaskus und Vertrauter von Muawiya und Abd al-Malik. Der Überlieferung zufolge zog sich Johannes von Damaskus im Alter, etwa um 730, in das berühmte Kloster Mar Saba bei Jerusalem zurück und schrieb dort auf Griechisch das Werk, das ihn berühmt machen sollte: die Pege gnoseos („Quelle der Erkenntnis“), in dem hundert Ketzereien beschrieben werden. Und Ketzerei Nummer 100 der Pege ist der Islam.
Johannes verleiht seiner Verachtung unmissverständlich Ausdruck. Er bezeichnet die Religion der Araber als „Volksverdummung“, spricht von der „Großsprecherei“, „eitlem Geschwätz“ ihres Propheten und von einer sogenannten Offenbarung „voller lachhafter Sachen“. Für ihn ist der Islam der Aberglaube eines rückständigen Volkes. Einst hätten die Araber Götzen verehrt, sagt er, „seitdem aber (und bis heute) erwuchs ihnen ein falscher Prophet, Muḥammad mit Namen, der, nachdem er mit dem Alten und Neuen Testament Bekanntschaft gemacht und anscheinend mit einem arianischen Mönch Umgang gepflegt hatte, eine eigene Häresie schuf“.
Der Islam basiert seiner Meinung nach also auf oberflächlicher Kenntnis des Judentums und des Christentums und der Begegnung mit einem ketzerischen Mönch. (Der Arianismus, auf den er verweist, existierte damals schon nicht mehr, aber er sah offensichtlich Übereinstimmungen zwischen dieser Ketzerei und dem Islam.) Die Schrift, die dieser Mohammed angeblich empfangen hatte, war Johannes zufolge nur ein Witz:
„Um beim Volk den Anschein der Gottesfurcht zu erwecken, verbreitete er zum Schein das Gerücht, vom Himmel sei eine Schrift von Gott auf ihn herabgekommen. Indem er in dem von ihm [stammenden] Buch einige Lehrsätze aufstellte, die [freilich] lächerlich sind, lehrte er sie auf die Weise die Ehrfurcht [vor Gott].“
Er bringt vor, niemand habe die Ankunft Mohammeds prophezeit und niemand sei Zeuge der Offenbarung gewesen:
„Und wenn wir ihnen das Problem stellen, daß Mose am Berge Sinai im Angesicht des ganzen Volkes das Gesetz empfing, indem sich Gott in Wolken, Blitz, Gewitter und Sturmwind offenbarte, und daß alle Propheten, von Mose angefangen, der Reihe nach über das Kommen des Messias geweissagt haben und daß Christus, [selbst] Gott und Gottes Sohn, Fleisch annehmen und kommen werde, daß er gekreuzigt werden, sterben und auferstehen, und daß er Richter über die Lebenden und die Toten sein werde – und wenn wir dann fragen: Wieso kam euer Prophet nicht auf diese Weise, indem andere über ihn Zeugnis ablegten, und wieso hat Gott nicht in eurem Beisein, wie er dem Mose im Angesicht des ganzen Volkes, als der Berg in eine Rauchwolke gehüllt war, das Gesetz übergeben hat, auch jenem [Muḥammad] die Schrift, die ihr [euer eigen] nennt, übergeben, damit auch ihr einen Beweis hättet? – [Auf alle diese Fragen] antworten sie, daß Gott tue, was er wolle. Dies, sagen wir, wissen auch wir, doch wir stellen die Frage, wie die Schrift auf euren Propheten herabkam.“
Hat Johannes von Damaskus wirklich mit Muslimen debattiert? Es ist zu bezweifeln. Obiger Dialog sagt – genau wie der des Anastasios – den Lesern, wie man mit Muslimen diskutieren soll: Stell ihnen diese Fragen, dann werden sie so oder so antworten, und gib ihnen darauf dann wieder die und die Antwort. Um zu zeigen, wie lächerlich diese sogenannte Offenbarung ist, gibt Johannes einige Beispiele. An denen erkennt man, dass der Koran, den er gelesen oder gesehen hat, im Prinzip derselbe gewesen sein muss, wie wir ihn jetzt kennen.
Es ist unklar, wann der Koran genau entstanden ist, wer Mohammeds Offenbarungen gesammelt und zusammengefügt hat. Der bekannteste Bericht (und es gibt viele) besagt, die Initiative dazu sei 633 nach der blutigen Schlacht bei al-Aqraba (in den Ridda-Kriegen) zwischen den Muslimen und ihren Gegnern ergriffen worden. Im Jahr zuvor war Mohammed gestorben. Bis dahin wurden all seine Offenbarungen auswendig gelernt und mündlich weitergegeben. Aber in der Schlacht sollen so viele seiner nächsten Gefährten umgekommen sein, dass Mohammeds Nachfolger Abu Bakr den Sekretär Mohammeds, Zaid ibn Thabit, beauftragte, die Offenbarungen aufzuschreiben. Zaid, so wird berichtet, schrieb sie von „Pergament, Schulterblättern, Palmblättern und aus den Herzen von Menschen ab“.
Anderen Berichten zufolge kommt nicht Abu Bakr als erstem Kalifen die Ehre zu, den Koran gesammelt zu haben, sondern seinem Nachfolger Umar (634–644). Und auch der dritte Kalif, Uthman ibn Affan (644–656), wird genannt. Uthman erfuhr, dass die Kämpfer aus Syrien und dem Irak unterschiedliche Versionen der Offenbarungen kannten und sich darüber stritten. Daher beauftragte er vier Gelehrte, unter ihnen den schon genannten Zaid, eine einzige Version der Offenbarungen zu erstellen. Uthman ließ diese Standardversion kopieren und verbreiten und befahl, andere Sammlungen der Offenbarungen zu verbrennen.
Diese Geschichte könnte durchaus wahr sein, denn der älteste Koran, den wir kennen, das Manuskript von Sanaa (1972 in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa entdeckt), zeigt viele Ähnlichkeiten mit dem Koran, wie wir ihn jetzt kennen. Eigentlich enthält dieses Manuskript zwei Versionen (der Hälfte) des Korans. Die älteste Version wurde irgendwann abgewaschen und darüber eine neue Version geschrieben. Doch die alte, untere Schicht ist noch erkennbar. Die „neue“ entspricht weitgehend dem Koran „von heute“ und die alte, darunterliegende Version zeigt ein paar Dutzend nicht wirklich bedeutende Unterschiede im Vergleich zur neuen; es geht um Details. Die ältere, C14-datierte Version ist auf eine Entstehungszeit vor 670 bestimmt worden. Das Koranmanuskript von Sanaa zeigt also, dass alle Spekulationen über eine späte oder langsame Entstehung des Korans hinfällig sind. Der Text stand folglich nach 650 mehr oder weniger fest. Somit war der Koran, den Johannes von Damaskus achtzig Jahre später vor sich hatte, höchstwahrscheinlich derselbe wie „unser“ Koran.
Johannes eröffnet seine Kritik am Koran mit den Worten:
„Er sagt, Gott sei ein einziger, der Schöpfer aller Dinge; er sei weder selbst gezeugt noch habe er gezeugt. Er sagt [ferner], Christus sei das Wort Gottes und Geist von ihm, geschaffen und ein Diener [Gottes], und daß er von Maria, der Schwester von Mose und Aaron, ohne Samen geboren worden sei.“
Mit diesem Passus will Johannes zeigen, dass der Prophet völlig verwirrt gewesen sein muss und seiner Ansicht nach nichts von Theologie versteht. Dabei fällt auf, dass Johannes den Inhalt des Korans sehr genau gekannt haben muss. Er gibt exakt die Verse an, die die Muslime in Schwierigkeiten bringen können. Die kuriose Bemerkung, Maria sei die Schwester von Moses gewesen, findet sich tatsächlich im Koran: Sure 19, Vers 28. Angesichts eines derartigen, von Dummheit zeugenden Irrtums zeige sich, dass diese Schrift niemals von Gott kommen kann. Johannes bringt eine weitere bemerkenswerte Auffassung „Mameds“. Und er sagt, „daß die Juden frevelten und ihn kreuzigen wollten, daß sie [aber nur] ein Schattenbild von ihm zu fassen bekamen und kreuzigten; Christus selbst aber, so sagt er, wurde nicht gekreuzigt, ja er starb [überhaupt] nicht.“
Auch diese für einen Christen geradezu unsinnige Mitteilung findet sich tatsächlich im Koran (Sure 4, Vers 157). Danach spricht Johannes von „vielen anderen lächerlichen Dingen“ in der Offenbarung dieses sogenannten Propheten und fügt höhnisch hinzu: „Er behauptet hartnäckig, daß sie [die Schrift] von Gott auf ihn herabgekommen sei.“ Außerdem kennt er noch eine boshafte Klatschgeschichte über Mohammed:
„Dieser Muḥammad [nun] hat sich, wie erwähnt, viele absurde Geschichten zusammengefaselt und jeder von ihnen einen Namen gegeben. Z.B. die Sure ‚Die Frau‘. Darin setzt er fest, daß man sich vier reguläre Frauen nehmen darf und [dazu] Nebenfrauen, wenn man kann, tausend, soviele man eben neben den [regulären] Frauen als Untergebene unter seiner Tutel halten kann. Wenn man aber eine entlassen will, [so kann man das] nach Belieben [tun] und sich eine andere nehmen.“
Der Koran enthält eine Sure mit dem Titel Die Frauen (an-nisāʾ, Sure 4). Der Titel bezieht sich auf den dritten Vers, in dem es um die korrekte Behandlung von Waisenkindern geht. Wenn eine Waise unter den Schutz eines Mannes gestellt wird, ist es vernünftiger, sie zu heiraten, sagt Gott: „Ein oder zwei oder drei oder vier.“ Wenn ein Mann seinen Frauen nicht gerecht werden kann, soll er nicht heiraten, sondern seine Bedürfnisse bei seinen Sklavinnen befriedigen. Johannes’ Bemerkung, dass ein Mann „eine Frau nach Belieben wegtun“ kann, verweist auf den arabischen Brauch, dass ein Mann eine Frau wegschicken kann, indem er dreimal den sogenannten Talaq ausspricht. Johannes benutzt diese in seinen Augen schändliche Praxis als Auftakt zu einer unterhaltsamen Anekdote. Diese Regel habe Mohammed aus folgendem Grund aufgestellt: „Muḥammad hatte einen Mitstreiter namens Zaid. Dieser hatte eine schöne Frau, in die Muḥammad sich verliebt hatte.“ Zaid habe Mohammed seine Frau angeblich freiwillig überlassen – und Gott habe ihre Ehe gutgeheißen. Das glaubte Johannes natürlich nicht. Die ganze Affäre hatte einen üblen Beigeschmack – Mohammed hatte sich Zaids Frau einfach genommen, meint Johannes.
Danach schreibt er: „In derselben Sure verkündet er folgendes: ‚Bestelle das Saatfeld, das Gott dir gegeben hat, und bearbeite es mit Eifer, und tue dies und auf diese Weise‘ – um nicht, wie jener, alles Obszöne zu erwähnen.“ Damit verweist er zweifellos auf folgenden Vers:
„Eure Frauen sind für euch ein Saatfeld. So geht zu eurem Saatfeld, wann ihr wollt! Schickt etwas für euch voraus.“
(Sure 2,223)
Aber das steht, wie wir sahen, nicht in Sure 4, sondern in Sure 2. Es folgen weitere höchst bedenkliche Behauptungen. „Ferner [gibt es] eine Sure ‚Das Kamel Gottes‘, über das es heißt: ‚Es war [einmal] eine Kamelstute von Gott her, die einen ganzen Fluss austrank […]‘“. Der Koran kennt weder eine Sure mit diesem Titel, noch findet sich eine solche Geschichte darin. Weiter berichtet Johannes von einer Sure „Der Tisch“, in der stehen soll, dass Jesus Gott um einen (gedeckten) Tisch gebeten habe. Gott soll dann zu Christus gesagt haben: „Ich habe dir und den Deinen einen unvergänglichen Tisch gegeben.“ Sure 5 trägt den Titel almāʾida („Der Tisch“, was bedeutet: das, was es zu essen gibt; Araber kennen keinen Tisch, von dem man isst), und Vers 114 dieser Sure berichtet, Gott habe für Jesus und seine Jünger einen „Tisch“ aus dem Himmel herabgesandt. Aber die Bemerkung Gottes vom „unvergänglichen Tisch“ ist dort nicht zu finden.
Kurz, Johannes’ Angriff ist faszinierend, doch merkt man, dass er beim Verfassen der Pege gnoseos kein Exemplar des Korans zur Hand hatte. Er zitiert keine Koranstelle exakt (außer der einen, die auch am Felsendom steht). Er musste sich auf sein Gedächtnis verlassen. Die Folge war, dass er sich hier und da täuscht. Dennoch muss Johannes den Koran gründlich studiert haben. So gründlich, dass er genau die Verse findet, in denen der Prophet (in seinen Augen) Irrtümern erliegt. Johannes’Angriff war einzigartig, beispiellos. Er war sichtlich aufgebracht und auch verbittert. Für ihn war die Zeit des Schweigens und Duldens vorbei. Die Pege gnoseos sollte fortan den Ton bestimmen, in dem die Debatte in den folgenden Jahrhunderten und bis heute geführt wurde. Die Gleichsetzung Marias mit Mirjam, der Schwester Mose, die eigenartige Bemerkung über die Kreuzigung, der Umgang mit Sklavinnen, die Geschichte mit Zaids Frau – das sind Kritikpunkte, mit denen sich auch die moderne Islamkritik gern beschäftigt.
Wie hatte es dazu kommen können? Was für ein Glaube war das, der das christlich-byzantinische Kaiserreich so tief gedemütigt hat und wagte, das Christentum herauszufordern? Was für eine Offenbarung war das? Und wer war überhaupt dieser Mohammed? Diese Fragen werden in diesem Buch gestellt werden. Um sie zu beantworten, müssen wir weit in der Zeit zurückgehen bis in das verhängnisvolle Jahr 602.