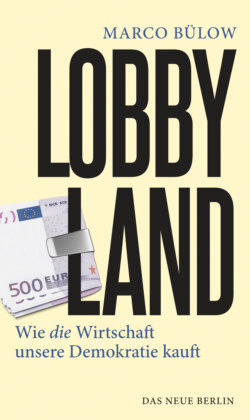Читать книгу Lobbyland - Marco Bülow - Страница 11
ОглавлениеProlog: Spielregeln
»Monopoly, Monopoly, wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel …«
Klaus Lage
ReichsTag
»DEM DEUTSCHEN VOLKE« – steht auf einer Länge von 16 Metern in großen Lettern über dem Hauptportal des Reichstagsgebäudes. Schon 1916 wurde diese Inschrift von der Berliner Bronzegießerei S.A. Loevy, einem jüdischen Familienunternehmen, hergestellt und angebracht. Seit 1999 krönt den Bundestag eine große gläserne Kuppel. 3000 Quadratmeter Glas, als Symbol für Transparenz und Offenheit. In der Kuppel stehend blickt die Bevölkerung ihren Abgeordneten symbolisch über die Schulter. Es gibt ein Gefühl von Nähe und Kontrolle. Direkt gegenüber: das Kanzleramt und drum herum ein Bienenschwarm von Menschen. Die Politik ist mittendrin.
Eine Illusion. Viel Fassade und viel Schein. Es ist eine Glocke, eine abgeschottete Welt. Die Bevölkerung ist nur zu Besuch, so wie man eine entfernte Verwandte mal zum Kaffee einlädt. Der Widerspruch zwischen Darstellung und Handlung in der herrschenden Politik wächst. Einige ihrer Regeln und Strukturen sind so absurd, dass es mich überrascht, wie der Schein der Normalität überhaupt so lange gewahrt werden konnte.
Risse in der Fassade gibt es. Einige Initiativen, einzelne Politikerinnen und Journalistinnen blicken immer wieder hinter die Kulissen und decken wahre Zustände auf. Aber ernsthafte Argumente und Kritik beeindrucken unter der Kuppel fast niemanden. Die Interessen der zukünftigen Generationen und der weniger privilegierten Menschen spielen hier im hohen Haus und in den Ministerien eine immer unwichtigere Rolle.
Können Satire, zugespitzte Darstellung, gnadenlose Aufklärung und vor allem Öffentlichkeit im Zusammenspiel die Fassade einreißen und das Fundament freilegen?
P-Day
Vor genau dieser Fassade stehe ich an einem grauen Novembertag, mit einem Megafon bewaffnet. Berlin, Ende 2020. Es ist P-Day. Die Treppen führen zum Haupteingang, über sie hinweg blicke ich ganz bewusst zur Kuppel und der 16-Meter-Bronzeinschrift. Ich habe Verstärkung mitgebracht. Es nieselt, aber niemand hält uns davon ab, eine kurze, bunte Einlage zu zelebrieren. Vielleicht einen weiteren Riss in die Fassade zu ritzen. Ich trage ein Shirt über meiner dicken Jacke. Darauf prangt: Für den Bundestag reicht’s. Darunter steht: Die PARTEI. Was? Warum ausgerechnet dieser Verein? Es ist kein Neustart, aber in einem neuen Team. Zugespitzt in der gemeinsamen Aktion zum Fassadenabriss. Die Bagger sind bestellt. Doch um die milliardenschweren Stützpfeiler der politischen Eliten und Profitlobby einzureißen, brauchen wir neben Gerät und Erkenntnis sehr viel Power.
Ich spule kurz noch mal zurück. Warum bekommt das politische System es nicht hin? Und kann man die Parteien nicht einfach erneuern? Was ist passiert, wie sieht es hinter der Fassade wirklich aus? Und wie müsste ein Neubau aussehen, von wem sollte er errichtet werden?
Es geht dabei nicht um mich, ich bin eher ein Verkehrsmittel, sagen wir das Rad, welches durch diese Geschichte fährt. Meine ungewöhnliche Tour hat mich eine längere Zeit mitten durch die politischen Machtzentren geführt. Meine hier geteilten Erfahrungen sollen einen offenen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Eigentlich sollte es diese Einsicht in vielen Facetten und vielfältig geben. Tatsache ist aber, dass sich quer durch die Parteien fast alle einig sind, nur das nach außen zu tragen, was man auch gern vermitteln möchte.
Da ist er wieder, der Schein. Alles andere darf die Berliner Glocke nicht verlassen. Jede, die dagegen verstößt, ist eine Nestbeschmutzerin und muss das Nest verlassen. Dabei sollte der Bundestag der transparenteste Ort der ganzen Republik sein und nicht nur eine gläserne Kuppel haben. Wir sind kein Unternehmen, keine Familie, wo wir uns auch mal schützen müssen. Wir werden von der Bevölkerung gewählt und dafür bezahlt, dass wir sie vertreten. Deshalb möchte ich auch mit neuem Team, weiter »multiparteiisch« sein, übergreifend arbeiten, ohne die Scheuklappen der Parteitaktik. Denn: Die Bevölkerung ist die Chefin – nicht eine Partei- oder Fraktionsvorsitzende oder gar die Kanzlerin oder die Konzernchefin.
BundesTag
Im September 2002 werde ich von 57,8 Prozent der Wähler in meinem Dortmunder Wahlkreis direkt in den Bundestag gewählt. Da stehe ich zum ersten Mal nicht nur vor, sondern auch im hohen Haus. Schon mit Hochachtung. Gerade 30 Jahre alt geworden, bin ich einer der jüngsten Abgeordneten überhaupt, vor allem unter denen, die ihr Mandat direkt gewonnen haben. Ich bin zu sehr von mir überzeugt, denke, ich kann die Welt nun aus den Angeln heben. Rot-Grün hat eine Mehrheit, und ich gehöre der Regierungspartei an.
Ich bin in einem Brennpunktstadtteil auf eine Dortmunder Gesamtschule gegangen, habe so einiges mitbekommen vom Leben, auch fernab der Sonnenseite. Die meisten meiner späteren Kolleginnen, selbst die der SPD, werden wohlbehütet als Akademikerkinder groß.
Dagegen habe ich eine für das Ruhrgebiet typische Biografie. Mein Großvater hat unter Tage und dann als Stahlarbeiter gearbeitet, meine Eltern waren in der Pflege tätig. Ich bin derjenige, der von den Bildungsreformen und erpressten sozialen Zugeständnissen der siebziger und noch achtziger Jahre profitiert hat. So konnte ich mein Abi machen, durfte sogar studieren, auch wenn ich immer gejobbt habe. Über die Uni kam ich zu den Jusos und dann auch zur SPD. Unmöglich eigentlich, so jung in einem Wahlkreis aufgestellt zu werden, vor allem in einem, der für die Partei als einer der sichersten galt. Zufälle, eine große Parteireform vor Ort, die Sehnsucht der Basis, mal was Neues auszuprobieren, und meine Leidenschaft haben mir wohl die Chance ermöglicht.
Nach 18 Jahren im Bundestag habe ich zwar noch immer Respekt vor der Aufgabe, aber verliere immer mehr die Achtung vor den Abläufen, den selbstgegebenen Regeln, den bestimmenden Personen. Dabei fängt es so gut an. Ich sitze neben Vorbildern wie Hermann Scheer und Ernst Ulrich von Weizsäcker, deren Bücher und Reden ich als Jugendlicher gelesen und gehört, deren Inhalte ich gepredigt hatte. Ich komme in den Umweltausschuss, werde Berichterstatter für erneuerbare Energien und für Energieeffizienz sowie Co-Berichterstatter für Klimaschutz. Genau das, was ich machen wollte.
Ich stürze mich in die Arbeit und werde gleich zugebombt von Terminen mit Lobbyistinnen. Schnell merke ich, wie wenig Zeit mir bleibt, inhaltlich die Themen zu überblicken. Noch weniger wird es möglich, alle anderen Politikfelder und die zu treffenden Entscheidungen zu überblicken. Der erste gut Rat ist da natürlich hilfreich: Halte dich an die Fraktion und die Regierung, folge ihnen einfach. Ergibt Sinn, wir teilen unter uns 249 SPD-Abgeordneten die Themen auf, und alles läuft in der Fraktion zusammen. Oder in der Regierung?
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sind mir nicht nur wegen meiner Herkunft wichtig, aber ein Experte bin ich nicht. Ich versuche auch da, stärker beteiligt zu werden. Rot-Grün, Schröder und Fischer haben die Agendapolitik auf die Schiene gesetzt. Das Motto der berüchtigten Hartz-Kommission, Fördern und Fordern, hört sich erst einmal gut an, aber selbst als Nichtexperte erkenne ich die Einseitigkeit der Reform, die nun über Jahrzehnte die Gemüter spaltet und den Ruf der SPD zu Recht ramponiert hat. Spannend übrigens ist, dass Fischer und die Grünen damit auch im Nachhinein angeblich nichts zu tun hatten.
Was heute keiner mehr weiß und auch damals kaum eine Rolle spielte, diese Expertinnenkommission ist vollständig mit externen, angeblichen Expertinnen besetzt. Niemand aus dem Bundestag, niemand aus der Regierung nimmt daran teil. Die einzige Ausnahme bildet der damalige NRW-Minister Harald Schartau. Von Beginn an gilt: Was da verhandelt wird, wird eins zu eins umgesetzt. Das Paket irgendwo aufschnüren, verändern, geht nicht. Dann würde ja alles zusammenbrechen.
Ich staune. Ok, inhaltlich lässt sich ja streiten, und vielleicht habe ich nicht genug Ahnung, auch wenn sich bei mir alles verkrampft. Aber hier sollen nicht gewählte, sondern von einer Person benannte Menschen sehr weitreichende Entscheidungen treffen, die wir nicht mehr zu verändern haben. Ich muss nicht erwähnen, dass es in der Kommission natürlich absolut keine Ausgewogenheit der Experten gab.
Viele sind voller Bewunderung für diesen Coup von Schröder und seiner Regierung. Die große Mehrheit in der Fraktion nimmt diese Vorgabe, ohne etwas zu verändern, einfach so hin. Fast niemand kritisiert das Vorgehen, nicht einmal die Opposition. Auch in den allermeisten Medien findet sich keine Kritik.
Schröder führt damit eine Welle von selbsternannten Expertengremien und -runden ein. Ein sehr effizientes Mittel, gewählte Parlamente auszuschalten. Und da die Mehrheiten knapp sind, geht es bei Schröder mit der Drohung los, alles platzen zu lassen, wenn wir Abgeordnete nicht folgen. Damit wäre Rot-Grün am Ende, alle Möglichkeiten zu gestalten dahin. Es gäbe keine Energiewende und die Sozialpolitik dann wieder von Union und FDP.
Ich lerne also: Eine Person kann nach eigenen Vorstellungen Leute berufen, die ihr genehm sind, die alles vorgeben, was dann von einer Mehrheit im Bundestag abgenickt wird. Und wenn es knapp werden sollte, dann setzt man die Abweichler unter Druck oder droht, sie nicht mehr zu beteiligen. Am Ende hat man seinen Beschluss ohne die kleinste Veränderung und bekommt Bewunderung dafür, wie man die Volksvertretung einfach mal so eben ausgeschaltet hat. Das ist dann eine lupenreine Demokratie …
Das Spiel und seine Regeln
Magengrummeln und geballte Fäuste – mit Rede und Stimme in der Fraktion bin ich gegen diese Art der Politik. Aber nach außen hin bin ich folgsam. Intern versuche ich mich dagegen zu vernetzen, neue Strukturen aufzubauen, wie etwa die Denkfabrik – ein ehemaliger Zusammenschluss vorwiegend junger progressiver SPD-Abgeordneter –, die später dann die ersten rot-rot-grünen Gespräche koordiniert. Was ich in meiner ersten Zeit hier erlebe, ist für mich mehr als ein Riss in meiner Vorstellung von Demokratie.
Ich führe ein intensives Gespräch mit einer älteren Kollegin, die ich schon einige Male als Neuling um Rat gefragt habe. Sie versteht meinen inhaltlichen Unmut. Bezüglich der Vorgehensweise schränkt sie allerdings ein, dass Schröder es schon sehr schlau angestellt habe. Natürlich dürfe man das eigentlich so nicht machen. Ich stolpere gleich über das »eigentlich«. Aber so sei Politik, und dann wird sie ganz ernst und sagt eindringlich: »Marco, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst, aber einen ganz wichtigen Rat und meine Erkenntnis nach mehreren Legislaturperioden gebe ich dir jetzt mit: So läuft das Spiel hier. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst die Spielregeln, dann hast du vielleicht irgendwann mal die Chance, weiter oben mitzuspielen und kannst vielleicht die ein oder andere Position durchbringen. Oder du akzeptierst sie nicht, dann musst du das Spielfeld bald wieder verlassen.«
Diese Aussage widerstrebt mir. Sie passt so gar nicht zu meinem Anspruch und meiner Vorstellung von Demokratie. Aber mir dämmert, wie Politik hinter den schönen Reden, der öffentlichen Show und der Fassade, jenseits der Theorie gerade wirklich funktioniert. Diese Sätze prägen sich wie ein Stempel in mein Hirn. Erst versuche ich es mit Ironie zu nehmen, aber mein Trotz und Unbehagen sind zu groß und wachsen mit meinen weiteren Erfahrungen.
Nein, es gibt eine dritte Möglichkeit. Die Spielregeln sind unfair und undemokratisch. Einige bestimmen viel, die anderen nicken ab und verkaufen es nach außen. Die Parteien werden zu Wahlvereinen. Nur wer lange genug mitspielt und sich in den kleineren Spielen am Rande mit Vitamin B gegen Konkurrentinnen durchsetzt, kommt ans größere Spielbrett. Und die Schlossallee und die Parkstraße voll mit Hotels gehören sowieso Spielerinnen, die sich keiner Wahl aussetzen müssen und nicht abgewählt werden können. Die Bevölkerung ist eine Spielfigur ohne besonders große Relevanz. Lobbykontakte und elitäre Netzwerke sind spielentscheidende Player. Monopoly ist dagegen ein extrem gerechtes und demokratisches Spiel.
Da werde ich weder so mitspielen noch das Spielfeld verlassen. Die Regeln müssen geändert werden! Natürlich ist mir klar, dass dies leichter gesagt als getan ist. Aber es wird meine Losung, mein Auftrag. Auch deshalb, weil ich immer mehr zu spüren bekomme, wie Argumente und Überzeugungskraft zwar nice to have sind, aber wenig ausrichten im politischen Spiel. Wenn du also wirklich was verändern willst, musst du die Strukturen aufbrechen, das politische System vom Kopf auf die Füße stellen.
Wendepunkt
Das will ich heute immer noch, ausgerüstet mit Erfahrungen, Enttäuschungen, Frustrationen, aber auch immer wieder mit Hoffnung. Mein Antrieb war schon immer der Ärger über die ungleichen Verhältnisse, über die Zerstörung der Lebensgrundlagen, aber vor allem über Ungerechtigkeit. Wenn ich einigermaßen zufrieden wäre mit den Verhältnissen und der Politik, dann hätte ich längst aufgehört oder gar nicht erst damit begonnen – gibt es doch so viele spannende und schöne Dinge auf der Welt.
Als ich Ende 2018 nach 26 Jahren die SPD verlasse, ist für mich klar, das war es mit der Profipolitik. Ich will kein Netz und keinen doppelten Boden. Ich bin überzeugt davon, dass meine SPD-Basis mich wieder aufgestellt und ich den Wahlkreis noch mal gewonnen hätte, auch weil meine Erststimmenergebnisse deutlich über den Zweitstimmenergebnissen der Partei lagen. Oder ich hätte die Chance gehabt, zu wechseln und bei einer anderen Partei unterzukommen, die in Zukunft wieder im Bundestag – höchstwahrscheinlich auch mit mir – vertreten sein würde. Stattdessen war ich drauf und dran, das große Spielfeld zu verlassen, auch wenn ich mich sicher weiter engagieren würde.
Doch dann passiert einiges. Ich bekomme mehr Rückmeldungen, Anfragen, Post als zuvor. Ich spüre mehr Offenheit, mehr Nähe von vielen Initiativen, Gruppen, Bürgerinnen, die den Glauben in die etablierten Parteien und in das jetzige System verloren haben. Sie kommen jetzt vermehrt auf mich zu. Und dies auf allen Ebenen. Es ist nun viel leichter, Kontakte zu knüpfen. Immer mehr sagen mir auch, dass sie mich wieder wählen würden, auch ohne SPD – oder gerade ohne SPD. Die Klimaproteste nehmen immer mehr Fahrt auf. Insgesamt bewegt sich was in Deutschland 2019, auch auf der Straße, als allein an einem Tag im September über eine Millionen Menschen zum Klimastreik zusammenkommen.
Ich bin raus aus der Mühle, aus dem Laufrad. Keine Profitlobby, keine Taktikgespräche, keine Bauchschmerzen bei so vielen Entscheidungen. Meine Arbeit wird spannender, vielfältiger. Gerade die vielen sich politisierenden und zu Wort meldenden jungen Menschen machen Mut. Aber ich spüre auch den aufkommenden Frust, weil Millionen Menschen auf der Straße zwar die Umfragen bezüglich der Klimafrage beeinflussen, aber längst nicht die Entscheidungen, die weiter zu Gunsten der Klimaschmutzlobby getroffen werden.
Für mich ist klarer denn je: Es wird sich nichts oder zu wenig verändern, wenn sich die Spielregeln nicht ändern. Die aktuellen Krisen sind zu groß. Steigende soziale Ungleichheit, das riesige Artensterben und die Klimakrise. Dazu Pandemien, die gerade wegen unserer Lebensweise immer häufiger auftreten werden. Schon allein Covid-19 zeigt uns doch unsere Grenzen auf. Vor allem bei Krisen, die sich langsam steigern, versagt unser politisches System.
Meine Hauptthese ist deshalb: Wenn wir die Spielregeln nicht ändern, die Demokratie nicht wirklich erneuern, lösen wir die Krisen nicht, sondern verschärfen sie. Es wurde ein Lobbyland geschaffen, welches die Interessen einer immer kleineren Elite bedient und ohnmächtig ist gegenüber den wirklichen Gefahren. Vor allem dann, wenn Handeln bedeutet, dass auch die wirklich Wohlhabenden und Mächtigen davon beeinflusst werden. Die jetzige Politik orientiert sich an der Vergangenheit, nicht an der Zukunft, und ist die Umkehrung von for the many, not the few.
Das Wort »Krise« leitet sich vom griechischen Wort krísis ab und bezeichnet nicht nur eine bedenkliche Lage. Was viele nicht wissen, es bedeutet auch »Wendepunkt«. An genau so einem Wendepunkt stehen wir. Beugen wir uns den Risiken oder nutzen wir die Chance, wenden wir das Blatt?
Viele aufmunternde Reden und Schriften würden an dieser Stelle ergänzen, es liege nur an uns, und es sei nicht schwer, wenn man nur wolle. Doch es ist schwer. Und es ist weder mit einigen tollen neuen Technologien getan noch mit einem zartgrünen oder blassroten Anstrich, noch mit dem Engagement einer ganzen Generation, welches sich dann irgendwann in den Parteien niederschlägt und dort auch weitestgehend verebbt. Nein, das ganze verkrustete, lobbyierte politische System muss gesprengt werden, damit wirklich gehandelt werden kann. Man muss sich mit den wirklichen Mächtigen anlegen. Und nein, es geht nicht, ohne jemandem weh zu tun, ohne dass jemand verliert. Kein Update oder eine kleine Reform der Demokratie reicht dafür aus, wie zum Beispiel ein Lobbyregister, ein wenig Bürgerbeteiligung, etwas modernere Parteien … Die Fassaden müssen eingerissen und die Demokratie einschließlich des Wirtschaftssystems demokratisiert werden. Sie gehört auch den nächsten Generationen. Freiheit und Sicherheit bewahren wir für unsere Kinder nur, wenn wir ihre Lebensgrundlagen nicht einschränken oder gar zerstören.
Wie sieht es hinter der politischen Fassade wirklich aus? Wie dämmen wir den Profitlobbyismus ein? Wie schaffen wir wieder mehr Teilhabe? Wie befreien wir uns davon, dass wir hauptsächlich zu Arbeitskräften, Konsumentinnen und Teilzeitwählerinnen degradiert wurden? Wie verändern, revolutionieren wir unsere Demokratie – damit wir die wirklichen Krisen bewältigen können? Darum soll es in diesem Buch gehen.