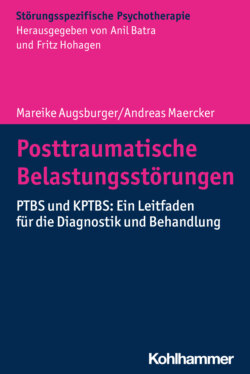Читать книгу Posttraumatische Belastungsstörungen - Mareike Augsburger - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2 Die komplexe PTBS (KPTBS)
Fallbeispiel
Ein 45-jähriger Patient ist mit 21 Jahren in der ehemaligen DDR aus politischen Gründen inhaftiert worden und war 6 Jahre lang im Gefängnis. Er berichtet:
»Ich bin nicht mehr so, ich bin anders geworden. Ich versuche, vieles nicht mehr an mich herankommen zu lassen. […]. Aber wenn was rankommt, überreagiere ich, aggressiv z.T. und intoleranter dadurch. […]. Ich habe Probleme mit allem, was so irgendwie an Zwangsmechanismen erinnert. Entweder erstarrt man davor und wagt nicht, sich zu rühren oder man begehrt dagegen auf und nimmt das absolut nicht ernst. Die Zwischenform, das, was angemessen wäre, das fehlt bei mir. Und das wirkt sich natürlich am Arbeitsplatz aus. Ich bin mehr arbeitslos, als dass ich einen Job habe, weil ich die Hierarchien nicht verinnerlichen kann. Da schaffe ich es irgendwie nicht, die angemessene Reaktion zu finden … Und wenn ich dann wieder sehe, dass die [ehemaligen Täter] es gut haben, das verursacht bei mir so ein massives Bauchgrimmen, dann bin ich 2, 3 Tage nicht ansprechbar, weil ich den Eindruck habe, die haben plötzlich wieder den Sieg. […]. Man muss doch die Leute auch mal ein bisschen foltern … So lange, wie ich lebe, werde ich alles hassen, was mit denen zu tun hat. […]. Meiner Frau gegenüber bin ich im Nichtverstehen manchmal sehr böse gekommen, sehr sehr böse […]. Man hatte die Opfermentalität, man hat einfach von der Umwelt erwartet, dass man verstanden wird. Aber das war ja nicht vorhanden, da gab es so eine Mauer des Schweigens, eine Mitschuld des Schweigens. Da hat man sich weiter eingeigelt […].«
(Fallbeispiel aus Hecker und Maercker 2015, S. 553)
2.1 Entstehung und klinisches Bild
Anfang der 1990er Jahre schlug die amerikanische Psychiaterin Herman erstmalig die Diagnose der komplexen PTBS vor. Sie hatte festgestellt, dass Betroffene von sich wiederholenden oder langanhaltenden von Menschen verursachten Traumata (z. B. jahrelanger Missbrauch in der Kindheit, allgemein Typ-II-Traumata) ein viel komplexeres Muster an Problemen aufwiesen, die durch die Diagnose der klassischen PTBS nicht hinreichend erklärt werden konnten (Herman 1992). Nach Hermans Vorschlag wurde die KPTBS als Diagnose in der Fachliteratur kontrovers diskutiert. Im aktuell gültigen DSM-5 entschied man sich gegen die Aufnahme einer eigenständigen Diagnose. In der ICD-10 gab es bereits eine Vorgängerdiagnose (F62.0 Anhaltende Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastungen), die aber keine PTBS-Symptomatik erforderte. In der klinischen Praxis wurde sie aufgrund ihrer Zuordnung zu den Persönlichkeitsstörungen häufig als wenig nützlich wahrgenommen und in der ICD-11 entsprechend angepasst.
Betroffene mit komplexer Symptomatik zeigen Probleme in der Emotionsregulation, gesteigerte Impulsivität und Stimmungsschwankungen (z. B. Hoffnungslosigkeit und starke Verzweiflung). Auch die Selbstwahrnehmung verändert sich (z. B. tiefer Selbsthass, selbstverletzendes Verhalten, mangelnde Selbstfürsorge, Suizidalität) «, ebenso wie die Beziehungsfähigkeit zu anderen (dysfunktionale Beziehungsmuster, starkes Misstrauen, häufige Beziehungsbrüche). Häufig haben Betroffene eine verzerrte Wahrnehmung des Täters oder der Täterin, die in einer paradoxen Idealisierung, aber auch in starken Rachegefühlen münden kann. Zusätzlich treten Störungen des Bewusstseins auf mit dissoziativen Episoden und/oder Depersonalisierung (Hecker und Maercker 2015; Herman 1992; van der Kolk et al. 2005).
2.2 KPTBS nach ICD-11
Eine KPTBS als »Geschwisterdiagnose« der PTBS kann diagnostiziert werden, wenn folgende Kriterien erfüllt sind (Augsburger und Maercker 2018a; Maercker und Augsburger 2017):
Das traumatische Ereignis
Die Grunddefinition eines traumatischen Ereignisses baut auf dem traumatischen Ereignis der PTBS auf. Es ist ergänzt um den Aspekt der Dauer (langanhaltend oder wiederholt) und der Unmöglichkeit, dem Ereignis zu entkommen. Als Beispiele werden Folter, Sklaverei, Genozid-Kampagnen, häusliche Gewalt sowie sexueller Missbrauch und Misshandlungen in der Kindheit genannt.
Die drei Kernsymptomgruppen der PTBS
Damit eine KPTBS diagnostiziert werden kann, müssen die drei Kernsymptomgruppen der PTBS (Wiedererleben, Vermeidung, Wahrnehmung einer gegenwärtigen Bedrohung) in klinisch signifikantem Ausmaß vorhanden sein.
Abb. 2.1: Konzeptualisierung der KPTBS
Zusatzsymptome spezifisch für die KPTBS
Wie aus Abbildung 2.1 ersichtlich ( Abb. 2.1), müssen bei der KPTBS Einschränkungen in drei weiteren Bereichen vorhanden sein: (1) anhaltende und schwere Probleme mit der Affektregulation, (2) persistente Überzeugung, »wertlos«, gescheitert oder schlecht zu sein, (3) anhaltende Schwierigkeiten, Beziehungen aufrechtzuerhalten und sich anderen Personen nah zu fühlen.
Beeinträchtigung
Auch bei der KPTBS muss die Symptomschwere ein Ausmaß annehmen, dass eine signifikante funktionelle Beeinträchtigung in wichtigen Lebensbereichen vorliegt, ähnlich der Formulierung bei der PTBS.
Dieser neue Diagnoseschlüssel erlaubt es, Patienten und Patientinnen mit einem tiefgreifenden Störungsbild adäquat zu beschreiben und einer geeigneten Behandlung zukommen zu lassen, ohne sie mit dem Stigma einer Persönlichkeitsstörung zu belegen.
2.3 Validität und Nutzen der neuen Diagnose
Mittlerweile liegen mehrere Studien vor, die die Validität der neuen Diagnose nach ICD-11 stützen, wie eine aktuelle Übersichtsarbeit zeigt (Brewin et al. 2017). Auch die Konzeptualisierung der KPTBS als Erweiterung der PTBS-Kernsymptome um Zusatzsymptome ist empirisch gestützt (Brewin et al. 2017; Hyland et al. 2017b).
Eine KPTBS tritt häufiger als eine PTBS nach traumatischen Erfahrungen in der Kindheit auf und ist mit stärkeren Beeinträchtigungen assoziiert (Brewin et al. 2017). Doch auch im Erwachsenalter ist die Entwicklung einer PTBS nach sehr schweren traumatischen Erlebnissen möglich. Dies wurde in einer Studie mit Überlebenden in Kriegs- und Konfliktregionen gezeigt (De Jong et al. 2005). Zusammenfassend zeigt die Forschung, dass es sich bei der KPTBS um eine klinisch nützliche und valide Diagnose handelt. Mit der Aufnahme in das ICD-11 wird berücksichtigt, dass komplex Traumatisierte einen höheren therapeutischen Aufwand nach sich ziehen.
2.4 Exkurs: Vergleich der Klassifikationssysteme
Die beiden aktuell gültigen Klassifikationssysteme unterscheiden sich deutlich in der Konzeptualisierung von PTBS bzw. KPTBS. Im DSM-5 ist nicht nur die Anzahl der jeweils benötigten Kriterien genau spezifiziert, sondern es wird auch neben den drei Grundsymptomgruppen eine Anzahl von nötigen Zusatzsymptomen benannt. Im Gegensatz dazu verfolgt die ICD-11 einen anderen Ansatz: Mit dem Ziel der maximalen klinischen Nützlichkeit fokussiert sich die Konzeptualisierung des Störungsbilds auf die drei wesentlichen Kernsymptomgruppen. Alle potentiell mit anderen Störungsbildern überlappenden Symptome wurden aus der Kategorisierung gestrichen. Tabelle 2.1 stellt die unterschiedlichen Definitionen der PTBS im direkten Vergleich gegenüber ( Tab. 2.1).
Tab. 2.1: Gegenüberstellung der Kriterien für die PTBS nach den beiden Klassifikationssystemen (APA 2015; WHO 2018)
DSM-5ICD-11
Anmerkung: Obwohl nicht explizit genannt, wird der Ausschluss medizinischer Ursachen auch in der ICD-11 implizit vorausgesetzt.
Dies hat zur Folge, dass je nach Klassifikationssystem unterschiedliche Personengruppen mit einer PTBS diagnostiziert werden können. Verschiedene Untersuchungen haben dies gezeigt (z. B. Barbano et al. 2018; Hyland et al. 2018; Wisco et al. 2017). Zu interessanten Ergebnissen kommt eine Studie, die Unterschiede in Prävalenzen in verschiedenen Stichproben untersucht hat: Während bei studentischen Teilnehmenden die Anwendung der ICD-11 Kriterien zu weniger Fällen führte im Vergleich zu DSM-5, ergab sich bei chronischen Schmerzpatienten und Schmerzpatientinnen sowie bei Militärangehörigen kein Unterschied (Hansen et al. 2017). Weitere Forschung und die klinische Praxis werden klären müssen, wie sich diese Widersprüche auflösen lassen.
Merke
Je nach Diagnosesystem könnten unterschiedliche Personengruppen mit einer PTBS klassifiziert werden. Da im deutschsprachigen Raum in der Praxis vorrangig ICD-Kriterien angewandt werden, wird dieses Problem vor allem im internationalen Vergleich relevant.