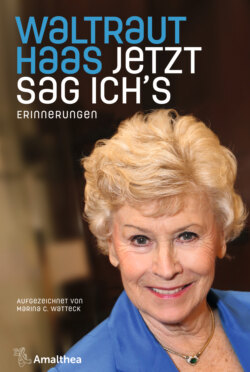Читать книгу Jetzt sag ich's - Marina C. Watteck - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSie hat mich ja schon zuvor zu fast allen Dreharbeiten begleitet, jetzt war es noch einfacher. Wir wohnten zwar beide noch eine Zeit lang im »Schönbrunner Stöckl«, das sie gemeinsam mit ihrem Bruder viele Jahre als Gasthaus geführt hatte. Sie arbeitete aber nicht mehr, und ich kaufte ein Grundstück am Küniglberg, wo ich 1958 ein Haus bauen ließ, in das wir 1960 eingezogen sind. Das war ihr Zuhause bis zu ihrem Tod im Jahr 1991. Ihre Liebe, ihr Vertrauen, ihr praktisches Denken und ihr künstlerisches Verständnis waren für mich ein ganz wichtiger Teil meines Lebens.
Schon als Kind hatte ich dramatische Ambitionen. Ich stand gern im Mittelpunkt, konnte gut andere Menschen nachmachen, und am liebsten habe ich mich verkleidet und bin spielerisch in andere Rollen geschlüpft. Gemeinsam mit meinem Bruder Fritz, der drei Jahre jünger und musikalisch sehr begabt war, habe ich sehr gern Kasperl-theater gespielt.
Mein Bruder war sehr geschäftstüchtig. Wir haben eine kleine Kassa gebaut, er hat sich als Old Shatterhand verkleidet, ich als Prinzessin, und für zehn Groschen pro Person haben wir den Kindern etwas vorgespielt. Meine Mutter ließ uns gewähren, für sie waren es Kindereien, die sie nicht ernst genommen hat. Erst als mir viele Jahre später der Theatervirus immer noch im Blut steckte, hat sie versucht, mich mit sanftem Druck in eine andere Richtung zu lenken. Sie hatte zwar Verständnis für meinen Wunsch, es waren aber so unsichere Zeiten, dass sie einfach Angst hatte, ich würde es zu nichts bringen. So wurde beschlossen, dass ich nach Abschluss der Hauptschule in die Haushaltungsschule gehen sollte, um etwas »Anständiges« zu lernen. Meine Mutter hatte ganz praktische Ansichten: »Fast jedes Mädchen möchte Schauspielerin werden. Lern was G’scheites, und wenn das mit dem Schauspiel nicht hinhaut, kannst du auf etwas zurückgreifen.«
Ich war eine gute, aber nicht sehr brave Schülerin, interessiert hat es mich überhaupt nicht. Es hat auch nicht unbedingt geholfen, dass meine Cousine mit mir in die gleiche Klasse ging, denn wir hatten nur Unsinn im Kopf, und mehr als ein Mal mussten wir Strafen für unsere Streiche ausfassen.
Ich wurde in eine unruhige Zeit geboren. Österreich war mitten in einer Wirtschaftskrise, es gab politische Unruhen und fast 300 000 Arbeitslose – ich habe davon aber nichts mitbekommen. Meine Eltern, Stefanie Klager (19. Dezember 1901–30. März 1991), aufgrund ihrer großen braunen Augen »Rehlein« genannt, und mein Vater Walther Haas haben einander beim Turnen kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Mein Vater war Volksschullehrer an der evangelischen Schule in der Gumpendorfer Straße und ein sehr gut aussehender Mann, meine Mutter war eine ebenso hübsche wie lebenslustige Hotelierstochter aus Meidling. Ihre Eltern – ihre Mutter Barbara und ihr Stiefvater Karl Graf – führten den »Meidlinger Hof« an der Ecke Meidlinger Hauptstraße und Hufelandgasse. Meine Mutter war die Älteste von sechs Geschwistern und hat daher immer fest anpacken müssen. Da ist nicht viel Zeit geblieben für Unsinn oder Dummheiten, wie es in der Familie geheißen hat, obwohl sie eine sehr talentierte Pianistin war und mit Leidenschaft diesen Beruf ausüben hätte können. Sie malte auch gern und hätte viel daraus machen können, doch all das kam nicht infrage. Künstlerberufe waren in der Familie meiner Mutter suspekt – meine Mutter musste sich fügen und arbeitete im elterlichen Betrieb anstatt im Konzertsaal.
Meine Disziplin, mein Pflichtbewusstsein und meine Ausdauer habe ich sicher von ihr geerbt. Sie hat es mir vorgelebt.
1932, ich war erst fünf und mein Bruder Fritz gerade zwei Jahre alt, starb mein Vater an akuter Urämie. Ich habe nur sehr wenige, aber äußerst liebevolle Erinnerungen an meinen Vater. Wir haben ihn beispielsweise oft gemeinsam mit der Mutter von der Stadtbahn abgeholt, und ich bin ihm in die Arme gelaufen. Ich erinnere mich ebenso daran, dass er mir manchmal mithilfe eines Kochlöffels Schneckerln in die Haare gedreht hat. Der Schock angesichts des Verlusts des Vaters war überwältigend. Ich spürte nicht nur meinen Schmerz, sondern auch den meiner Mutter, die nun völlig unversorgt mit zwei kleinen Kindern dastand. Ich weiß noch, wie ich mir zu Weihnachten nur meinen Vater zurückgewünscht habe. Das Christkind sollte ihn mir einfach auf unser Hausdach stellen, ich würde ihn dort schon abholen. Das Konzept Tod war für mich als Fünfjährige viel zu abstrakt, in meiner Welt würde das Wünschen helfen, dachte ich damals.
Meine Mutter verfiel in eine schwere Depression, aber dank meiner Großeltern, die uns liebevoll aufnahmen, konnte meine Mutter wieder Fuß fassen. Zuerst arbeitete sie im Hotel mit, dann kauften meine Großeltern ihr und ihrem Bruder, unserem Onkel Joschi, der Fleischhauer war, das Gasthaus »Schönbrunner Stöckl«, das direkt am Seitenzugang zum Schloss Schönbrunn lag, wo sie für die Küche und er für die Schank zuständig war.
Dass in einem solchen Beruf wenig Zeit für uns Kinder übrig blieb, war klar. Doch wir hatten unsere liebevollen Großeltern und den großen Schönbrunner Park, der unser Abenteuerspielplatz, Märchenwald und Kulisse war. Besonders hatte es uns der Schönbrunner Tierpark angetan – daher stammt wahrscheinlich meine Liebe zu Tieren.
Als Kind hatte ich Katzen, später Hunde. Wir hatten eine Kinderfrau, aber unsere Mutter versuchte, jede freie Minute mit uns zu verbringen, was im Gastgewerbe wirklich nicht einfach war. Zum Unterschied vom Großteil der damaligen Bevölkerung mussten wir nicht hungern, ein Glück, das uns als Kinder natürlich nicht bewusst war. Überhaupt hat sich das Gasthaus später, als ich schon auf der Bühne stand, immer wieder als Hort für hungrige Schauspieler bewiesen. Doch bis dorthin war noch ein langer Weg.
Während des Krieges war meine Mutter mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Mein Onkel Joschi war an der Front, sie hielt die Stellung im »Stöckl«. Die Jahre des Krieges waren für mich von Gegensätzen geprägt. Einerseits die harte Arbeit im Gasthaus, die ständige Angst, wie es mit uns weitergehen würde, andererseits die Schrebergartenidylle meines Großvaters väterlicherseits, Ferdinand Haas, die mir wie eine Zauberwelt vorkam. Er hatte an mir einen besonderen Narren gefressen, da er sich immer eine Tochter gewünscht, aber nur Söhne bekommen hatte. Mein Großvater wohnte in der Hietzinger Hauptstraße mit seiner Frau Bertha, die wunderschöne Märchen für Kinder schrieb und veröffentlichte. In seinem Schrebergarten in Ober St. Veit wuchs alles nur Vorstellbare. Mein Großvater, pensionierter Reichsbahnoberinspektor und leidenschaftlicher Gärtner, hatte nicht nur einen grünen Daumen, er lehrte mich auch, die Natur zu achten, mit ihr respektvoll umzugehen und ihr keinen Schaden zuzufügen. Ich verbrachte viel Zeit mit ihm, einzig vor dem Unkrautjäten versuchte ich mich immer zu drücken. Vormittags nahmen wir meistens eine kleine Jause zu uns, und nachdem es ja damals noch kein Telefon gab, musste ich um die Mittagszeit auf einen kleinen Hügel steigen und nachschauen, ob Großmutter Bertha schon das weiße Handtuch am Balkon gehisst hatte. Wenn ja, bedeutete dies, dass wir uns beeilen mussten, denn das Mittagessen war fertig. Not macht eben erfinderisch.
Mein Großvater hatte noch eine Eigenart, an die ich mich erinnere. In seinem Garten war ein großes Loch, gerade so groß, dass ein Mann aufrecht darin stehen konnte. Und genau das tat er, wenn in Wien Fliegeralarm ausgelöst wurde. Er wollte nie in den Luftschutzkeller, er wollte im Freien, in seinem Garten sein – bis auf ein einziges Mal, und da rettete er mir das Leben.
Gerade im letzten Kriegsjahr mussten wir ständig in den Luftschutzkeller, fast jede Nacht gab es Bombenalarm. Am 19. Februar 1945 wurde der Tiergarten Schönbrunn schwer getroffen, von den 3500 Tieren überlebten nur 1500. Wie ich später erfuhr, waren die Nashorn- und Elefantenhäuser am meisten beschädigt worden. Aus den toten Elefanten kochte man dann Gulasch für die Bevölkerung, das weiß heute ja fast niemand mehr. Ich konnte das aber nicht essen, ich musste weinen, wenn ich an meine geliebten Elefanten dachte. Doch die Leute haben sich angestellt dafür, es gab ja so wenig zu essen.
Eines Nachts wurde unsere Wohnung, die ans Gasthaus anschließend lag, getroffen. Badezimmer und Wohnzimmer wurden zerstört, nur das Schlafzimmer nicht. Ein oder zwei Tage, nachdem der Tiergarten getroffen worden war, hörte ich es plötzlich in den Jalousien rascheln. Ich ging hinaus, um nachzusehen, woher das Geräusch kam, und da sah ich ein winzig kleines Afferl, das an der Jalousie zog. Ich ging langsam hin, aber es erschrak und lief davon. Ich hätte es sofort behalten und aufgepäppelt, das arme Tier. In derselben Nacht verschwand mein Kätzchen Bibi, um das ich sehr trauerte. Zuerst dachte ich, dass es sicher irgendwo im Schutt vergraben lag, bis ich es nachts miauen hörte. Meine Mutter und ich liefen sofort hinaus, um es zu suchen. Wir entdeckten Bibi am Gipfel des Schuttberges, wo sie kläglich im Mondlicht weinte. Wir wollten sie einfangen, aber sie war so traumatisiert, dass sie Reißaus nahm. Ich habe sie nie mehr wiedergesehen.
Wir mussten aus der zerbombten Wohnung so schnell wie möglich raus, es bestand akute Einsturzgefahr, und wie hätten wir zu dritt in einem Zimmer wohnen sollen, noch dazu ohne Bad? Also zogen wir zur Großmutter in den »Meidlinger Hof«.
Am 12. März 1945 kam es erneut zu Bombenangriffen auf Wien, große Teile der Innenstadt, darunter die Staatsoper, der Stephansdom, die Kärntner Straße und das Kunsthistorische Museum, wurden stark beschädigt. Wir wussten, dass der Krieg dem Ende zuging, und irgendwie hatte sich das Gerücht verbreitet, Fallschirmspringer würden über Wien abspringen. Ich war jedenfalls unglaublich neugierig. Also stieg ich aufs Dach, um alles aus der Nähe zu betrachten. Plötzlich heulten Sirenen auf. Ich wusste, das hieß wieder ab in den Luftschutzkeller. Doch irgendwie blieb ich beim Hinunterklettern an Eisensprossen hängen, verlor den Halt und stürzte rund drei Meter tief ab auf ein darunterliegendes Flachdach. Mir wurde schwarz vor Augen, und das Nächste, was ich mitbekam, war das gütige Gesicht meines Großvaters, der mich vorsichtig in den Luftschutzkeller trug.
Es war das erste Mal, dass er nicht in seinem Schrebergartenloch geblieben war. Er hatte als Erster bemerkt, dass ich nicht da war. Als ihm meine Mutter erzählte, dass ich aufs Dach wollte, überlegte er nicht lange und lief unter Todesgefahr aus dem Keller, um mich zu suchen. Er entdeckte mich am FIachdach und trug mich in den Keller. Ich hatte wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung erlitten und mir drei Rippen gebrochen. Vor allem die gebrochenen Rippen verursachten mir höllische Schmerzen. Trotzdem gingen meine Mutter und ich nach dem Angriff mit einem Leiterwagen zum »Stöckl« – das heißt, ich schleppte mich eher hin. Wir versuchten, aus dem Schutt noch ein paar Dinge zu retten. Darunter das Kassabuch und, was viel wichtiger war: ein Stück Geselchtes. Damit trabten wir wieder zurück in den »Meidlinger Hof«, wo unsere Großeltern schon sehr besorgt waren, da es bereits auf der nahe gelegenen Philadelphiabrücke zu Kampfhandlungen mit den einmarschierenden Russen gekommen war.
Als die Russen in Wien angekommen waren, begann eine bange Zeit für uns alle. Die Fenster des »Meidlinger Hofs« waren mit Brettern vernagelt, ich lugte durch die Ritzen und sah, wie die ersten Soldaten die Lage erkundeten. Eine Vorhut kam zu uns ins Hotel und war sehr freundlich. Man gab uns Geschenke, und einer der Offiziere warnte meine Mutter und zeigte auf mich: »Passen Sie auf Ihre Tochter auf, die nachkommenden Soldaten werden nicht so freundlich sein.« Meine Mutter hat mir daraufhin Ruß ins Gesicht geschmiert und mir die schmutzigsten und ramponiertesten Kleider angezogen, dazu noch ein zerlumptes Kopftuch – ich hab wirklich wie ein Lumpenweiberl ausgeschaut. Ein Russe hat mich so gesehen und sogar ausgespottet. Zu meiner Mutter meinte er dann: »Ihr nix Kultura, ihr schmutzig, Mädchen waschen.« Mich hat das unterhalten, mir war der Ernst der Lage nicht so bewusst.
Noch bevor der Krieg zu Ende war, starb meine geliebte Großmutter Bertha Haas. Es gab keine ärztliche Versorgung, elendig ist sie auf einem Feldbett in einem Luftschutzkeller gestorben. Nur wenige Wochen später folgte ihr mein Großvater nach. Damit hatte ich den Mann verloren, der mir und meinem Bruder Fritz ein Ersatzvater gewesen war.
Meine Mutter, die aufgrund all der Entbehrungen und Verluste nur mehr 37 Kilo wog, war dennoch in der Lage, alles im Griff zu behalten. Sie organisierte mithilfe eines Verwandten, dass der Großvater auf einer Schubkarre in seinen Schrebergarten gebracht und dort vorübergehend in seinem Luftschutzloch beerdigt wurde. Erst nach dem Krieg konnte er umgebettet werden. Hätte sie ihn in der eigens für solche Transporte adaptierten Straßenbahn, wie es damals üblich war, zum Zentralfriedhof gebracht, wäre er in einem Massengrab verschwunden, und das wollte sie ihm nicht antun.
Als Wien von den Alliierten in vier Zonen aufgeteilt wurde, waren wir in der Britischen Zone, die in jedem Fall besser als die russische war. Kurz nach Ende des Krieges zogen wir wieder ins »Stöckl«, das nach dem Bombeneinschlag völlig ausgeplündert war. Aber durch die Hilfsbereitschaft aller Nachbarn war die Wohnung relativ bald wieder bewohnbar und wir konnten die Wirtschaft wieder aufmachen, was zumindest ein wenig Ordnung und Freude in unseren Tagesablauf brachte.
In unserem Gasthaus verkehrten vor und nach dem Krieg immer wieder berühmte Schauspieler, darunter Burgschauspieler Fred Liewehr, der am Reinhardt Seminar (bis 1945 hieß es Schauspiel- und Regieseminar Schönbrunn), das ja in Schönbrunn beheimatet ist, Unterricht gab. Für seine Inszenierung von Gerhart Hauptmanns »Hanneles Himmelfahrt« (1940) wurden noch Kinder als Statisten gesucht. Ich war überglücklich, als er mich dafür auswählte, und meine Mutter verhandelte meine erste Gage: eine Wurstsemmel. Kein schlechtes Geschäft in der Zeit. Dieser Auftritt war für mich ein weiterer Schritt in Richtung Theater.
Einige Jahre später, ich hatte meine Schulausbildung schon abgeschlossen und arbeitete im Gasthaus meiner Mutter, kam mir wieder ein berühmter Schauspieler zu Hilfe, der ebenfalls bei uns Stammgast war: Paul Hörbiger. Er drehte zu der Zeit gerade in den ehemaligen Rosenhügel-Studios den Film »Schrammeln« (1944) mit Hans Moser und Hans Holt. Ich war 17 Jahre alt und wollte unbedingt als Statistin dabei sein, also bin ich einfach hingegangen und habe mich beworben. Paul Hörbiger hat mich gleich aus der Gruppe der Statisten herausgewinkt: »Bist du nicht der Frau Haas ihre Trauti? Was machst du denn hier?« Selbstbewusst antwortete ich: »Schauspielerin will ich werden!« Worauf er meinte: »Hier wirst du das nicht. Wenn es dir ernst ist mit dem Beruf, dann schau, dass du eine gute Ausbildung bekommst.« Diesen Rat habe ich mir zu Herzen genommen. Ich verdanke Paul Hörbiger sehr viel, denn er hat mich auf den richtigen Weg geschickt.
Nachdem ich nicht wusste, wie ich zu einer Ausbildung kommen konnte, vertraute ich mich Grete Kratochwilla an, der besten Freundin meiner Mutter. Grete war eine Nichte von Adolf Kratochwilla, der 1884 das Café Sperl in der Gumpendorfer Straße übernommen hatte. Das Café Sperl, das bis 1964 im Familienbesitz blieb, war immer schon ein Treffpunkt von Künstlern, und Grete hatte dadurch ausgezeichnete Kontakte, vor allem aus dem Theaterbereich. Tante Grete, wie ich sie nannte, hörte mich geduldig an, fand die Idee längst nicht so abwegig wie meine Familie und schlug vor, bei der großen Burgschauspielerin Julia Janssen vorzusprechen. Je nachdem, wir ihr Urteil ausfallen würde, sollte die Familie dann über meinen weiteren Weg entscheiden.
Ich lernte die Rolle des Gretchens aus Goethes »Faust« und brachte sie voller Verve und Inbrunst zum Vortrag. Julia Janssen war von mir so beeindruckt, dass sie mir nicht nur Talent bescheinigte, sondern sofort anbot, mich persönlich auszubilden, was für mich geradezu der Gipfel der Glückseligkeit war. Jetzt wusste ich, dass selbst die letzten Zweifel meiner Familie ausgeräumt waren. Ich durfte endlich mein Handwerk erlernen.
Julia Janssen war eine großartige Lehrerin, die viel von mir verlangte und mich die unterschiedlichsten Rollen lernen ließ, denn in weiser Voraussicht meinte sie, je größer die Palette, desto besser die Auswahl an Rollen.
Leider dauerte mein Glück nicht sehr lange, denn mit Ende des Krieges begann sie wieder am Burgtheater zu spielen und hatte nur mehr wenig Zeit für mich. Also meldete ich mich beim Reinhardt Seminar zur Aufnahmeprüfung an. Eigentlich durfte man damals – bevor man sich beim Reinhardt Seminar bewarb – noch keinen Schauspielunterricht genommen haben. Dass ich bereits ein Jahr bei Julia Janssen Unterricht hatte, verschwieg ich also wohlweislich. Ich war vollkommen davon überzeugt, mit meiner Vorbildung und meinem Selbstbewusstsein die Aufnahmeprüfung mit links zu schaffen. Weit gefehlt. In der Kommission saßen unter anderen die beiden ehrwürdigen Burgschauspieler Hans Thimig und Vera Balser-Eberle. Balser-Eberle war nicht nur Burgschauspielerin, sie gab auch Unterricht in Sprechtechnik. Ich spielte mir die Seele aus dem Leib. Zwei Rollen hatte ich einstudiert, eine dramatische und eine lustige, die ich mit Inbrunst und Hingabe vortrug. Danach warteten wir alle auf das Ergebnis, wobei ich mir sicher war, dass man mich nehmen würde. Umso größer die Enttäuschung, als mir verkündet wurde, dass es bei mir nicht gereicht hatte. Der Grund: Vera Balser-Eberle war nicht davon überzeugt, dass man zwei so unterschiedliche Rollen, zuerst komisch und dann traurig, in der kurzen Zeit spielen kann. Sie fand mich »zu oberflächlich«.
Weinend trottete ich nach Hause ins »Stöckl«, warf mich über den Küchentisch und wollte nicht mehr aufhören zu schluchzen. Meine Mutter tröstete mich, so gut sie konnte, und meinte nur: »Wer weiß, wozu es gut ist.« Diese Einstellung habe ich übernommen, sie hat mir später im Leben vieles leichter gemacht. Außerdem gab es ja nicht nur das Reinhardt Seminar.
Ich bewarb mich gleich beim Konservatorium Preiner, wurde genommen und lernte dort Kollegen wie Herbert Fux, den Regisseur Fritz Zecha und Rosemarie Isopp kennen. Während der Ausbildung, die eigentlich drei Jahre dauern sollte, war es den Schülern strengstens untersagt, irgendwo Theater zu spielen. Dieses Verbot zu brechen, reizte mich, und schon bald spielte ich in der Kleinen Bühne nahe der Wienzeile in Nestroys »Einen Jux will er sich machen« die Rolle der Marie. Auf der Bühne waren außerdem Helmut Qualtinger, der zusätzlich Regie führte, und Fritz Zecha. Meine Rolle war nicht überwältigend groß, aber es war eine weitere lehrreiche Erfahrung. Schon nach einem Jahr verließ ich das Konservatorium, denn einer meiner Lehrer, Otto Burger, wurde zum Schauspieldirektor des Landestheaters Linz bestellt, und er durfte sich einige Schüler aussuchen, um sie mitzunehmen. Selbstverständlich mussten wir vorher dem Intendanten vorsprechen. Wir, das waren Rosemarie Isopp, Fritz Zecha, Erich Auer, Martha Wallner und ich.
Gemeinsam mit Otto Burger fuhren wir nach Linz, und ich zog alle Register meines jungen Könnens. Neben der jungen Naiven, der Munteren, der Sentimentalen und der Liebhaberin sollte ich ab und zu in Singrollen besetzt werden.
Für mich war diese Zeit Mitte der 1940er-Jahre in Linz die beste Ausbildung, die man bekommen konnte. Verdient habe ich nicht viel, und die Wohnsituation war nicht ideal. Ich wohnte sehr bescheiden – immerhin in einem eigenen Einzelzimmer im Künstlerheim –, aber die Tatsache, nicht nur einen fixen Vertrag zu haben, sondern derart gefordert zu werden, war nicht mit Gold aufzuwiegen. So wagte ich dort meine ersten Schritte in das Fach der Operette, und das kam so: Es wurde »Gräfin Mariza« gespielt, und die Soubrette Inge Stick, die die Rolle der Lisa gesungen hat, war ausgefallen. Kurzerhand wurde ich mit ihrer Rolle besetzt. Drei Tage hatte ich Zeit, alles zu lernen. Meine Gesangsnummern probte ich mit dem Kapellmeister am Klavier, die Tanzszenen mit meinem Buffopartner. Ich hatte damals eine nette Naturstimme, aber noch keine musikalische Ausbildung zur Sängerin, das kam erst später. Ich höre noch den Kapellmeister während meiner Gesangsbemühungen sagen: »Frau Haas, das Schwarze neben den Noten san keine Fliegenschiss!«
Ab der 50. Vorstellung sollte ich also für Inge Stick einspringen, und mir war recht mulmig zumute, vor allem, weil ich ja noch nie mit dem gesamten Orchester gesungen hatte. Es kam der große Abend, plötzlich setzte das Orchester ein, ich erschrak bis in die Knochen und fing an, über die Bühne zu rennen. Der Tenor deutete mir, stehen zu bleiben, ich verstand das allerdings als Aufforderung, noch schneller zu singen. Kurzum: Für mich war es ein Desaster. Die Kritik war milde, man bezeichnete mein Spiel als »sehr lebendig«, auch als Tänzerin sei ich begabt, aber als Operettensoubrette sollte ich dann wohl eher nicht eingesetzt werden. Dennoch gab man mir immer wieder kleinere Gesangspartien, die ich dann doch meisterte.
Einer meiner Kollegen und der Star des Ensembles war Louis Soldan, der bald für eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens verantwortlich sein sollte. Für mich war er wegen seiner Vielseitigkeit einer der ganz großen Schauspieler. Oft bin ich nur hinter der Bühne gestanden, um ihm zuzusehen. Seine Ausstrahlung, die scheinbare Leichtigkeit, mit der er jede Rolle anpackte, alles das sprang aufs Publikum über. Er wurde von allen bewundert. Außerdem sah er umwerfend aus und war ein Liebling der Frauen, was durchaus in vielen Fällen auf Gegenseitigkeit beruhte. Später wurde er Ensemblemitglied im Theater an der Josefstadt. Er starb leider 1971 mit nur 51 Jahren.