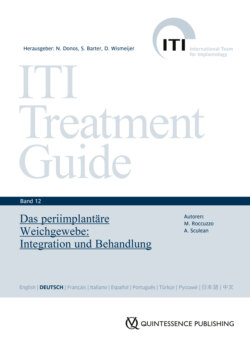Читать книгу Das periimplantäre Weichgewebe - Mario Roccuzzo - Страница 24
3.1 Maßnahmen bei der Implantation
ОглавлениеAus biologischer Sicht gilt für die apikokoronale Positionierung insbesondere von Tissue-Level-Implantaten das Prinzip „So flach wie möglich, so tief wie nötig“ (Buser et al. 2004). Nur so lassen sich unter Berücksichtigung der regionalen Anforderungen an die Prothetik und ihr ästhetisches Erscheinungsbild tiefe periimplantäre Taschen vermeiden.
Bestätigung findet dieses Prinzip in einer kürzlich publizierten Fallkontrollstudie zum Einfluss eines tiefen Schleimhauttrichters (≥ 3 mm) bei experimentell induzierter periimplantärer Mukositis (Chan et al. 2019). Insgesamt 19 Patienten mit einem korrekt positionierten Tissue-Level-Implantat wurden einer Prüf- oder Kontrollgruppe mit tiefem (≥ 3 mm) bzw. flachem (≤ 1 mm) Schleimhauttrichter zugeteilt. Das standardisierte Vorgehen umfasste eine Phase zur Optimierung der Mundhygiene, gefolgt von einer 3-wöchigen „Induktionsphase“, in der zur Herbeiführung einer periimplantären Mukositis per Kunststoffschiene die häusliche Hygiene unterbunden wurde, und einer „Erholungsphase“ von 3 plus 2 Wochen nach Wiederaufnahme der normalen Mundhygiene.
Erhoben wurden mehrfach der modifizierte Plaqueindex (mPI), der modifizierte Gingivalindex (mGI) sowie die IL-1β-Konzentrationen in der periimplantären Sulkusflüssigkeit. Die Plaque- und Gingivalwerte stiegen in der Induktionsphase, sanken in der Erholungsphase mit Aufnahme der normalen Mundhygiene und näherten sich dabei in der Gruppe mit flachem Schleimhauttrichter wieder den Ausgangswerten. In der Gruppe mit tiefem Trichter endete zwar die Plaquebildung, die Entzündungsauflösung verzögerte sich aber und verlief in den ersten 3 Wochen wieder mit normaler Munghygiene schwächer. Erhärtet wurde dies durch wesentlich höhere IL-1β-Konzentrationen am Ende der Induktions- und während der Erholungsphase in der Gruppe mit tiefem Trichter. Hier waren die Ausgangswerte des Gingivalindex erst wieder nach einer professionellen submukosalen Reinigung bei entfernter Krone erreichbar.
Dieser Einfluss der periimplantären Sulkustiefe auf die Auflösung experimentell induzierter Mukositis nährte Zweifel an der Wirksamkeit der häuslichen Mundhygiene bei zu tief inserierten Implantaten. Die Behandlerin oder der Behandler sollten aufgrund des offenbar mit der Sulkustiefe steigenden Risikos eines Fortschreitens von Mukositis zu Periimplantitis nicht nur aus ästhetischen, sondern auch aus biologischen Gründen alles unternehmen, um Implantate so inserieren zu können, dass sie auch optimal positioniert sind (Berglundh et al. 2018).
Klinisch mag diese Vorgabe bei Implantationen ohne Nachbarzähne leichter umzusetzen sein, während sich umgekehrt eine Positionierung zwischen zwei Zähnen, insbesondere wenn diese parodontal geschädigt sind, schwieriger gestaltet. Die Abbildungen 1 (a und b) sowie 2 (a und b) illustrieren eine richtige und eine falsche Implantatpositionierung.
Abb. 1 a Inserieren eines (im Hinblick auf eine minimale Sondiertiefe bei der Kronenzementierung) sorgfältig ausgewählten Implantats im parodontal geschädigten Lückengebiss.
Abb. 1 b Gesunde Interdentalpapille zwischen zwei Tissue-Level-Implantaten. Zustand nach Entfernen zweier 7 Jahre alter Keramikkronen, die mit temporärem Zement in situ gehalten worden waren.
Abb. 2 a Zustand mit tiefem Schleimhauttrichter rund um ein Implantat (distal), das ohne Beachtung der Weichgewebestärke auf Höhe des Alveolarkamms inseriert worden war.
Abb. 2 b Rückstände von kunststoffbasiertem Zement rund um das distale Wide-Neck-Implantat. Der tiefe Schleimhauttrichter verhindert eine vollständige Beseitigung der Rückstände. Verschraubbare Kronen wären in beiden Fällen vorteilhafter gewesen.
Die Planung einer für die Weichgewebeintegration optimalen Implantatposition sollte vor der Zahnextraktion erfolgen. Nach der Extraktion stellen, insbesondere bei Fehlen einer oder mehrerer Alveolenwände, kammerhaltende Maßnahmen eine Möglichkeit der Behandlung dar (Roccuzzo et al. 2014c, Mardas et al. 2015). Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass eine gesicherte Alveolarkammkontur oft weitere Therapieschritte erleichtert, einen fehlpositionierten Implantatkragen unwahrscheinlicher macht und einen optimalen Weichgewebeverschluss ermöglicht (MacBeth et al. 2017). Abbildung 3 (a bis i) illustriert einen langfristig stabilen Erhaltungszustand von Weichgewebe nach einer Implantation mit vorheriger Maßnahme zur Kammerhaltung. In Arealen mit besonders großer Schleimhautstärke könnte sich die korrekte Positionierung eines Implantats bei flachem Sulkus als besonders schwierig erweisen. Eine korrekte Lappengestaltung ist hier zwingend erforderlich insbesondere im Hinblick auf eine geplante zementierte Prothetik. Abbildung 4 (a bis h) zeigt exemplarisch die Positionierung eines Implantats im seitlichen Oberkiefer, wo überschüssiges Gewebe entfernt werden musste.
Abb. 3 a Röntgenaufnahme von 36 mit schwerer Paro-Endo-Läsion. Planung kammerhaltender Maßnahmen nach der Extraktion wegen resultierender Knochendefekte nahe der Nachbarzähne.
Abb. 3 b Nach Extraktion des Zahns und sorgfältiger Beseitigung des entzündeten Epithels rund um die Alveole bestand ein bukkales Knochendefizit mit Beweglichkeit der marginalen Schleimhaut.
Abb. 3 c In die dekontaminierte Alveole wurde Knochenersatzgranulat in Form von entproteinisiertem bovinem Knochenmineral mit 10 % Kollagen (Bio-Oss Collagen; Geistlich, Wolhusen, Schweiz) gefüllt, mittels einer Kollagenmembran (Bio-Gide; Geistlich) doppellagig abgedeckt und mit resorbierbarem 4-0 Vicryl-Nahtmaterial (Ethicon; Johnson & Johnson International) fixiert.
Abb. 3 d Nach 8 Wochen Einheildauer präsentierte sich der Situs mit einem gewebestarken Streifen keratinisierter Mukosa.
Abb. 3 e Nach 4 Monaten war der Alveolarkamm ohne weiteren Augmentationsbedarf für eine positionsgerechte Implantation ausreichend dimensioniert.
Abb. 3 f Zum Einsatz kam ein chemisch modifiziertes Titanimplantat (S, WNI SLActive, Durchmesser 4,8 mm, Länge 12 mm; Institut Straumann AG, Basel, Schweiz).
Abb. 3 g Das Weichgewebe wurde rings um den glatten Implantatkragen so angelagert, dass es im Hinblick auf die ungedeckt erfolgende Einheilung optimal vernäht werden konnten.
Abb. 3 h Zustand 3 Monate nach Insertion. Das Implantat ist von einem festen Kragen an keratinisiertem Gewebe umgeben.
Abb. 3 i 7 Jahre nach Insertion zeigt das periimplantäre Weichgewebe trotz einer gewissen bukkalen Rezession am benachbarten natürlichen Prämolaren einen stabilen Erhaltungszustand.
Abb. 4 a Panoramabildausschnitt der linken Kieferhöhle mit großer Zyste. HNO-seitig wurde keine weitere Behandlung empfohlen, die Implantationen ohne Tangieren der Kieferhöhle geplant.
Abb. 4 b Seitlicher Oberkiefer links. Die Knochensondierung erbrachte im Bereich des zweiten Molaren eine sehr gewebestarke Schleimhaut.
Abb. 4 c Erste Schnittführungen.
Abb. 4 d Seitlicher Oberkiefer nach Beseitigung des überschüssigen, später als Transplantat im Frontbereich verwendeten Gewebes.
Abb. 4 e Titanimplantat mit chemisch modifizierter Oberfläche (S, WNI SLActive, Durchmesser 4,8 mm, Länge 10 mm; Institut Straumann AG) in Regio 27. Das Standardimplantat mit glattem 2,8-mm-Kragen schien für einen weiter koronal liegenden Kronenrand optimal geeignet.
Abb. 4 f Intraoperative Ansicht nach der Implantation in Regio 24 (SP, WNI SLActive, Durchmesser 4,1 mm, Länge 12 mm; Institut Straumann AG). Die Auswahl des Implantats mit 1,8-mm-Kragen sollte das Risiko von künftigen Weichgewebedehiszenzen reduzieren. Die bukkale Knochenkonkavität am mesialen Implantat erhöht das Risiko einer Dehiszenz.
Abb. 4 g Autologe Knochenspäne auf der vestibulären Implantatseite. Zum Schutz der Späne und zur Verbreiterung des Alveolarkamms wurde ein Bindegewebetransplantat seitlich entnommen und adaptiert.
Abb. 4 h Halb gedeckte Einheilung im vorderen Transplantationsareal; transmukosale Einheilung mit eng adaptiertem Lappen rund um den Kragen des distalen Implantats.
Abb. 4 i Zustand 6 Wochen nach dem Implantationseingriff mit optimal adaptiertem Weichgewebe an beiden Implantaten.
Abb. 4 j Befestigen der Massivsekundärteile (Höhe 4 mm) 8 Wochen nach dem Implantationseingriff.
Abb. 4 k Zementierte viergliedrige Metallkeramikbrücke.
Abb. 4 l Zustand nach 1 Jahr. Nach Entfernen der temporär zementierten Brücke zeigt das periimplantäre Gewebe einen gesunden Erhaltungszustand mit blutungsfreien Sondiertiefen unter 4 mm.
Abb. 4 m Röntgenaufnahme nach 5 Jahren. Die approximalen Knochenhöhen sind stabil.
Abb. 5 a Ausgangssituation vor dem Eingriff.
Abb. 5 b Leicht palatinale Schnittführung zum Verschieben von keratinisiertem Gewebe nach vestibulär.
Abb. 5 c Zwei Wide-Neck-Implantate in Regio 26 und 27 (SP, WNI SLActive, Durchmesser 4,8 mm, Länge 10 mm; Institut Straumann AG).
Abb. 5 d Ergänzende Schnittführung auf dem distalen Abschnitt des palatinalen Lappens.
Zu den Herausforderungen einer optimalen Lappengestaltung an ungedeckten Implantaten gehört der Verschluss rings um den Implantatkragen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Weichgewebe anatomische Unregelmäßigkeiten aufweist. Abbildung 5 (a bis k) illustriert den Umgang mit derartigem Weichgewebe an Tissue-Level-Implantaten im seitlichen Oberkiefer.
Abb. 5 e Rotieren des gestielten Lappens gegen den Uhrzeigersinn.
Abb. 5 f Eingelagerter Stiel zwischen den beiden Implantaten.
Abb. 5 g Adaptieren des Stiels mit vertikaler Matratzennaht (Vicryl 4/0) zwischen den beiden Implantaten.
Abb. 5 h Zustand nach dem endgültigen Vernähen distal zum distalen Implantat.
Abb. 5 i Ausgangsbefund aus okklusaler Sicht.
Abb. 5 j Postoperativer Befund aus okklusaler Sicht.
Abb. 5 k Zahnfilm 18 Monate nach dem Implantationseingriff. Die approximalen Knochenhöhen sind vorteilhaft.
Abb. 6 a Ausgangsbefund für Regio 46 nach kieferorthopädischer Behandlung. Eingeschränkte Alveolarkammbreite ohne keratinisierte Schleimhaut.
Abb. 6 b und c Implantation (S, SLA, Durchmesser 4,1 mm, Länge 12 mm; Institut Straumann AG) und Schließen der vestibulären Knochendehiszenz mit autologem Knochen und Knochenersatzgranulat.
Abb. 6 d Resorbierbare Kollagenmembran zum Abdecken des Augmentats mit gestanzter Öffnung präpariert und per Einheilkappe fixiert.
Abb. 6 e und f Rotieren der mesialen Papille um 90° gegen den Uhrzeigersinn und Vernähen an der distalen Papille, um vestibulär zum Implantat einen breiten Streifen an keratinisiertem Gewebe zu erhalten.
Noch schwieriger gestaltet sich eine zur transmukosalen Einheilung optimale Lappenbildung bei vollständigem Fehlen der keratinisierten Schleimhaut. Unter diesen Umständen empfiehlt sich allenfalls ein freies Gingivatransplantat, insbesondere wenn dazu noch Bedarf an einer Knochenregeneration herrscht (siehe Kapitel 4.1).
Unter der Voraussetzung einer korrekten chirurgischen Versorgung kann vielfach auch eine geringe Menge an keratinisiertem Gewebe zur Bildung eines Weichgewebemantels um den Implantatkragen ausreichen. Abbildung 6 (a bis l) zeigt eine solche Behandlung an einem Tissue-Level-Implantat, durchgeführt in Verbindung mit einer Knochenregeneration bei offenbar fehlender Verfügbarkeit von keratinisiertem Gewebe.
Abb. 6 g und h e-PTFE-Nähte aus bukkaler und okklusaler Sicht.
Abb. 6 i Zustand in der frühen Einheilphase (nach 6 Wochen). Eine neue Mukogingivallinie zeichnet sich bereits ab.
Abb. 6 j Zustand 15 Monate nach der Implantation (vestibuläre Ansicht). Dank Knochenaugmentation und Papillenrotation bei der Implantation bietet das Weichgewebe nun ein optimal konturiertes Erscheinungsbild.
Schlecht positionierte Implantate können oft die Mundhygiene erschweren sowie das Risiko von Schleimhautentzündungen erhöhen, wobei zu bedenken ist, dass Plaquebildung an Implantaten stärkere Entzündungsreaktionen auslöst als an natürlichen Zähnen (Berglundh et al. 2011). Trotz einer eingeschränkten Datenlage wird allgemein stark davon ausgegangen, dass biologische Komplikationen an korrekt positionierten Implantaten seltener auftreten.
Neben dieser korrekten Positionierung nach Maßgabe des prothetischen Behandlungsziels könnte ein breiter Streifen an befestigter keratinisierter Mukosa ebenso wünschenswert oder auch wesentlich für weniger Gewebeentzündungen und Langzeitkomplikationen an Implantaten sein wie ein korrekter periimplantärer Sulkus und ein gewebestarker Phänotyp.