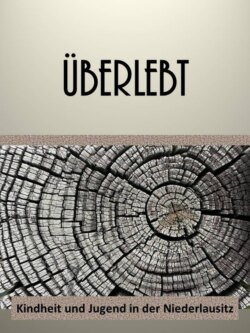Читать книгу Überlebt - Marion Hein - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schiefertafel, Tinte und Schläge
ОглавлениеGerhard Hein *1930 Bau-Ingenieur
1936 bis 1939
Am 15. April 1936 wurde ich in die Klasse 8b der Knabenvolksschule eingeschult. Ich bekam neue Schuhe, schmucke Kleidung und die obligatorische Zuckertüte. Wir waren damals 2 Eingangsklassen mit 38 bzw. 40 Schülern. Der Klassenlehrer von 8a war Herr Puhle, der von der Klasse 8b Herr Sander. In den Klassenräumen wurde mit den Schülern und den dazugehörigen Lehrern ein Klassenbild gemacht. Auf ihnen sind die schlichten Räume mit den üblichen Schulbänken zu erkennen. Die Wandtafel war auf der entgegengesetzten Seite. Für die Klassenfotografien hatten meine Eltern damals keine Mark übrig. Bei der Einschulung oder Versetzung in die nächsthöhere Klasse war es üblich, die Schulbücher von Schülern dieses Jahrgangs zu erwerben. So konnte ich bei der Einschulung im April 1936 die Fibel für das 1. Schuljahr von einem Vorgänger übernehmen. Teilweise kauften die Eltern natürlich auch neue Bücher für ihre Kinder. In den ersten beiden Schuljahren wurde mit Schieferstift auf eine Schiefertafel geschrieben. Eine Seite war liniert, die andere enthielt Karos. Für den Transport in der Schulmappe gab es eine Hülle, damit die Hausaufgaben nicht unleserlich werden konnten. Schreib- und Rechenhefte gab es erst ab dem 3. Schuljahr. Wir schrieben mit dem üblichen Federhalter mit auswechselbaren Stahlfedern. Das Eintauchen in ein Tintenfass musste geübt werden, um Kleckse zu vermeiden. In den Pausen konnte man beim Hausmeister Brink im Erdgeschoß Milch in Flaschen für 10 Pfennig oder Milchkakao für 8 Pfennig mit Strohhalm kaufen. Für mich war das trotz des geringen Preises höchsten einmal in der Woche möglich. In dieser Zeit brachte mich meine Mutter immer auf dem Fahrrad in die Schule. Meistens fuhr sie dann weiter zur Arbeit. Nachmittags musste ich in den Kindergarten der Firma neben der Knaben-Volksschule laufen. Abends ging es mit meiner Mutter wieder heim.
Ich hatte im 3. und 4. Schuljahr Lehrer Puhle als Klassenlehrer. Er war sehr auf Reinlichkeit bedacht. In Erinnerung sind mir immer noch die täglichen Überprüfungen meiner Fingernägel geblieben. Das Reinigen war bei unseren sanitären Verhältnissen in einer Wohnlaube ein Problem. Meine Eltern wurden zwar ermahnt, verwendeten aber kaum Zeit für die Reinigung meiner Nägel. Außerdem war mein Schulweg kaum geeignet, die Hände bis zur Schule immer sauber zu halten. Der Spieltrieb tat unterwegs sein übriges.
Es sollte eine Arbeit geschrieben werden. Beim Eintauchen der Federhalter in die Tintenfässer meldeten alle, dass keine Tinte mehr vorhanden sei, obwohl diese gerade erst einen Tag vorher aufgefüllt worden waren. Die Tintenfässer für jeweils 2 Schüler befanden sich, wie damals üblich, in der Mitte der Schulbank. Es waren also 20 Fässer leer. Wo konnte die Tinte geblieben sein? Klassenlehrer Puhle war außer sich. Jetzt wurde gefahndet. Zum Schluss stellte sich heraus, dass einer unserer Schulkameraden scheinbar riesigen Durst auf Tinte hatte. Er hatte ausnahmslos alle Fässer aus der Bank herausgenommen und geleert. Dafür gab es dann die damals übliche Strafe. Im Winter 1938 fuhren mein Schulfreund und ich bei Eis und Schnee etwa 2 Kilometer mit Schlittschuhen in die Schule. Es ging einfach schneller. Einmal waren wir zu faul, die Schlittschuhe vor dem Schulgebäude abzuschnallen und gingen einfach damit bis in unseren Klassenraum im 1. Obergeschoß. Prompt wurden wir von Seelands Mope erwischt. Diesmal war er gnädig, es gab keine Schläge mit dem Rohrstock. Dafür mussten wir 50 Mal schreiben Man darf nicht mit Schlittschuhen in der Schule zum Klassenzimmer laufen. Das hat uns einen ganzen Nachmittag und ein halbes Heft gekostet. Stinklangweilig. Ich glaube, wir hätten in diesem Fall lieber Schläge bezogen.
1936 begannen die Schuljahre mit der 8. Klasse und endeten mit der 1. Das änderte sich mit dem Schuljahr 1939/40. Ab da wurde man in die 1. Klasse eingeschult und aus der 8. Klasse entlassen - wenn man nicht sitzengeblieben war. Dadurch kam bei mir das Kuriosum zustande, dass ich von Klasse 5b nach Klasse 4b versetzt wurde. Die 4b war nach neuer Zählung dann die Klasse 5, also das 5. Schuljahr. So ist die Nummerierung auch heute noch.
Meyers Konversationslexikon 1940 bis 1943
Der Übergang zum Gymnasium nach dem 4. Schuljahr fiel bei mir aus. Meine Eltern konnten das Schulgeld von damals 25 Reichsmark nicht aufbringen. So blieb ich Volksschüler bis zur 8. Klasse. Im 5. Schuljahr wurden die Klassen a und b zur Klasse 5 zusammengelegt. Lehrer Sander war unser Klassenlehrer im Sommerhalbjahr des 5. Schuljahres 1940. Das Winterhalbjahr 1940/41 hatten wir bei Lehrer Cywinski.
Bis 1940 wurde die 1924 an preußischen Grundschulen eingeführte Schreibschrift von Ludwig Sütterlin gelehrt. Dass die Schrift durch einen Willkürakt der nationalsozialistischen Regierung abgeschafft wurde, dürfte heute kaum noch bekannt sein. 1941 wurde die sogenannte Normalschrift, wie die lateinische Druck- und Schreibschrift bezeichnet wurde, eingeführt. Das bedeutete für uns eine nicht unbeträchtliche Umstellung, besonders bei den Schularbeiten. Die Sütterlinschrift ist heute dennoch von Vorteil, wenn man handschriftliche historische Dokumente und Urkunden lesen will. Naturkunde hatten wir bei Lehrer Semisch (Gandhi). Der Schulgarten an der Knabenschule wurde damals von ihm betreut. Der Unterricht fand häufig in diesem Garten statt. Hier wurden uns die einzelnen Pflanzen gezeigt und erklärt. An der Grundstücksgrenze wuchsen Maulbeersträucher. Mit den frisch gepflückten Blättern dieser Sträucher mussten wir unter Aufsicht von Gandhi Seidenraupen bis zum Einspinnen füttern. Dazu wurden die Blätter über die auf Brettern befindlichen Seidenraupen gelegt. Manchmal mussten wir auch sonntags zum Füttern erscheinen.
Die Schule hatte 3 getrennte Treppenhausaufgänge ohne gegenseitige Verbindung. Von einem Treppenhaus in ein anderes gelangte man über den Schulhof. Zum Pinkeln musste man über den Schulhof in ein Nebengebäude. Graffitis gab es an den Wänden genauso wie heute. Nur wurden die Bilder nicht gesprüht, sondern mit Nägeln oder Messern in die Farbe oder den Putz eingekratzt.
Bis zum Beginn des Krieges 1939 hatten wir Turnen bei Papke. Danach bei dem älteren Lehrer Mauruschat. Nach dem Umzug in die Mädchenschule fand das Turnen in der nahe gelegenen Doppeltumhalle statt. Dabei wurde auch Völkerball gespielt, was uns in aller Regel mehr Spaß machte als das Turnen an Geräten. Bei gutem Wetter war auch mal Handball auf dem Platz an der Doppelturnhalle angesagt. Nach meinen Erinnerungen war Herr Mauruschat eigentlich kein echter Sportlehrer, er hat jedenfalls nie etwas vorgeturnt.
Bei ihm machte ich auch meine beiden Schwimmprüfungen im damaligen Schwimmbad an der Schacke. Für den Freischwimmer musste man 15 Minuten Brustschwimmen beginnend mit einem Sprung vom 1m-Brett. Zum Fahrtenschwimmer mussten 45 Minuten in beliebigem Stil geschwommen werden. Mit dem Sprung vom 3m-Brett wurde begonnen. Für diese Leistung bekam man eine bessere Sportnote im Zeugnis. Mauruschat hatte die Angewohnheit, in der Pausenaufsicht auf dem Schulhof mit dem Rohrstock über den zusammengedrückten Daumen und Mittelfinger zu hauen, was regelmäßig zu blauen Fingernägeln führte. In dieser Zeit spielten wir einmal Handball gegen unsere alten Klassenkameraden von der Oberschule. Das Spiel pfiff ein Lehrer der Oberschule und wurde von uns haushoch verloren.
Nach dem Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion am 22. Juni 1941 gab es immer mehr verwundete Soldaten. Es mussten weitere Lazarette eingerichtet werden. Nach den großen Ferien 1941 wurde das Gebäude der Knabenvolksschule Lazarett. Wir wurden in die Mädchenschule verlegt. Es wurde wöchentlich wechselnder Schichtunterricht eingeführt, eine Woche vormittags, die nächste Woche nachmittags. Unter den Schulbänken fanden wir häufiger Post von den Mädchen.
Im 6. Schuljahr war der Konrektor Karl Scholz unser Klassenlehrer. Er war ein sehr korrekter Lehrer, bei dem mir das Lernen richtig Spaß machte. Bei Schiemenz hatten wir Musikunterricht. Das Singen fand immer in der Aula statt. Mit Beginn eines Liedes sagte er mit erhobenen Händen immer: „Zwei, drei, Luft.“ Bei uns in der Klasse hieß es aber Zwei, drei, Luft, Schiemenz hat gemufft. Gesungen wurden in aller Regel Volkslieder wie zum Beispiel Das Wandern ist des Müllers Lust. Ob damals auch die üblichen Marschlieder der Hitlerjugend geübt wurden, ist mir nicht in Erinnerung. Da ich besonders bei mehrstimmigen Stücken nicht die Töne halten konnte, wurden ich und 4 weitere Klassenkameraden durch Richardchen generell vom Singen ausgeschlossen. Bei mir war dadurch eine glatte 6 für Musik im Zeugnis bis zur 8. Klasse vorprogrammiert. Wenn die anderen ihre Lieder probten, konnten wir hinter den singenden Schulkameraden die Hausaufgaben für den nächsten Tag erledigen. Nach dem Gesang wurden dann einfach die Ergebnisse abgeschrieben. Beim Unterricht im Klassenraum saß Schiemenz vorn an seinem Lehrertisch. Wenn er das Gefühl hatte, ein Schüler hört nicht zu oder stört den Unterricht, dann schaute er erst plötzlich nach links und sagte: „Der hat mich noch immer nicht verstanden.“ Und dann flog sein Schlüsselbund nach rechts zum Störenfried. Seine Standardstrafe war dann meistens eine saftige Kopfnuss mit den Fingernägeln.
Ich hatte einen sehr langen Heimweg. Nach dem Unterricht ging ich mit anderen Schulkameraden öfter bei Mommert rein, um ein bisschen Schokoladen- oder Bonbonbruch zu ergattern. Dabei hatten wir nur dann Glück, wenn gerade die Schubfächer und Kästen leer waren und gesäubert wurden. Hatten wir hier keinen Erfolg, wurde bei der Bäckerei Raban ein weiterer Versuch gestartet, um an Kuchenränder zu kommen. Beide Möglichkeiten gingen mit der Verschlechterung der Ernährungslage während des Krieges nach und nach verloren.
In den Herbstferien ging es mit etwa 12 Kameraden der 7. Klasse zum Kartoffeleinsatz. Begleitet wurden wir von einem älteren Hitlerjugend-Führer. Am Bahnhof holte uns ein Bauer ab. Nach dem Frühstück ging es barfuss aufs Feld. Morgens war es manchmal schon empfindlich kalt, so dass wir froren. Untergebracht wurden wir in einem Klassenraum der Grundschule. Der Raum war mit Stroh ausgelegt. Zusätzliche Decken dienten als Unterlage und zum Zudecken. Der Bauer, bei dem wir Kartoffeln lesen sollten, holte uns an der Schule ab. Es wurden Abschnitte eingeteilt, wo immer 2 Jungen zu lesen hatten. Der Kartoffelroder fuhr rund herum, so dass wir uns beeilen mussten, um in einem bestimmten Zeitrahmen alle Kartoffeln zu lesen und auf Kastenwagen zu schütten. Hierbei wurde verbotenerweise auch manche Kartoffel in den Boden getreten. Mittagessen gab es am Rande des Kartoffelackers, Abendessen im Bauernhof. Für jeden Tag gab es 1 Reichsmark. Das Essen, die Unterbringung sowie die An- und Heimreise waren frei. Nach etwa 14 Tagen kamen wir vollkommen kreuzlahm wieder heim. Aber der Verdienst war für mich wertvoll. Ich konnte mir davon zusammen mit anderen Ersparnissen Meyers Konversationslexikon von einem Finsterwalder Privatmann kaufen.
In den Herbstferien 1943 ging es mit etwa den gleichen Kameraden der 8. Klasse wieder zur Lese. Diesmal hängten wir noch 1 Woche dran. Hier hatte ich einen Unfall. Mit der linken Hand fasste ich die Schleuder des stillstehenden Kartoffelroders an. Plötzlich scheuten die Pferde und der Roder fuhr los. Dabei wurde mein Zeigefinger verletzt. Die Hand wurde provisorisch verbunden und in Luckau weiter verarztet. Mit der rechten Hand habe ich dann bis zum Abschluss des Einsatzes noch weiter Kartoffeln gelesen.
Kasernenalltag in der Lehrerbildungsanstalt 1944
Im März 1944 machte Lehrer Semisch von unserer 8. Volksschulklasse auf dem noch schneebedeckten Schulhof der Mädchenschule ein Klassenbild. Anschließend lernten wir, wie man mit der einfachen Kamera fotografiert, den belichteten Film herausnimmt, das Bild auf Papier bringt und fixiert und wie gewässert und getrocknet wird.
Gegen Ende des Krieges gab es Schreibhefte nur noch auf Bezugschein. Wir bekamen von Seelands Mope den Auftrag, in der Aula der Mädchenschule hellblaue Zettel mit einen Stempel und der Beschriftung 1 Heft zu versehen. Ohne einen solchen Bezugsschein bekam man in den Geschäften auch gegen Bezahlung kein Heft. Beim Abschluss der Arbeit wurde die Anzahl der Scheine gezählt. Es kam heraus, dass weniger gestempelte Scheine als vorher leere Zettel vorhanden waren. Viele von uns hatten sich einen oder mehrere dieser nun zu Bezugsscheinen gereiften Papiere beiseite geschafft. Seelands Mope schlug unbarmherzig zu. Im Raum der 8. Klasse in der Nähe des Rektorzimmers im 2. Obergeschoß gab es Schläge nach Strich und Faden. Jeder, der Scheine für sich behalten hatte, musste sich über einen Stuhl legen. Ich weiß noch, dass ich 4 Bezugsscheine hatte. Anschliessend ging ich in das Kartenzimmer. Hier waren schon einige meiner Klassenkameraden versammelt und hielten sich ihren Hintern. Ich bekam 4 Schläge mit dem Rohrstock. Dabei hatte ich Glück, dass der Stock durch die vorhergegangenen Prügel meiner Kameraden kürzer geworden war. Die letzten 1 oder 2 Kameraden sollen wohl ohne Schläge davon gekommen sein. Aus Angst hatten auch einige die Zettel verspeist. Als mein Vater zu Hause die Striemen auf meinem Hintern sah, sagte er nur: „Das geschieht dir recht. Warum machst du so etwas!“
Am 25. März 1944 wurde ich aus der Knabenvolksschule entlassen. Kurz vor dem Ende der Volksschulzeit im März 1944 wurde ich mit meinen Eltern zu einem Besuch bei Rektor Gericke in seine Privatwohnung eingeladen. Als ich mit meiner Mutter bei ihm erschien, schlug er vor, dass ich Lehrer werden sollte. Ich war begeistert, diesen Beruf erlernen zu dürfen und war gleich damit einverstanden. Von der Führung der Hitlerjugend in Finsterwalde bekam ich ein gutes Zeugnis ausgestellt, obwohl ich nur stellvertretender Mitmarschierer war. Anfang April 1944 kam eine Einberufung nach Cottbus zur Aufnahmeprüfung an der Lehrerbildungsanstalt (LBA). Hier wurden fast alle Fächer der Volksschule in schriftlicher und mündlicher Form geprüft. Eine halbmilitärische Übung ist mir noch immer in besonderer Erinnerung. In der Nacht gab es Alarm: „Im Treppenhaus brennt es, alle aus den Fenstern raus.“ Mir war ein bisschen mulmig zumute, zumal wir aus dem 1. Obergeschoß springen sollten. Dabei ahnten wir nicht, dass unten Sprungtücher aufgespannt waren. Ich hatte die Prüfung bestanden und wurde auf die Lehrerbildungsanstalt Paradies geschickt.
Am 24. April ging es mit der Eisenbahn bis zu der kleinen Bahnstation Paradies. Mit mir fuhren noch eine Reihe anderer Jungen. Einige waren schon ein Jahr in Paradies und hatten die Osterferien zu Hause verbracht. Am 25. April 1944 begann meine Ausbildung zum Volksschullehrer in der LBA Paradies. Wenige Tage nach der Ankunft bekam ich den Ausweis, auf den ich damals ganz stolz war. Das Foto muss 1944 in Paradies gemacht worden sein. In Paradies bekam ich auch das erste Mal in meinem Leben eine vollständige Uniform der Hitlerjugend. Paradies war ein altes, mächtiges Zisterzienser-Kloster, das 1236 von Lehnin (Brandenburg) aus in Besitz genommen wurde. 1846 wurde daraus ein katholisches Lehrerseminar. Ab 1939 war es dann eine Lehrerbildungsanstalt mit Internat. Ich kann mich noch an die Grabsteine der dort verstorbenen Lehrer erinnern.
Im April 1944 waren 4 Jahrgänge in der Anstalt. Insgesamt müssen es 250 bis 300 Jugendliche gewesen sein. Die damals 17 bis 18 Jahre alten Schüler im 4. Ausbildungsjahr waren gleichzeitig unsere Hitlerjugendführer. Es fanden jeden Tag halbmilitärische Übungen statt. Wir sangen die damals üblichen Lieder und marschierten durch den benachbarten Ort Jordan. Schießübungen fanden wöchentlich auf einem in der Nähe liegenden Schießstand statt. Außerdem wurde großer Wert auf Sport gelegt und Schwimmen in den vielen Seen der Gegend. Beim Schwimmen ist einmal einer unserer Mitschüler in eine Schlingpflanze geraten und wäre fast ertrunken. Die wenige Freizeit verbrachten wir meistens an einem ganz in der Nähe gelegenen sehr schönen See.
Der Tag verlief wie in einer Kaserne. Wir wurden morgens um 7.00 Uhr mit Fanfarensignalen geweckt. Alles stürzte in den Waschraum, um noch ein Becken zu bekommen. Wer Pech hatte, musste Anstehen. Das kostete Zeit und ging vom Bettenbauen und Spindherrichten ab. Oft ergab die Überprüfung Mängel und man musste Bettzeug und Wäsche noch einmal sorgfältig aufschichten. Dann ging es zum morgendlichen Appell mit Antreten auf dem Pausenhof und anschließend im Marschschritt zur Kantine, die sich in einem besonderen Gebäude befand. Die erste Zeit bin ich nie satt geworden, da ich zu Hause nicht gelernt hatte, mit Messer und Gabel zu essen. Besonders schlimm war es, wenn ich Tischdienst hatte. Zum Toilettengebäude ging es etwa 50 Meter über den Hof. Das wirkte sich nachteilig für die Schüler aus, die nachts mal raus mussten. Erst über die langen Gänge vom Schlafsaal und dann über den mit Bäumen bestandenen Pausenhof. Vormittags fand der Unterricht nach Lehrplan statt, nach dem Mittagessen wurden die Hausaufgaben erledigt, dann kam die Hitlerjugend zu ihrem Recht. So ging das täglich. Ein besonders Ereignis war für uns ein Besuch in Lagow, der angeblich kleinsten Stadt Deutschlands. Ich kann mich noch an die schöne Landschaft mit dem Städtchen am See erinnern. Hier trafen wir auf den Boxer Leo Pinetzki in Wehrmachtsuniform. Den sportlichen Vergleich pflegten wir mit den Schülern einer NAPOLA. Ich denke, dass die in Meseritz war. Ein Handballspiel gewannen wir damals. Ich war froh als die großen Ferien Ende Juli begannen. So einen Drill und Stress war ich nicht gewöhnt.
Nach den großen Ferien Ende August 1944 konnten wir nicht mehr ins Kloster zurück, weil es als Militärmagazin gebraucht wurde. Wir wurden dafür zum Schippeinsatz nach Jordan geschickt. Dort mussten wir nach Anweisung von Wehrmachtsoffizieren mit Schaufel und Spaten Lauf- und Panzergräben ausheben. In einer zugigen Bauernscheune, auf Stroh und mit entsprechenden Decken, fanden wir unser Nachtlager. Ich hatte das Pech, einen Schlafplatz in der Nähe der Scheunentür zu bekommen, wo immer ein leichter Windzug zu spüren war. Dadurch und durch die ungewohnten Bewegungen beim Schippen bekam ich schon nach kurzer Zeit einen Hexenschuss. Ich wurde in das einfache Lazarett von Jordan, eine ungenutzte Volksschule, gebracht. Kaum dort bekam ich auch noch eine doppelseitige Mittelohr-Endzündung. Ich konnte nichts mehr hören und man musste sich mit Hilfe von Handzeichen mit mir verständigen. Diese Krankheit hat bis heute ihre Spuren hinterlassen. Als man mir in dem provisorischen Lazarett nicht mehr helfen konnte, sollte ich mit einem anderen Kranken zur weiteren Behandlung nach Meseritz. Wir wurden beide zum Bahnhof geschickt, um mit dem nächsten Zug zu fahren. Auf dem Bahnsteig war es unheimlich kalt. Der Zug hatte unbestimmte Verspätung, also gingen wir in das Bahnhofsgebäude. Das war ein Fehler, denn als wir wieder nach draußen kamen, waren von unserm Zug nur noch die Schlusslichter zusehen. Also wieder zurück ins Lazarett. Hier bekamen wir einen gehörigen Anschiss. Da wir nichts hörten, konnten wir nur an den Gebärden unserer Vorgesetzten erkennen, dass sie mit uns nicht zufrieden waren. Am nächsten Tag ging ein Aufpasser mit, der dafür sorgte, dass nichts mehr schief lief. Im Lazarett wurden mir beide Ohren mit Rotlicht bestrahlt. Die Verständigung ging anfangs auch hier nur über Gesten und entsprechende Fingerzeige. Nach etwa 14 Tagen lösten sich die Vereiterungen in beiden Ohren. Ich konnte wieder hören. Anfang Oktober bin ich mit der Bahn nach Finsterwalde zurückgefahren. Damit war für mich der Schippeinsatz 1944 beendet.
Zu Hause lag schon ein Bescheid, dass die Ausbildung an der LBA Paradies vorübergehend in Streckenthin in Pommern weitergehen soll. Im Oktober 1944 fuhren wir mit der Bahn nach Latzig/Thuno. Von hier aus ging es im Fußmarsch zum Schloss Streckenthin. Im Schloss des Ritterguts wurden wir zusammen mit nur noch 2 Jahrgängen mit etwa 120 bis 150 Kameraden untergebracht. Das Schloss und auch das dazugehörige Herrschaftshaus lagen landschaftlich sehr schön an einem See. Das Gut mit den Ställen war etwas abseits. Das Schlossgebäude war eigentlich für eine LBA wenig geeignet. In den Schlafräumen waren Doppel-Stockbetten aufgestellt. Die täglichen Streiche in den schmalen Gängen nahmen kein Ende. Häufig flog der obere Schläfer auf den unteren oder auf den Gang, weil jemand heimlich die Auflagebretter entfernt hatte. Und das alles beim Abendappell. Täter wurden gesucht, aber nie gefunden. Die Toiletten hielten der neuen Belastung nicht stand. Verstopfungen der Rohrleitungen und der Beckenabläufe waren an der Tagesordnung. Sehr bald mussten im nahe liegenden Wald Gruben ausgehoben und sogenannte Donnerbalken eingerichtet werden. In den Monaten November und Dezember keine angenehme Angelegenheit. Der Weg war noch länger als in Paradies. Die Räume für nur noch 4 Klassen waren notdürftig für den Unterricht hergerichtet worden. Da es jetzt auch an Lehrkräften mangelte, konnten nicht mehr alle Fächer unterrichtet werden. Außerdem fehlte Lehrmaterial. An den Hitlerjugend-Übungen hatte sich gegenüber Paradies nichts geändert. Die Versorgung mit Lebensmitteln erfolgte aus dem in der Nähe liegenden Gut des Schloss Streckenthin.
Kurz vor Weihnachten 1944 fuhr ich mit der Bahn heim nach Finsterwalde. In Stettin konnte ich noch weiße Finnland-Ski ergattern. Das war sozusagen mein Weihnachtsgeschenk. So konnte ich das letzte Mal vor Kriegsende Weihnachten zu Hause bei meinen Eltern verbringen. Dabei war es mir das erste Mal in meinem Leben möglich mit eigenen primitiven Brettern Ski zu fahren.
Wegen Fahnenflucht erhängt 1945
Am 5. Januar 1945 ging es wieder mit der Bahn und zu Fuß nach Streckenthin. Die Bahn fuhr noch einigermaßen regelmäßig. Im Januar und Februar hatten wir noch Unterricht und den üblichen Hitlerjugend-Drill. Am 31. Januar bekamen wir sogar noch ein Zeugnis für das 1. Halbjahr 44/45.
Jeden Abend wurden die Wehrmachtsberichte über den Verlauf der Kämpfe und die Lage der Frontlinie von einem Schüler im Gemeinschaftsraum verlesen. Ende Februar erreichte die russische Armee die Oder. Am 1 März 1945 teilte uns der Direktor in einer Versammlung mit, dass die gesamte Schule die Flucht antreten muss, um nicht vom Rückweg abgeschnitten zu werden.Zunächst ging es zu Fuß in Richtung Bahnhof Latzig/Thuno. Die Hoffnung auf einen Zug mussten wir aufgeben. Hier trennte ich mich schweren Herzens von einem Holzkoffer, den mein Vater angefertigt hatte. Er war mir einfach zu schwer geworden. Wichtige Sachen wie Zeugnisse, Ausweis, Decke, Zeltplane und etwas zu essen kamen in den mitgeführten Tornister. Wir kamen am 3. März zu Fuß in Kolberg an. Ich sah um die Stadt herum Schützengräben mit wenigen Soldaten. Hier einen Platz auf einem Schiff zu ergattern war ebenso aussichtslos wie das Fortkommen mit der Bahn. Was blieb uns weiter übrig, als den Fußmarsch in Kolonne fortzusetzen. Kolberg wurde am 18.03.1945 von den Russen eingenommen.
Von Kolberg ging es zunächst nach Treptow in eine Lehrerbildungsanstalt. Es gab ein letztes gemeinsames warmes Essen. Beim Essen teilte uns der Direktor mit, dass es keinen Sinn mehr mache, geschlossen weiter zu marschieren. Jeder sollte sich alleine durchschlagen. Nächster Treffpunkt war eine Pension im Kurbad Bansin auf Usedom. Mit einem Kameraden machte ich mich auf den Weg in Richtung Westen. Auf dem Bahnhof Treptow stand ein Eisenbahnzug mit Verwundeten, der nicht weiterfahren konnte. Wir konnten noch sehen, wie hinter uns der Kirchturm zerschossen wurde. Unterwegs hatten wir das große Glück, dass uns ein Tanklaster ein großes Stück mitnahm. Krankenschwestern vom Verwundetenzug rannten um ihr Leben und kamen mit uns. Wir fuhren vorbei an einem endlosen Treck flüchtender Menschen mit Pferdefuhrwerken, Handwagen, auf Fahrrädern und zu Fuß. Später mussten wir von unserm Laster absteigen und zu Fuß oder mit requirierten Fahrrädern weiterkommen. In einem verlassenen Bauernhof konnte ich meinen Proviantvorrat durch einen geräucherten Schinken aufbessern, was mir später noch sehr helfen sollte. In einer Kleinstadt sahen wir zwei aufgehängte Wehrmachtsangehörige. Sie hatten ein Schild um den Hals hängen mit der Aufschrift Wegen Fahnenflucht erhängt.
Über Wollin und Swinemünde kamen wir am 6. März 1945 in Bansin in der Pension an, die als Treffpunkt ausgemacht war. Hier waren schon einige von unsern Mitschülern eingetroffen. Andere habe ich nie mehr wieder gesehen. Es gab nur sparsame Verpflegung. Mein Schinken half mir übers Gröbste hinweg. Es war klar, dass wir weiter mussten. Schon vor dem großen Bombenangriff auf Swinemünde am Mittag des 12. März wurden wir in einem Güterwaggon über Umwege nach Celle bei Hannover verfrachtet. Die Fahrt hat mindestens 2 Tage gedauert. In Celle angekommen gingen wir zur dortigen LBA. Hier wurden wir auf Privatquartiere verteilt. Mit meinem Kameraden wurde uns ein Zimmer im Dachstock eines mehrgeschossigen Wohnhauses in der Nähe vom Bahnhof zugewiesen. Ordentlicher Unterricht fand nicht mehr statt. Verpflegung gab es in der Anstalt. Reguläre Schüler dieser Anstalt haben wir nicht mehr kennengelernt. Die waren wohl schon beurlaubt als wir ankamen.
Am 8. April 1945 in der Mittagszeit ertönten die Sirenen. Wir gingen sofort in den Luftschutzkeller unseres Hauses. Hier waren schon andere Hausbewohner versammelt. Wir hatten uns noch nicht richtig niedergelassen, als die ersten Bomben auf den Bahnhof und die schöne Altstadt fielen. Es gab mächtige Erschütterungen. Alle hofften, hier wieder lebendig herauszukommen. Nach kurzer Zeit kamen 2 Häftlinge in blau gestreifter Kleidung zu uns in den Keller, wenig später ein Angehöriger der SS-Wachmannschaft. Er verprügelte die beiden mit seinem Gewehrkolben und alle sahen sprachlos zu. Das war für mich ein Erlebnis, das ich nie vergessen habe. Später erfuhren wir, dass es Häftlinge aus dem Konzentrationslager Neuengamme waren, die zum KZ Bergen-Belsen gebracht werden sollten. Der Zug stand auf einem Abstellgleis des Güterbahnhofs. Zu allem Überfluss standen auch noch Züge mit Munition und Verwundeten im Bahnhof. Man kann sich vorstellen, was da los war. Von den 4000 KZ-Häftlingen sollen nur etwa 400 überlebt haben. Nach dem Angriff stellten wir fest, dass unser Wohnhaus noch stand, aber auf meinem Kopfkissen lag ein zentnerschwerer Stein. Mein Leben wäre da sicher zu Ende gewesen. So schnell wie möglich verließ ich mit meinem Kameraden Celle. Wir wollten auf jeden Fall nach Hause.
Wir machten uns zunächst zu Fuß auf den Weg in Richtung Potsdam. Die Straßen waren in allen Richtungen voll von Flüchtlingen. Als wir noch nicht richtig von Celle weg waren, kamen Jagdbomber und beschossen die Straße. Vor lauter Angst schmissen wir uns sofort in den Straßengraben. Der Angriff dauerte Gott sei Dank nicht lange. Tote und Verwundete haben wir nicht gesehen. Am 10. April kamen wir in Potsdam an. Unser Weg führte uns natürlich in die dortige LBA. Da fand tatsächlich noch Unterricht statt. Hier mussten wir beide berichten, wo wir herkamen und was uns so alles widerfahren war. Der Aufenthalt war nur kurz, wir wollten einfach heim. Unsere Wege trennten sich nun. Ich zog weiter in Richtung Finsterwalde, mein Kamerad wollte nach Frankfurt/Oder.
Ich hatte das große Glück, von einem Wehrmachtslastwagen mitgenommen zu werden. In Torgau war unsere Fahrt zu Ende. Hier hörte ich, dass die Russen Finsterwalde schon eingenommen hätten. Ich wollte keinesfalls den Russen in die Hände fallen. So entschloss ich mich, in Richtung Gera zu marschieren. Da wohnte eine Schwester meiner Mutter. Zwischen Elbe und Mulde war damals ein militärisch freier Raum und ich kam ohne Schwierigkeiten bis an die Mulde. Auf der Westseite waren zu der Zeit schon die Amerikaner. Südlich von Wurzen wollte ich dann über die Mulde. Die Amerikaner müssen mich auf der anderen Seite beobachtet haben. Ich wurde gleich in Empfang genommen. Mein Tornister wurde sofort auseinander genommen. Die Uhr wurde mir abgenommen, obwohl die meisten schon den Arm voller Uhren hatten. Die dreieckigen Zeltplanen und eine Decke durfte ich behalten.
Jetzt ging es über verschiedene amerikanische Armeestellen in privaten Wohnhäusern in Richtung Westen. Hierbei stand ich unter dauernder Bewachung eines Soldaten. Hin und wieder bekam ich die typische amerikanische Militärverpflegung in Büchsen. An einer Stelle musste ich eine Grube für Abfall ausheben. Von einer Sammelstelle aus kam ich zusammen mit anderen Gefangenen in ein großes Gefangenenlager bei Bad Hersfeld. Die Fahrer der LKWs waren Farbige, die wie verrückt fuhren. Wir hatten immer Angst, dass der Wagen umkippte. Es wurde, je nachdem wie die Kurve war, immer geschrien: „Nach rechts legen, nach links legen!“
In dem Gefangenenlager waren tausende von Männern versammelt. Die meisten waren Wehrmachtsangehörige, aber auch Jungen mit der Einkaufstasche landeten hier. Gegen Ende April 1945 wurden alle mit der Bahn von Bad Hersfeld nach Bad Kreuznach transportiert. Vom Bahnhof Bad Kreuznach mussten wir durch die Stadt mit amerikanischen Wachleuten links und rechts der Kolonne zum Lager Bretzenheim marschieren. Von weitem sah man schon die Toten, die wie Sandsäcke aufgestapelt am Eingang lagen. Wenn es zu langsam voran ging, riefen die Amerikaner: „Come on, boys, Come on boys!“ Ich höre sie noch heute manchmal schreien. Das Gefangenenlager bestand aus mit Doppelzäunen umgebenen Ackerflächen unter freiem Himmel. Die Äcker waren zum Teil noch mit Gründüngung bestellt oder auch gepflügt. Das ganze Lager hatte vielleicht 20 Camps. Es waren auch Frauencamps darunter. Der gesamte Transport eines Zuges wurde in einem neuen Camp untergebracht. Hier bekamen wir die typische amerikanische Wehrmachtsverpflegung, jeder einen Karton mit Büchsen, Schokolade, Zigaretten und vieles mehr. In den folgenden Tagen wurden alle Gefangenen auf SS-Zugehörigkeit, ein eingebranntes Zeichen unter dem rechten Arm, untersucht. Danach erfolgte eine Aussortierung.
Das Schlimmste war das Campieren unter freien Himmel. Wenn es regnete, war das Lager eine Schlammwüste, alles klebte an den Füßen. Schlimmes spielte sich um die hastig ausgeschaufelten offenen Gruben zur Verrichtung der Notdurft ab. Fast jeden Tag mussten Tote aus den mit Fäkalien gefüllten Löchern geholt werden. Später wurden Holzkästen drüber gestellt, so dass keiner mehr hineinfallen konnte. Andere starben in ihren mit der Hand ausgebuddelten Erdhöhlen. Ich hatte das große Glück, noch die dreieckigen Zeltplanen und eine Decke zu besitzen. Die Suche nach ähnlichen Planen war erfolgreich. Mit zwei anderen Lagerinsassen, für mich völlig fremden Menschen, konnten wir jetzt ein Zelt bauen. Ein Stock wurde noch irgendwie organisiert. Jetzt waren wir wenigstens etwas geschützt und konnten nachts einigermaßen schlafen. Hier lernte ich erstmals Kleiderläuse kennen. Sie setzten sich besonders in Stricksachen fest, Jucken und Striemen auf der Haut waren die Folge. Man war den ganzen Tag mit Knacken beschäftigt. Eines schönen, trockenen Tages mussten wir uns alles ausziehen und auf die Erde legen. Anschließend wurden unsere Körper und die gesamte Kleidung mit einem weißen, staubförmigen Pulver eingenebelt. Wir sahen aus wie Mehlmänner.
Ende Juni 1945 übernahmen die Franzosen das Lager. Die Verpflegung wurde wesentlich schlechter, z.B. erhielten 20 Mann ein Vierpfund-Brot. Die Aufteilung mit einer gebastelten Waage führte zu unvorstellbaren Streitigkeiten. Außerdem fand jetzt auch eine weitere Selektierung der Insassen in den einzelnen Camps statt. Die über 16jährigen kamen nach Frankreich oder auch nach Belgien zur Zwangsarbeit in Kohlengruben oder in die Landwirtschaft.
Am 25. Juli 1945 wurde ich als 15jähriger entlassen. Nach Aushändigung des Entlassungsscheins konnte ich zu Fuß das Lager verlassen. Mit einem Kameraden machte ich mich auf den Weg. Mit dem Entlassungsschein konnte man alle Verkehrsmittel frei benutzen. Transporte in die damalige sowjetische Besatzungszone waren allerdings nicht möglich. Als wir aus dem Lager kamen, wurden wir von der Bevölkerung herzlich empfangen. Ich weiß noch, dass wir zu essen bekamen und jede Menge Wein direkt vom Fass. Das war unser Untergang. Völlig betrunken haben wir die erste Nacht im Straßengraben zugebracht. Wir sahen, wie deutsche Kriegsgefangene aus Norwegen in Marschkolonne auf der Straße vorbeigeführt und in das Gefangenenlager gebracht wurden. Die Wehrmachtsangehörigen schrien immerzu den am Straßenrand stehenden Frauen zu: „Poussiert ihr auch mit Negern?“ Wie wir später erfuhren, wurden die meisten von ihnen zu Zwangsarbeiten nach Belgien und Frankreich gebracht.
Vom Bahnhof Bretzenheim fuhren mein Kamerad und ich am 27. Juli 1945 mit der Bahn zunächst nach Frankfurt/Main. Da wir beide aus der besetzten Sowjetzone stammten, versuchten wir einen Zug nach Leipzig zu bekommen. Das war aber nicht möglich. Wir kamen nur bis Homberg in Hessen. Hier standen junge Mädchen am Bahnhof, die uns baten, ihnen bei der Ernte zu helfen. So kamen wir nach Appenrod. Zunächst war ich beim Bauer Leihmeister, später dann aber bei Bauer Büttner. Deren Söhne waren noch nicht heimgekehrt oder im Krieg gefallen.
Hier lernte ich erstmals das Leben und Arbeiten auf einem Bauernhof kennen. Als erstes kam die Getreideernte. Da wurden auf den Feldern sogenannte Puppen, bestehend aus 8-10 Garben, aufgestellt. Wegen ungünstigen Wetters verzögerte sich die Abfuhr zum Bansen in der Scheune. Manche Ähren waren schon grün geworden und schlugen aus. Dann kam Grummet-Ernte. Mit Gabeln wurde das Heu auf Leiterwagen aufgeladen. Anschließend musste mit großen Rechen die Wiese geharkt werden. Es durfte nichts liegen bleiben. Dann ging es auf den Rübenacker. Die schwarzen Hände waren über Wochen nicht mehr sauber zu kriegen. In den Monaten Oktober/November wurden die in der Scheune liegenden Garben gedroschen. Hierzu wurde die von einer Dampfmaschine angetriebene Dreschmaschine von Bauernhof zu Bauernhof gefahren. Für das Dreschen wurden die Garben von Hand in Etappen zur Dreschmaschine befördert und eingegeben. Die angehängten Säcke an der Dreschmaschine, die jetzt voll mit Getreide waren, mussten auf den Boden des Wohnhauses getragen werden. Das war Schwerstarbeit. Das anfallende Stroh wurde zu Ballen gepresst und in der Scheune gestapelt. Bei dieser Drescharbeit gab es eine unheimliche Staubentwicklung. Für das Dreschen waren bis zu 25 Leute nötig, wobei sich die Bauern gegenseitig halfen. Beim Bauern Büttner war ich während der gesamten Zeit von September bis zu meiner Rückkehr Ende November nach Finsterwalde neben der Hilfe bei der Ernte für die Betreuung seiner etwa 15 Kühe und mehrerer Stück Jungvieh zuständig. Hierzu gehörten das Misten, Einbringen von neuer Streu, die Pflege der Kühe und vor allen Dingen das Melken. Ich habe viele bäuerliche Arbeiten gelernt, wollte aber trotzdem nie Landwirt werden.
Im Laufe des November 1945 bekam ich die erste Post von meiner Mutter aus Finsterwalde. Sie teilte mir mit, dass mein Vater am 8. November verstorben war. Ich versuchte, nun bald nach Hause zu kommen. Die Angst vor den Verhältnissen in der damaligen Sowjetischen Besatzungszone war immer noch vorhanden. Trotz allem trat ich am 27. November 1945 die Heimreise vom Bahnhof Homberg mit der Bahn über Leipzig nach Finsterwalde an. Die Bahn fuhr damals in diese Richtung nicht sehr häufig. Mit dem Pferdefuhrwerk brachte man mich zum Bahnhof. Bauer Büttner, bei dem ich die ganze Zeit tätig war, gab mir ausreichend Verpflegung für unterwegs und als Geschenk für daheim mit.
In Finsterwalde bin ich gut angekommen, trotz der Kontrollen durch die Russen an der Grenze zur Zone. Die Freude bei meiner Mutter und den Verwandten war groß. Von dem Mitgebrachten konnten sich alle mal richtig satt essen. Am 1. Dezember 1945 begann meine Lehrzeit als Bau- und Möbeltischler beim Tischlermeister Karl Marx.