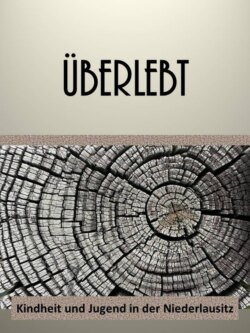Читать книгу Überlebt - Marion Hein - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Fragen und die richtigen Antworten
ОглавлениеWer ist der Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe?
Generalfeldmarschall Hermann Göring
Wer führt das Nationalsozialistische Fliegerkorps?
Generalleutnant Christiansen
Wer war der Rote Kampfflieger? Manfred Freiherr von Richthofen
Seit wann besteht die Deutsche Lufthansa?
Seit 1926
Wie heißt Deutschlands größtes Landflugzeug?
Der "Große Dessauer"
Wieviel Stundenkilometer beträgt der deutsche Flugschnelligkeitsrekord?
634 Stundenkilometer
Wer stellte diesen Rekord auf?
General Udet
Wer ist deutscher Kunstflugmeister?
Feldwebel Falderbaum
Wie heißt Deutschlands erster weiblicher Flugkapitän?
Hanna Reitsch
Welcher Tag wurde zum Tag der deutschen Luftwaffe erklärt? Der 1. März
Der einmotorige Hochdecker vom Typ Messerschmitt M20 hatte einen wassergekühlten 12-Zylinder-BMW-Motor mit einer Leistung von 700 PS und beförderte mit 2 Mann Besatzung 10 Passagiere bis zu 1170 km weit. Er flog 190 km/h schnell, die maximale Flughöhe betrug 4800 m und die Fluggäste konnten während des Fluges, wie in einem Auto, die Fenster öffnen! Ein besonderer Luxus war die Bord-Toilette.
Mein selbstgebasteltes Radio 1940 bis 1944
Ich habe mich schon im Alter von knapp zehn Jahren für technische und naturwissenschaftliche Dinge interessiert. Meine Eltern schenkten mir zu Weihnachten mehrmals das technisches Jahrbuch Das Neue Universum, das ich mit viel Begeisterung las. Dann kamen alte Physikbücher mit Anweisungen für die Durchführung einfacher physikalischer Experimente dazu. Wie man mit einer rotierenden Schallplatte Hochspannung erzeugen oder mit zwei Pappbechern und einer langen Schnur telefonieren kann. Wie man eine Blechplatte zum Schwingen brachte, so dass sich daraufgestreutes Korkmehl zu wunderlichen Figuren arrangierte oder wie man mit einem Bleiglanzkristall, einer Drahtspule und einem aus Glimmerblättchen und Silberpapier gefertigten Kondensator Radiowellen empfangen konnte.
Später erstand mein Vater für mich ein dickes dreibändiges Lehrbuch der Rundfunktechnik, das ich gründlich studierte. Dabei lernte ich eine Menge und es war ein unbeschreibliches Erlebnis, als ich es zum ersten Mal schaffte, mit Hilfe von ein paar zusammengebettelten Bauteilen und mit Draht- und Blechstücken, die auf eine Zigarrenkiste montiert waren, eine Rundfunksendung zu empfangen. Dazu brauchte man keinen Netzanschluss und nicht einmal eine Batterie!
Mein Zimmer verwandelte sich bald in eine Werkstatt und die Empfangsqualität wurde immer besser, nicht zuletzt dank einer riesigen Antenne, die ich vom Giebel unseres Hauses bis zu einem benachbarten hohen Baum gespannt hatte. Der simple Kristalldetektor, mit dem man Radio hören konnte, wurde bald durch Besseres ersetzt. Ich lernte, wie man Rundfunkgeräte und Verstärker mit Vakuumröhren baut, gläsernen, glühlampenähnlichen Gebilden, aus denen die Luft abgepumpt war und in denen ein feiner Glühdraht und etliche passend geformte Bleche und Drahtnetze dafür sorgten, dass Musik und Sprache, die über die Rundfunkwellen vom fernen Sender ins Haus kamen, hörbar gemacht wurden. Eine faszinierende Sache. Heute haben Radios und andere elektronische Geräte keine Röhren mehr, deren Aufgabe haben Transistoren übernommen. Sie arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie mein alter Kristalldetektor funktionierte. Bald unternahm ich auch Sendeversuche, was streng verboten war. Ich war überglücklich, als mein Klassenkamerad Günter ein paar Häuser weiter die von mir ausgesandten Signale empfangen konnte.
Für das Abhören feindlicher Sender wurden während des Krieges empfindliche Strafen angedroht. Ab und zu kontrollierten Parteifunktionäre unangemeldet die Einstellung der Rundfunkgeräte in den Wohnungen, weshalb wir mit dem Volksempfänger in unserm Wohnzimmer immer nur den Großdeutschen Rundfunk hörten. Aber in meiner Bastelbude, in der sich kein Uneingeweihter zurechtfinden konnte, hörte ich regelmäßig die für Deutschland bestimmten Sendungen des BBC. Sie wurden mit einem Paukensignal angekündigt, das an das Eingangsmotiv von Beethovens Fünfter Symphonie erinnerte Bumm, bumm, bumm – bumm.
Hierbei mischte sich der Reiz, etwas streng Verbotenes zu tun, mit der Freude über das technisch Erreichte. Allerdings glaube ich nicht, dass die politischen Botschaften, die ich hörte, mich sehr beeindruckten. Unter dem Einfluss der pausenlos auf uns einhämmernden Nazi-Propaganda wäre es mir damals schon lieber gewesen, wenn die Deutschen gesiegt hätten! Die Eltern machten bald nachdenkliche Gesichter, aber sie hüteten sich natürlich in unserer Gegenwart vor defätistischen Äußerungen.
Es gab aber auch ganz praktische Nachrichten. Viel präziser als durch die offiziellen Wehrmachtsberichte erfuhr man durch den Feindsender, wie die Front verlief und wie schnell in den Jahren 1944/45 die alliierten Truppen im Osten und im Westen vorrückten.
BBC meldete genau, welche deutschen Städte in den letzten Stunden von englischen und amerikanischen Bombern angegriffen worden waren. Es gab Angst und Aufregung, als ich eines Abends hörte, dass der Stadtkern von Düsseldorf heftig bombardiert worden war. Da unser Vater an diesem Tag dienstlich in Düsseldorf zu tun hatte und in der Innenstadt wohnte, machten wir uns große Sorgen um ihn. Tatsächlich konnte er sich nur mit Mühe unverletzt aus dem zugeschütteten Keller seines völlig zerstörten Hotels retten.
In der HJ, einer politischen Jugendorganisation, musste damals jeder Junge mindestens einmal die Woche Dienst tun, um mit Uniform und militärischem Drill auf das Naziregime eingeschworen und auf das Militär vorbereitet zu werden. Für die Vierzehnjährigen gab es neben der allgemeinen HJ eine spezielle Flieger-HJ für spätere Jäger- und Bomberpiloten und eine Marine-HJ, in der künftige U-Bootfahrer gedrillt wurden.
Ich kam 1944 in die Nachrichten-HJ, wo Funker und Telefonisten für ihren Dienst in der Wehrmacht geschult werden sollten. Hier sah ich endlich all die Technik, von der ich so viel gelesen hatte: Telefone und Funkgeräte, Peilsender und Morsetasten. Erfahrene Fachleute zeigten uns nicht nur, wie man die Geräte bedient, sondern auch wie sie funktionieren. Ich muss gestehen, dass ich immer gern in diesen Dienst gegangen bin. Ich wurde mit einigen anderen im Juli 1944 für drei Wochen in eine Funkerschule der Wehrmacht nach Dievenow an der Odermündung geschickt. Ich beherrsche das Morsealphabet, das man uns dort eingebläut hat, noch heute.
Nach dem Einmarsch der Roten Armee mussten alle Rundfunkgeräte abgeliefert werden. Die Radiobastelei wurde eingestellt, das obere Stockwerk unseres Hauses, in dem ich mein Quartier hatte, wurde vorübergehend mit befreiten Ostarbeitern belegt. Aber das Interesse an der Radiotechnik blieb wach und half später sogar eine Zeitlang beim Aufbessern unserer kärglichen Lebensmittelrationen.
Acht geschenkte Jahre 1945
Es war das Frühjahr 1945, der Krieg näherte sich seinem Ende. Die Russen standen an der Oder, die Amerikaner und ihre Verbündeten hatten den Rhein überschritten, der Krieg aus der Luft hatte ein unvorstellbares Ausmaß angenommen. Keine größere Stadt war von Bombenangriffen verschont geblieben. Die Zentren der Großstädte waren schon weitgehend zerstört.
Dabei hatte 1939 alles so glorreich angefangen. Deutsche Truppen hatten die überraschten Polen in weniger als drei Wochen überrannt, Frankreich wurde in nicht einmal zwei Monate besiegt und dabei waren Holland, Belgien und Luxemburg gleich mit eingenommen worden. Mit Dänemark und Norwegen wurde kurzer Prozess gemacht, auf dem Balkan und in Griechenland standen deutsche Truppen und die Panzerarmeen des Generalfeldmarschalls Rommel jagten die Engländer durch den nordafrikanischen Wüstensand. Siege allenthalben. Hermann Göring, der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, erklärte, er wolle Meier heißen, wenn auch nur ein feindliches Flugzeug in den deutschen Luftraum eindringen sollte. Er schickte dafür seine Bomber nach Holland und England, um Rotterdam und Coventry auszuradieren, wobei Tausende Zivilisten ums Leben kamen.
Doch als die größenwahnsinnigen deutschen Führer 1941 auch noch Russland überfielen und den fernen Vereinigten Staaten den Krieg erklärten, wendete sich das Blatt. Göring wünschte, er hätte sein großmäuliges Versprechen nie gegeben. Denn jetzt nahmen die Alliierten blutige Rache für Coventry. Ihre Bombergeschwader luden Tonnen um Tonnen ihrer tödlichen Fracht auf deutsche Städte ab. Zunächst nur bei Nacht und deshalb galt in Deutschland ein striktes Verdunkelungsgebot. Alle Fenster mussten lichtdichte Läden oder Jalousien haben. Die Straßenlampen wurden gelöscht. Die Autos bekamen schwarze Hauben mit schmalen Schlitzen über die Scheinwerfer gestülpt, durch die nur ein schwacher Lichtschimmer auf die Fahrbahn fiel. Sehr populär wurden Leuchtplaketten zum Anstecken, die ein ganz schwaches Licht verbreiteten und vor unbeabsichtigtem Anrempeln auf den unbeleuchteten Straßen einigermaßen schützten.
Die alliierten Bomber fanden ihren Weg auch ohne Lichter vom Boden mit Hilfe von Funk- und Radar-Signalen. Die deutsche Luftabwehr versuchte sich ihrer mit Jagdflugzeugen und Flugabwehrkanonen zu erwehren. Doch die Übermacht war zu groß. Ab 1944 gab es kaum noch Jagdflugzeuge, und die Flak-Geschütze konnten nicht mehr viel ausrichten. Sie wurden von sechzehn- bis siebzehnjährigen Jungen bedient, weil die erfahrenen Kanoniere an der Front gebraucht wurden.
Es gab ein ausgeklügeltes Warnsystem, dem man folgen musste, um vor den Bomben einigermaßen geschützt zu sein. Zunächst kamen über Drahtfunk Luftlageberichte. Eine monotone Stimme verkündete im Radio, dass zum Beispiel feindliche Verbände im Anflug auf Berlin seien. Nach einer Weile gab es Voralarm, drei lang gezogene Sirenentöne. Wenn das während der Schulzeit passierte, wurde der Unterricht abgebrochen und wir mussten nach Hause rennen. In den Fabriken liefen nur noch die wichtigsten Maschinen, die Menschen flüchteten von den Straßen in die Häuser. Beim Hauptalarm, ein an- und abschwellendes Sirenengeheul, mussten die Schutzräume aufgesucht werden, die in jedem Haus eingerichtet waren. Wenn die Gefahr vorüber war, gab es Entwarnung, drei Minuten lang ein hoher Sirenenton.
Finsterwalde ist bis zum Frühjahr 1945 nie aus der Luft angegriffen worden, aber es gab oft Alarm. Manchmal waren wir neugierig und wagten uns trotz strenger Verbote an die Fenster oder sogar ins Freie. Ich habe die Bomber in den letzten Kriegsmonaten oft gesehen, wie sie in großer Höhe über unsere Stadt flogen, um eine chemische Fabrik im Süden von Finsterwalde zu bombardieren, in der aus Braunkohle Flugbenzin gemacht wurde. In den letzten Kriegswochen griffen tagsüber allerdings nicht nur Bomber die deutschen Städte an, sondern auch schnelle, tieffliegende, einsitzige Kampfflugzeuge. Sie kamen wie der Blitz vom Himmel, schossen auf alles, was sich auf Straßen und Feldern bewegte und donnerten wieder davon.
Im März 1945, kurz vor meinem fünfzehnten Geburtstag, standen meine Schwester Anneliese und ich an einem Sonntagmorgen im Garten vor unserem Haus. Plötzlich hörten wir weit in der Ferne Maschinengewehrfeuer. Es kam von Norden, und wir suchten verwundert nach der Ursache, als ein winziges silberglänzendes Ding am fernen Himmel auftauchte. Anneliese rief: „Tiefflieger!“ und riss mich um die Hausecke. Das Ding war wenige Sekunden später schon bei uns und raste in etwa fünfzig Meter Höhe über unser Hausdach. Auf der Wiese, auf der wir gestanden hatten, sprang eine Erdfontäne hoch, dann hörte man nur noch das leiser werdende Geräusch des Fliegers. Im hölzernen Rahmen eines Fensters im ersten Stock unseres Hauses fanden wir später einen Metallsplitter, der stammte von der kleinen Granate, die aus der Bordkanone des Tieffliegers auf uns abgeschossen worden war.
Am 19. April, wenige Tage vor dem Einmarsch der Russen in Finsterwalde, gab es noch einmal Luftalarm. Ich erinnere mich noch genau an den sonnigen Frühlingstag. Bäume und Büsche blühten, die Vögel zwitscherten friedlich. Es war um die Mittagszeit, als meine Schwester und mich Motorengeräusche aus dem Haus lockten. Es kam aus nördlicher Richtung. Und dann sahen wir sie: zehn, zwanzig, fünfzig, vielleicht noch mehr silberne Flugzeuge, die in penibler Ordnung, ohne von Flak oder Jägern gestört zu werden, in großer Höhe über unsere Stadt flogen.
Sie flogen Richtung Südsüdwest, also nicht wie sonst zur Brabag (Braunkohle-Benzin-AG ). Das monotone Geräusch ihrer Motoren wurde immer stärker. Bis plötzlich in der Nähe Bomben einschlugen. Wie sich später herausstellte, riss eine einen gewaltigen Trichter in das Straßenpflaster. Eine Bombe explodierte unterhalb der Gleisböschung und richtete Dach- und Fensterschäden an. Ein Treffer zerstörte das Wohnhaus eines Malermeisters und tötete eine Umsiedlerin. Es blieb bei ein paar Krachern. Offenbar handelte es sich bei diesem Bombardement um einen Irrtum. Gemeint waren Bahnhof und Bahnanlagen im 20 km entfernten Elsterwerda, aber ein eifriger Bombenschütze hatte wohl, als er den Bahnhof von Finsterwalde unter sich sah, ein bisschen zu früh auf den Auslöseknopf gedrückt. Ich habe in Elsterwerda mit Leuten gesprochen, die sich noch nach über fünfzig Jahren mit Schaudern an diesen 19. April erinnern.
1945 ging der Krieg zu Ende, der ganz Europa ins Unglück gestürzt hatte. Die damaligen Führer Deutschlands hatten ihr Volk mit einer teuflischen Propaganda, mit Versprechungen und Drohungen dazu gebracht, gegen die halbe Welt zu Felde zu ziehen. Anfangs recht erfolgreich, aber als der Krieg dann in sein sechstes Jahr ging, standen die Armeen der Alliierten an der Oder und am Rhein. Das Ende war vorgezeichnet. Trotzdem trieben die Regierung und ihre verantwortungslosen Parteigänger die Bevölkerung in einen letzten verzweifelten Widerstand.
Ich war damals gerade fünfzehn Jahre alt geworden und gehörte, wie alle meine Altersgenossen, der Hitlerjugend an. Ende März 1945 wurde auch in Finsterwalde eine kleine Gruppe Hitlerjungen dazu abkommandiert, die Verteidigung des Reiches gegen die anrückenden Feinde und letztlich wohl auch eine Art Partisanenkrieg nach der Besetzung, vorzubereiten. Zu den Auserwählten in unserer Stadt gehörten außer mir noch etwa 20 Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren, worauf ich zu Anfang sogar noch stolz war. Diese Aktion lief allgemein unter der Bezeichnung Werwolf. Mein Vater sah unserem Treiben deutlich missbilligend aber vorerst schweigend zu.
Dieses Treiben bestand darin, dass wir uns nach Schulschluss mit unseren Fahrrädern in einem Waldstück etwa 6 km westlich von Finsterwalde trafen. Später, als die Schule sowieso geschlossen war (etwa ab dem 11. April) trafen wir uns ganztägig, um dort einen Bunker zu bauen, ein Erdloch, vielleicht 4 x 8 Meter groß und 2 m tief, das mit Baumstämmen und Dachpappe überdeckt und mit Waldboden getarnt wurde. Im Loch wurden aus Brettern Schlafgelegenheiten eingerichtet und Essensvorräte angelegt.
Unsere Bewaffnung war, angesichts der uns gestellten Aufgabe, eher dürftig. Unser Führer Theo besaß zwei Pistolen, Kaliber 7.65 und 6.35. Außerdem hatten wir einige ausgediente italienische Gewehre mit etwa 100 Schuss Munition, einige Handgranaten und ein paar Panzerfäuste. Ab und zu ballerte Theo nach Wildwestmanier mit dem einen oder anderen seiner beiden Schießeisen durch die Gegend. „Um zu üben“, sagte er. Er ließ uns aber nicht an sein Spielzeug, dazu sei die Munition zu knapp. Das Abdrücken der Panzerfaust durften wir nur kalt proben, da die paar guten Stücke für den Ernstfall aufgehoben werden mussten. Dagegen schossen wir manchmal mit den italienischen Gewehren auf Kaninchen, wobei ernsthafte mechanische Defekte zutage traten. Öfter blieb dabei der Schlagbolzen, der das Zündhütchen aufschlagen sollte, auf halbem Wege stecken - zum Glück für die Kaninchen. Wahrscheinlich hätte man die Gewehrschlösser mal ölen müssen. Zu allerletzt, aber das habe ich nicht mehr miterlebt, brachte Theo noch von irgendwoher eine Maschinenpistole und die zugehörige Munition mit.
Theo war Mitte zwanzig und aufgrund einer Verwundung für die Wehrmacht untauglich. Was ihn nicht daran hinderte, ein großer HJ-Führer und fanatischer Nazi zu werden. Wir als seine Untergebenen betrachteten dagegen die ganze Aktion eher als die Fortsetzung eines aufregenden Räuber- und Gendarm-Spiels und nahmen auch seine Durchhalte- und Endsieg-Sprüche nicht allzu ernst. Keiner von den zwanzig Jungen war sich der Tragweite seines Tuns bewusst.
In den allerletzten Kriegstagen durften wir unsere Waffen mit nach Haus nehmen, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Ich band mir eines Abends eine Panzerfaust an mein Fahrrad und radelte stolz heim, an staunenden Nachbarn vorbei. In der Ferne hörte man schon den Geschützdonner der nahen Front, es konnte sich also nur noch um einen oder zwei Tage handeln, bis die Russen da waren.
Jetzt hielt mein Vater den Zeitpunkt für gekommen, mir zu erklären, dass unser Unternehmen dumm, wahnsinnig und selbstmörderisch sei. Er meinte, dass eine Million (in Wirklichkeit waren es viel mehr) Rotarmisten in wenigen Tagen das Land besetzen würden, dass die deutschen Verbände auseinander fielen, dass ganze Armeen der Wehrmacht in Gefangenschaft gerieten, dass die Naziführer aus Berlin längst getürmt seien und dass die Hoffnung, die anrückenden Westalliierten würden plötzlich Front gegen die Sowjets machen, jeder Grundlage entbehrte.
Ich widersprach heftig. Ich wollte wieder zu meinen Kumpels zurück. Weniger aus Vaterlandsliebe als aus Kameradschaft. Ich wurde mit sanftem Zwang im Keller versteckt und später sogar eingeschlossen. Die mitgebrachte Panzerfaust hat mein Vater in der Nacht beseitigt, ich weiß nicht wie. Was er da getan hat, war Wehrkraftzersetzung und darauf stand die Todestrafe!
Als wir am nächsten Morgen in unserer Straße, direkt vor unserer Haustür, Maschinengewehrfeuer und das Pfeifen von Granaten hörten, hatten wir alle fürchterliche Angst. Meine Begeisterung für einen Waffeneinsatz zur Verteidigung des Reiches gegen die bösen Russen war plötzlich verschwunden. So beschloss ich, nicht ohne schlechtes Gewissen meinen Mitstreitern gegenüber, dem väterlichen Rat zu folgen und daheim zu bleiben.
Ich erfuhr erst nach Jahren, dass meine Kameraden tatsächlich in Gefechte mit den Russen verwickelt wurden und dass es dabei Tote und Verwundete gegeben hatte. Auch Theo musste seinen Durchhalte-Fanatismus mit dem Leben bezahlen. Die Überlebenden wurden ungeachtet ihrer Jugend vor ein sowjetisches Militärgericht gestellt und zu unmenschlich langen Haftstrafen verurteilt. Sie verbrachten mehr als acht Jahre in verschiedenen Straf- und Arbeitslagern in der Sowjetunion und kamen erst im Frühsommer 1953 wieder nach Deutschland zurück.
Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte ich ihr Schicksal teilen müssen. Für diese geschenkten acht Jahre bin ich meinem Vater bis heute dankbar.
Kapustin 1945
Mein Vater hatte in seiner Jugend in Russland gelebt. Nicht immer ganz freiwillig, aber das ist eine andere Geschichte. In Russland hatte er natürlich Russisch gelernt und er beherrschte damals diese Sprache wie seine eigene. Als Fünfundzwanzigjähriger kehrte er nach Deutschland zurück. Hier ließ er sich in Finsterwalde nieder, heiratete, wurde Vater zweier Kinder, bewohnte ein schönes Haus mit einem großen Garten und ging fast fünfundzwanzig Jahre lang seinem Beruf nach. Er arbeitete als kaufmännischer Angestellter in einer großen Tuchfabrik. An Russland hatte er in dieser Zeit kaum noch gedacht und sein Russisch verlernte er wieder. In unserer Heimatstadt Finsterwalde gab es keine Russen, mit denen er in ihrer Sprache sprechen hätte können. Das änderte sich erst 1945 wieder, als der zweite Weltkrieg zu Ende ging.
Meinem Vater war es gelungen, die Volkssturmoberen davon zu überzeugen, dass er sich nicht zum Krieger eignete. Er hatte einige Leiden und Wehwehchen, die ihn kampfuntauglich machten. So saßen wir denn in den allerletzten Kriegstagen ängstlich im Keller unseres Hauses: mein Vater, meine Stiefmutter (Tante Lotte), deren achtzigjährige Mutter, meine Schwester Anneliese und ich. Der Kanonendonner, den man einige Tage lang in der Ferne gehört hatte, kam immer näher. Eines Morgens schlugen dicht bei unserem Haus Granaten ein, dann folgte Maschinengewehrfeuer und immer wieder das Grollen von Sprengungen, wenn die abziehenden deutschen Soldaten Brücken und wichtige Bauwerke in die Luft jagten, um sie nicht dem Feind in die Hände fallen zu lassen.
Dazu knurrte uns allen der Magen, mir besonders, wie mir schien. Jeder bekam wöchentlich nur eine geringe, genau vorgeschriebene Menge und diese Rationen waren im Laufe des Krieges immer kleiner geworden. Butter, Brot, Milch, Zucker, Mehl und Fleisch waren seit Jahren rationiert. Seit Tagen gab es überhaupt keine Lebensmittel mehr zu kaufen, es sei denn gelegentlich bei umsichtigen Ladenbesitzern, die ihre Vorräte vorschriftswidrig unter die Leute brachten, um sie nicht den anrückenden Russen in die Hände fallen zu lassen. Natürlich hatten wir Vorräte angelegt, aber die durften nicht angegriffen werden, denn wir wussten ja nicht, ob und wie wir in den nächsten Wochen und Monaten versorgt wurden.
Der Strom war abgeschaltet, weil das Elektrizitätswerk beschossen und getroffen worden war. Das Wasser rieselte nur noch spärlich aus den Wasserhähnen. Wir hatten Angst. Man hatte uns schreckliche Sachen über die anrückenden russischen Soldaten erzählt, vor denen auch die Zivilisten nicht sicher waren. Ich hatte deshalb im Garten hinter unserem Haus eine Grube ausgehoben und mit einem Dach aus dicken Baumstämmen zugedeckt. Dort versteckten wir uns und waren auch besser geschützt, falls das Haus von einer Bombe oder einer Granate getroffen wurde.
Die Russen hatten offensichtlich die Stadt besetzt. Das Schießen ließ nach und hörte dann ganz auf. Wir sahen keine Soldaten. Deshalb kletterten wir aus unserm Erdloch und gingen wieder zurück ins Haus in den Keller. Es wurde Nacht. Nichts geschah. Dann wurde es wieder Tag - Sonntag, der 22. April 1945. Es war noch früh am Morgen, da hörten wir plötzlich Schritte vor dem Haus. Es wurde geklopft. Erst mäßig, dann immer stärker. Schließlich polterte ein Gewehrkolben mit aller Gewalt gegen die Haustür. Wir waren starr vor Angst. Mein Vater, kreidebleich, stand auf, ging langsam die Kellertreppe hinauf und öffnete die Tür. Vor ihm stand ein russischer Soldat.
Irgendwo, ganz hinten in seinem Kopf passierte dann etwas, was er sich nicht erklären konnte. Nach achtundzwanzig Jahren, in denen er meinte, die Sprache vergessen zu haben, konnte er auf einmal wieder Russisch! Er trat dem Rotarmisten entgegen und begrüßte ihn freundlich in dessen Sprache: „Guten Tag mein Herr. Was kann ich für Sie tun?“ Der war ob diese unerwarteten Empfanges erst einmal verblüfft. Dann fing er sich, drückte meinem Vater auf jede Backe einen Kuss und sagte: „Genosse, wir haben gesiegt. Der Krieg ist vorbei!“ Er schob Vater beiseite, drängte ins Haus, setzte sich an unsern Esstisch und verlangte, dass die ganze Familie sich um ihn versammelte. Wir kamen zögernd und ängstlich aus unserm Keller: Tante Lotte, Anneliese, ich, zum Schluss die alte Mutter.
Kapustin, so oder so ähnlich hieß unser merkwürdiger Gast, holte eine Flasche Schnaps, den er irgendwo erbeutet hatte, aus der einen Hosentasche und eine Handvoll Zwiebeln aus der andern. Tante Lotte musste Gläser bringen. Die wurden randvoll gemacht und wir mussten alle anstoßen auf den sowjetischen Sieg, auf die glorreiche Sowjetunion, auf das Ende des Krieges. Wir mussten Schnaps trinken und Zwiebeln dazu essen, bis wir nicht mehr konnten.
Es dauerte dann noch ein paar Tage, bis die geschlagenen deutschen Generäle den Waffenstillstand unterzeichneten, aber für uns war der Krieg mit Kapustins Besuch zu Ende. Unser Vater hatte dafür gesorgt, dass wir das Kriegsende gesund und vorerst ohne Schaden überstanden.
Kapustin ist noch mehrmals wiedergekommen, obwohl es den russischen Soldaten streng verboten war, mit Deutschen zu verkehren. Wahrscheinlich hat es ihm bei uns gefallen. Von ihm haben wohl auch die Männer in der Militärverwaltung erfahren, dass es einen Deutschen gibt, der Russisch spricht. Eines Tages erschienen zwei schwer bewaffnete Uniformierte und holten unsern Vater ohne Angabe von Gründen zur Kommandantura, wo man ihm eröffnete, dass er russischen Offizieren Deutschunterricht erteilen sollte, was er natürlich bereitwillig tat. Anfangs brachte er als Entgelt dunkle Brotlaibe und Kochgeschirre voll fettiger Suppe mit heim, beides war hochwillkommen. Später gab es Geld aber auch Zigaretten und Alkohol, die gegen Butter und Mehl eingetauscht wurden.
Mit diesen Unterrichtsstunden, zu denen später auch Russischkurse für Deutsche kamen, hat Vater unsere ganze Familie vier Jahre lang bis zum Sommer 1949 ernährt. Kapustin sei Dank!
Warum den Russen immer die Radios kaputt gingen 1946 bis 1949
Die Jahre 1946 und 1947 waren, was die Ernährung betraf, besonders schlimm. Es gab natürlich Lebensmittel, es gab Brot, Butter, Mehl und Kartoffeln, aber eben nicht genug. Uns Sechzehn- und Siebzehnjährigen knurrte da schon gewaltig der Magen. Wir waren darauf angewiesen, mit allen möglichen Tricks an zusätzliche Nahrungsmittel zu kommen. Unsere Besatzer, die Rotarmisten, die sich inzwischen mit ihren Familien in den schönsten Wohngegenden Finsterwaldes niedergelassen hatten, hatten genug zu essen. Vielleicht konnte man dort etwas holen.
Mit meinem Freund Heinz teilte ich nicht nur die Klasse, sondern auch die Leidenschaft fürs Radiobasteln. Wir saßen oft bis spät in der Nacht zusammen und besprachen unsere einschlägigen Erfahrungen. Ganz in Heinz' Nachbarschaft war eine Russensiedlung und Heinz kannte eine Nachbarin, die bei den Russen putzte. Ein sehr begehrter Job, denn die Putzfrauen wurden mit Naturalien bezahlt, mit Fleisch und Brot und Suppe und manche dieser tapferen Frauen haben damit ihre ganze Familie ernährt. Die Nachbarin hatte Heinz einmal beiläufig erzählt, dass bei einer ihrer Russenfamilien das Rundfunkgerät nicht mehr richtig funktionierte und dass die Leute dringend jemand suchten, der es ihnen repariert.
Das kam uns wie gerufen. Wir wurden von der Nachbarin als Experten eingeführt, machten uns mit Schraubenzieher, Zange und Lötkolben ans Werk und nach zehn Minuten machte der Kasten wieder Musik und wir wurden fürstlich mit je einem Laib Brot und einer Portion Mehl entlohnt. Unsere Heldentat sprach sich schnell herum. In der Russensiedlung gab es viele Radios, die übrigens Tag und Nacht liefen. Wenn so ein Ding seinen Dienst versagte, konnten wir gelegentlich tatsächlich helfen.
Aber das war uns nicht genug. Wir kamen auf die Idee, die Heizspannung der Radioröhren in den von uns reparierten Radios ein wenig heraufzusetzen. Sie funktionierten auch so, aber die Glühfäden verbrauchten sich schneller und waren nach spätestens vier Wochen Dauerbetrieb ausgebrannt. Wir wurden wieder gerufen und bauten mit großem Bedauern eine neue Röhre aus beiseite geschafften Wehrmachtbeständen ein, die wir wieder ein bisschen zu stark heizten. Wir kassierten unsere Fressalien und standen prompt nach einem Monat wieder auf der Matte. Heinz erinnerte sich, dass wir den gleichen Effekt durch liederliches Verlöten einer zu kurz geratenen Leitung zur Lautsprecherspule erzielen könnten. Bei starken Schwingungen der Lautsprechermembrane, also wenn das Radio sehr laut eingestellt wurde, riss die Verbindung und eine neue Reparatur war fällig.
Natürlich ging das nicht lange gut. Irgendwann merkten die Leute, dass es mit unseren Reparaturkünsten nicht weit her sein konnte und die Nachfrage ließ nach. Aber eine Weile konnten wir uns so auf Kosten der sowjetischen Besatzungsmacht richtig satt essen. Womit bewiesen ist, dass gewisse technische Kenntnisse mitunter von nahrhaftem Nutzen sein können.
Heinz, der jahrelang auf dem Gebiet der Hochenergiephysik als Forscher und Hochschullehrer tätig war, repariert mehr als fünfzig Jahre nach diesen Ereignissen noch heute seinen defekten Fernseher selbst. Jetzt sorgt er natürlich dafür, dass der nicht mehr seinen Geist aufgibt.
Etwas trieb mich im Frühjahr 1949 an, ohne Not und wenige Wochen vor dem Abitur, eine kleine Goethe-Biografie zu schreiben. Es gab kompetentere Leute, die das schon getan hatten. Aber wir waren im Goethejahr und mir machte es Spaß, den Spuren nachzugehen, die das Erlebte im Schaffen des Geburtstagskindes hinterlassen hatten (J.W. Goethe war 1749 geboren). Immerhin gefiel die Geschichte meinem Vater so gut, dass er die mehr als 60 eng beschriebenen Seiten mit einer geliehenen Uralt-Schreibmaschine abtippte, um sie les- und haltbarer zu machen. Als ich dann den sauber geschriebenen Text an einem unserer literarischen Diskussionsnachmittage in der Wohnung unserer Deutschlehrerin Frau Hurm voller Stolz der versammelten Runde präsentieren wollte, nahm mir Herr Hurm, unser kommunistischer Mentor für Philosophie, Politik und Literaturgeschichte, den Text sofort aus der Hand und begann darin zu lesen. Wobei er sich durch unsere Gespräche nicht stören ließ und nur ab und zu den Kopf schüttelte.
Bei unserem nächsten Treffen sah ich meine Arbeit wieder, voll geschmiert mit Unterstreichungen und Randbemerkungen. Hurms Kritik war nicht sehr schmeichelhaft. Es handele sich hier um eine Sammlung von zusammengesammelten Zitaten ohne erkennbare Aussage. Nichts darin sei eigentlich neu, außer vielleicht ein paar originellen Formulierungen. Zudem fehlten Quellenangaben. Ich war tief getroffen und dachte an die Nächte, die ich grübelnd und schreibend mit meinem Goethe verbracht hatte. Heute muss ich beim Durchlesen dieses gelegentlich etwas schwülstig geratenen Opus sagen, dass er mit seinem Urteil wohl nicht ganz falsch lag. Frau Hurm gab mir das Manuskript zurück: „Ein schönes Stück Arbeit hast du da geleistet. Und grüß' mir deinen Vater!“
Daheim hab ich all die Striche und giftigen Bemerkungen, die ihr Mann in meinen Text gemalt hatte, sorgfältig rausradiert, Spuren sieht man allerdings heute noch. Wer wollte oder konnte angesichts der Berge von Sekundärliteratur schon etwas Neues über Goethe sagen! Von geschickter Hand war bei uns Interesse geweckt worden, und ich wollte als neunzehnjähriger Schüler ein wenig Klarheit darüber erhalten, was die an uns praktizierten politischen und weltanschaulichen Bildungsversuche mit idealistischen und materialistischen Goethe-Interpretationen bewirkt hatten.
Kurz nach dem Abitur und wenige Tage vor meiner Flucht in den Westen ging ich noch hin, um mich von den beiden zu verabschieden. Luitpold Hurm schenkte mir nicht ohne Rührung ein wertvolles altes Büchlein Kleinere Schriften und Briefe von Robert Mayer nebst Mitteilungen aus seinem Leben; J. G. Cotta Nacht, Stuttgart 1893. Er bemerkte witzelnd, das könnte ich vielleicht für mein Physik-Studium brauchen. Johanna Hurm drückte mir beide Hände, sah mich dabei ernst an und sagte: „Vor allem aber bleib dir selber treu!“ Damit war das Kapitel Schule für mich abgeschlossen.
Die Erinnerung an diese Szene hat mich durch mein ganzes Leben begleitet.