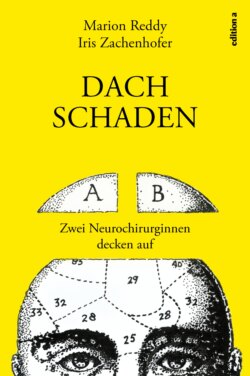Читать книгу Dachschaden - Marion Reddy, Iris Zachenhofer - Страница 9
Und ich?
ОглавлениеJe länger ich dabei war, desto mehr wurde ich zu einem Störfaktor in diesem System. Jemand, der nicht dazu passt.
Zwei Sätze, die gut klingen, wenn ich sie so hinschreibe, und die meinem Ego schmeicheln, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie auch stimmen. Meine Psychiaterin meint, ich habe sicher auch narzisstische Anteile, aber das muss ja nicht immer negativ sein. Im positiven Sinne sind das Leute, die es einfach angemessen finden, einen guten Job, schöne Kleidung, eine tolle Wohnung und ein ausgeglichenes Privatleben zu haben. Die finden, dass ihnen das auf jeden Fall zusteht, vielleicht noch mehr als anderen. Der Übergang zum pathologischen Narzissmus ist dann allerdings fließend und nicht immer erkennbar.
Ich gebe zu, dass auch mein erster Gedanke an ein Medizinstudium nicht nur von Selbstlosigkeit und Hingabe geprägt war. Mir war ja als Kind immer schon aufgefallen, dass alle meine Freundinnen mit Arzt-Eltern Pferde hatten, da gab es Ferienhäuser in Spanien und Swimmingpools und Tennisplätze im Garten. Seit ich fünfzehn bin, habe ich mir dann jeden Monat die „Vogue” gekauft. „Warum kaufst du dir diese blöde Zeitschrift, da sind nur Designersachen drinnen, die wirst du dir sowieso nie leisten können!”, sagte meine Mutter immer. „Komm endlich von deinem hohen Ross herunter.” Gott, was habe ich diesen Spruch gehasst. Ich wusste aber, dass ich mir diese Sachen irgendwann leisten wollte, also wollte ich einen lukrativen Job, das war ganz klar.
Wir waren als Kinder im Sommer immer im Strandbad am Wörthersee. Da gab es so einen speziellen Milchreis, mit frischen Früchten, mit Erdbeeren, Himbeeren und Waldbeeren. Ich habe den nie bekommen, „viel zu teuer” haben meine Eltern immer gesagt. Ich habe ihn vielleicht zweimal im Leben gegessen, wenn meine Oma mit war und ihn mir gezahlt hat. Und wenn wir nach Grinzing zum Heurigen gefahren sind, hat meine Mutter gesagt, da sind die Villen von diesen reichen Arschlöchern. Ich dachte mir, ich möchte einmal so ein reiches Arschloch sein. Und mir so viel Beeren-Milchreis kaufen, wie ich will. Wahrscheinlich habe ich also einfach deswegen Medizin studiert … – Nein, die ursprüngliche Intention war schon, diesen Beruf erlernen zu wollen, Menschen helfen zu können, die Operationen bestens ausführen zu können. Aber eben auch, ein sorgenfreies Leben zu haben, insbesondere durch den finanziellen Hintergrund.
Aber weit gefehlt, vollkommen falsche Entscheidung, das sind einfach andere Zeiten gewesen, vor zwanzig oder dreißig Jahren. Unsere heutige Generation von Ärzten, mit der heutigen Bezahlung, ist komplett anders. Da gibt es jetzt nur mehr Bankrott, Mahnungen und gesperrte Konten.
Inzwischen kommt es sogar vor, dass ein Chefarzt den Ärzten monatliche Sonderklassengelder nicht ausbezahlt, wenn sie gerade in Urlaub sind, und hofft, dass das nicht bemerkt wird. Und da geht es um Summen wie hundert Euro, wie lächerlich ist das denn?
Am Gymnasium war ich dann auch immer ein Störfaktor, genauso wie später an der Neurochirurgie. Mit siebzehn war ich schwer verliebt in meinen Freund, der bereits studierte. Ich hing immer mit ihm vormittags in den Cafés ab und hatte infolgedessen sehr schnell das freiwillige Vorlesungssystem der Universität auf die Schule übertragen. Was bedeutete, dass ich nur mehr für die Hauptgegenstände in die Schule kam, und dabei vorzugsweise für Mathematik. Meine Fehlstunden explodierten, die Schulnoten fielen in den Keller. Als meine Eltern mir Hausarrest verpassten, stieg ich nachts aus dem Fenster, um meinen Freund zu sehen. Mein Vater nahm mich aus dem Gymnasium. Zur Strafe steckte er mich in die Krankenschwesternschule. Bereits nach drei Monaten begann ich, für die Externistenmatura zu lernen, weil mir klar war, dass ich das nicht mein Leben lang machen würde. Respekt vor den Krankenschwestern, aber für mich war das nichts. Zu wenig Geld und dafür zu viel rumgeschubst werden. Also machte ich die Matura und studierte Medizin. Das schien mir eine realistische Aussicht auf einen gehobenen Lebensstil zu bieten.
Während des Studiums bemerkte ich, dass mir Sezieren Spaß machte. Ich hatte die Geduld, ewig an den Gefäßen und Nerven zu präparieren, damit konnte ich mich für Stunden beschäftigen. Also Chirurgie.
In den Sommerferien arbeitete ich während des Studiums weiter als Schwester in einem Krankenhaus und verliebte mich in einen Patienten. Er lag auf der neurochirurgischen Station. Wegen einer Zyste und wegen epileptischer Anfälle.
Die Ärzte schickten ihn mit Medikamenten gegen die Anfälle wieder nach Hause. Ich fischte mir seine Daten aus dem Computer und schrieb ihm einen unverfänglichen Brief: „Hey, wie geht’s? Wir haben uns im Krankenhaus kennengelernt. Melde dich doch mal.”
Wir verliebten uns und heirateten sehr schnell, es war zunächst eine sehr schöne und unbeschwerte Zeit. Jedoch hörten seine epileptischen Anfälle trotz der ganzen Medikamente nicht auf. Die Ärzte entschlossen sich zu einer Operation. Dabei fanden sie leider keine Zyste, sondern einen Hirntumor. Der Tumor meines Mannes hatte den Grad zwei bis drei. Das ist sozusagen die Grauzone zwischen gutartig und bösartig und legt eine Bestrahlung nahe.
Mein Mann wollte seine Krankheit nicht wahrhaben. Also musste ich mich allein damit befassen. Als ich alles darüber nachgelesen und begriffen hatte, dass der Tumor nach der Bestrahlung sehr wahrscheinlich wiederkommen würde, heulte ich zwei Tage lang ununterbrochen. Auch deshalb, weil ich gerade mit Zwillingen schwanger war und mich meine Familie mit meinem Wissen allein ließ.
„Unmöglich“, sagte meine Mutter. „Er stirbt nicht. Er sieht so gesund aus und er kriegt ja jetzt Kinder.“
Kurz nach meinem Studienabschluss, als die Zwillinge schon auf der Welt waren, musste bei meinem Mann eine zweite Operation durchgeführt werden, da der Tumor nachgewachsen war. Der behandelnde Neurochirurg meines Mannes führte mich in sein Büro. „Es ist jetzt ein sehr bösartiger Tumor, Grad vier“, sagte er. „Ihr Mann lebt nicht mehr lange. Er kann gerade noch das Notwendigste erledigen.“
Ich fragte mich in diesem Moment nur, was er denn regeln sollte, schließlich waren wir keine Millionäre, die schnell noch fünf Millionen von da nach dort schieben mussten. Immerhin war ich aber darauf vorbereitet gewesen, was mir in den nächsten Monaten bevorstand. Später, als ich selbst in der Neurochirurgie arbeitete, wurde mir klar, dass dieser Arzt noch sehr menschlich gehandelt hatte und ein guter Neurochirurg gewesen war. Die Neurochirurgen, die ich danach kennenlernte, ließen solche Hiobsbotschaften mal eben während der Visite am Fußende des Bettes fallen, und ehe die Patienten richtig kapierten, was sie eben gehört hatten, waren sie schon wieder weg.
Ich hatte Studienkollegen, die auch in der Chirurgie Praktika gemacht und dort gesehen hatten, wie den Patienten bei der Visite oder sogar am Gang ihre schweren Diagnosen, ihre Todesurteile sozusagen, mitgeteilt wurden. Viele Studenten sagten danach, sie würden niemals in die Chirurgie gehen wollen, denn sie wollten nicht zu solchen Monstern werden.
Der Tumor meines Mannes war also inzwischen bis zu Grad vier fortgeschritten, ein so genanntes Glioblastom. Das bedeutete, dass er noch rund sechs Monate zu leben hatte, eine Prognose, die dann auch ziemlich genau zutraf.
Ich verlor in dieser Phase eine Menge Illusionen über Menschlichkeit und Liebe, über Not und Nähe, über das Dasein für einander, über das „bis der Tod euch scheidet“ und über mich selbst. Zwischen dem Hoffen und dem Verdrängen meines Mannes, in einer Zeit, in der Zukunftsplanung für mich zu einem Tabuthema wurde, fingen wir schrecklich zu streiten an. Wir trennten uns sogar noch, ehe er in einem deutschen Pflegeheim starb.
Ich hatte dabei gelernt, wie wenig in unserer Gesellschaft Leben und Tod zusammenpassen. Meine Lebenssituation hatte mich unter meinen Studienkollegen zur unwillkommenen Person gemacht. Wenn ich mit einigen von ihnen bei einem Glas Wein saß und ihnen von mir erzählte, sah ich sie danach höchstens noch aus der Ferne an der Uni. Ist auch ganz klar, keiner traut sich mehr über seine alltäglichen Probleme zu reden. Die Leute kommen sich blöd vor, wenn sie über ihr Übergewicht, einen vertrottelten Professor oder einen Artikel in einer Zeitschrift diskutieren, und es sitzt jemand daneben, der denken könnte, wie unnötig und oberflächlich solche Gedanken sind. Aber gerade in schwierigen Lebenssituationen wäre genau so etwas mal notwendig. Denn die Gespräche mit meinem Mann, das war immer wie ein Tanz auf einem Minenfeld. Nächstes Weihnachten, nächstes Ostern, das durfte ich alles nicht ansprechen, wir wußten ja nicht, ob er nicht möglicherweise im Krankenhaus ist. Nächster Sommerurlaub, den Gedanken daran bloß vermeiden. Würde er da überhaupt noch leben? Ständig kleine Messerstiche ins Herz, unbemerkt, aber doch scharf.
Gerade Ärzte tun sich manchmal schwer, mit dem Tod in ihrer eigenen Nähe umzugehen. Eine Neurochirurgin, mit der ich später im Team arbeitete, musste ihren Mann, der an Darmkrebs litt, über viele Monate durch die Krankheit begleiten. Sie begleitete ihn durch all die Therapien, nur um am Ende zuzusehen, wie die Schmerzmittel nicht mehr wirkten und er hilflos starb. Sie stellte daraufhin die Sinnhaftigkeit unseres Tuns grundlegend infrage. Wenig später bekam sie Bauchschmerzen, und ein Arzt diagnostizierte viel zu voreilig auch bei ihr Darmkrebs. Eben hatte sie noch gedacht, durch die Hölle gegangen zu sein, jetzt sah es so aus, als läge die erst vor ihr. Es war dann nur ein Blinddarmdurchbruch, aber sie hatte dennoch genug. Sie schickte uns wenig später eine Ansichtskarte aus der Karibik, mit Segelboot und blauem Meer. Sie kam nie wieder.
Ich denke, bei mir lief es umgekehrt. Mich hat dieses Spannungsverhältnis zwischen meinen kleinen Kindern und meinem sterbenden Mann, zwischen dem prallen Leben und dem Tod, sogar angetrieben. Ich habe mich in einer Zeit für die Neurochirurgie entschieden, als ich alle sechs Monate auf einen neuen Befund warten musste. In einer Zeit, in der ich mich ständig fragte, wie schlimm es werden würde und wie lange es noch gehen würde, und in der ich wegen meiner reaktiven Depression Psychopharmaka bekam.
Auch mir teilte ein Oberarzt bei meinem ersten Hearing durch die Blume mit, dass ich es mir besser noch einmal überlegen sollte, und auch ich ließ mich davon in meinem Schwung nicht bremsen.
„Sie haben doch Kinder“, sagte er. „Ich hoffe, Sie wissen, dass Sie bei uns immer erst frühestens um acht Uhr abends heimkommen, und zwar jeden Abend. Am Wochenende sind alle Kollegen hier und arbeiten in der Bibliothek, und ich meine damit wirklich alle, nicht nur die Diensthabenden.“
Den Job bekam ein anderer, aber ich suchte weiter. Jetzt erst recht die Neurochirurgie, dachte ich. Aber wollte ich Menschen retten, als ich meine Berufswahl traf? Wollte ich verhindern, dass es anderen Menschen so ging wie meinem Mann, oder ihr Schicksal zumindest verbessern? Schließlich bringt selbst eine erfolgreiche Tumoroperation nie Genesung sondern immer nur Lebenszeit, meistens nur ein paar Monate.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es stimmt schon, die Grundlage meiner Entscheidung für die Medizin war mein Wunsch nach einem schicken Leben, und meine Entscheidung für die Neurochirurgie fiel höchstens aus Neugierde. Ich wollte wissen, was da passiert war. Ich wollte wissen, was so einen Schatten über mein Leben als junge Frau und Mutter geworfen hatte. Vielleicht heißt das, dass es auch mir bei meiner Entscheidung nicht um die Menschen, sondern um die Krankheit ging.
Den Oberarzt, der mir meine Berufsentscheidung nicht ausreden wollte und mir meine erste Stelle als Assistenzärztin an einer neurochirurgischen Abteilung gab, kannte ich. Er kannte mich ebenfalls. Er ordnete mich nur falsch zu.
„Sie waren doch in unserem Endoskopiekurs“, sagte er bei meinem Bewerbungsgespräch.
Ich nickte. Dabei stimmte es nicht. Ich erzählte ihm nichts davon, wie er mir einmal mitgeteilt hatte, dass mein Mann, der Vater meiner kleinen Babys, nur noch wenige Monate zu leben hätte. Ich habe es ihm bis heute nicht erzählt.