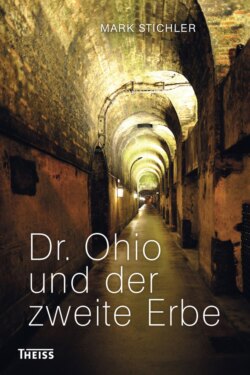Читать книгу Dr. Ohio und der zweite Erbe - Mark Stichler - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеAbenddämmerung,
im schmalen Licht der Lampe
schwebt der stille Staub
Draußen wurde es dunkel. Höpfner wandte den Kopf von seinem Schreibtisch zum Fenster. Müde strich er sich über die spärlichen grauen Haare, die er hinten zu einem kleinen Zopf zusammengebunden hatte. Die Bäume standen wie schwarze Schatten vor der Dunkelheit und raschelten leise, als wollten sie etwas sagen. Unwillig drehte Höpfner sich wieder um. Ich werde alt, dachte er.
Er saß in seiner Bibliothek über einem schmalen Band mit japanischen Haikus, kleinen, dreizeiligen Gedichten. Mit seinen großen, groben Händen schlug er ab und zu eine Seite des dünnen Papiers um. Zwischen die Gedichte waren in loser Folge feine japanische Tuschezeichnungen von Naturmotiven eingestreut. Ein knochiger, schwarzer Ast, an dem ein orange leuchtender Lampion hing, eine kahle, schneebedeckte Bergspitze, um die wie eine lange Kette eine Schar schmaler Vögel zog, Blumen und ein grauer See unter dem blassen Vollmond.
Höpfner knipste eine kleine Schreibtischlampe an, die seinen Arbeitsplatz beleuchtete, den Rest des Raums aber nahezu im Dunkeln ließ.
„Machen Sie doch Ihr Licht an“, sagte er unvermittelt in die Tiefe des Raums, dessen Ausmaße bei den düsteren Lichtverhältnissen nur zu erahnen waren. Die Nacht höhlte die Ecken zu dämonenvollen Löchern, zauberte lange, schwarze Gänge zwischen die hohen, dicht mit Büchern vollgestopften Regale, die wer weiß in welches Verlies führten.
Ein paar Meter von Höpfner entfernt war ein Brummen zu vernehmen, dann ein seidenes Rascheln. Gleich darauf ging am Schreibtisch seines Assistenten Värie Wieri ein ähnliches Licht an wie bei Höpfner.
Wieri, den Höpfner für seine Studien über den Calvinismus eingestellt hatte, saß tief gebeugt über einem dicken Wälzer und machte sich eifrig Notizen. Er war Finne und galt als Spezialist für Fragen zum Calvinismus. Von Höpfner hatte er sich hauptsächlich wegen der gut sortierten Bibliothek anheuern lassen. Höpfners Urgroßvater hatte die Villa im Naturpark Schönbuch bei Tübingen ursprünglich als Sommerresidenz gebaut und dort den hohen Raum für seine Sammlung alter Bücher eingerichtet. Mit der Zeit hatten seine Erben, Inhaber einer Buchhandelskette, einen beachtlichen Bestand an Werken gehortet, die inzwischen nicht mehr alle im Stammsitz der Familie gelagert wurden. Die Dachböden diverser Landhäuser in Italien und der Schweiz waren ebenfalls vollgestopft mit den Zeugnissen der Sammelleidenschaft von Höpfners Vorfahren.
Wieri rieb sich seine wässrigen Augen und ließ seinen Bleistift fallen. Er war ein schmaler, kleiner Mann mit einem unangenehm starren Blick. Er fixierte Höpfner, musterte mit einem flügelschlagschnellen Blinzeln die breiten Schultern und das große, flächige Gesicht seines Chefs.
„Was machen Sie?“, fragte er leise, fast lauernd, als könne Höpfner eine falsche Antwort geben.
Höpfner sah ihn einen Augenblick erstaunt an, dann grinste er breit und seine Augen bekamen einen verschmitzten, schalkhaften Ausdruck, der sein graues Gesicht wieder jung erscheinen ließ.
„Ach“, sagte er harmlos. „Ich habe hier ein kleines Bändchen mit japanischen Gedichten, das ich noch durchblättere.“
Falsche Antwort. Wieris Miene gefror zu Eis. Eine Zeit lang starrte er seinen Chef reglos an, als warte er auf eine Entschuldigung oder ein verlegenes Das war nur Spaß. Natürlich beschäftige ich mich mit Calvin. Höpfner starrte ebenso zurück, mit einem feinen Lächeln um die Lippen.
„Sie wollten noch raus, in Ihre Scheune da hinten“, sagte Wieri schließlich resigniert und drehte sich wieder zu seinem Schreibtisch um.
„Ach, ich weiß nicht. Ich hab gar keine Lust mehr rauszugehen“, sagte Höpfner und sah zum Fenster hinaus. „Und dunkel ist es auch schon.“
„Wenn Sie es jetzt machen, müssen Sie es morgen nicht mehr tun“, murmelte Wieri. Er hatte sich schon wieder in sein Buch vertieft.
Höpfner lachte.
„Sie legen ja eine echt schwäbische Haltung an den Tag, Wieri“, sagte er. Er seufzte lustlos. „Aber Sie haben recht. Ich geh mal.“
Wieri nickte, ohne von seinem Schreibtisch aufzublicken. Höpfner erhob sich schwerfällig von seinem Stuhl und ging hinaus.
Er ging die Treppe im Dunkeln hinunter. Auf den unteren Stufen kam ihm die Haushälterin entgegen. Als sie Höpfner dicht vor sich bemerkte, stieß sie einen erschrockenen Schrei aus.
„Herr Höpfner!“, rief sie. „Können Sie kein Licht anmachen?“
„Sie haben ja auch keins angemacht.“ Höpfner lächelte. Die unerwartete Begegnung im Dunkel der großen Treppe, die von der Halle in die oberen Stockwerke führte, schien ihm zu gefallen.
„Ja, aber ich ...“ Der Haushälterin fiel kein passendes Argument ein, warum sie mehr Rechte als Höpfner haben sollte, im Dunkeln durchs Haus zu wandern. „Ich mache das immer so“, sagte sie schließlich lahm.
„Mhm“, machte Höpfner. Er spürte ihre Nervosität, hörte das Knistern ihres steifen Kleids. Aber sie wich keinen Schritt zurück, blieb quasi zitternd standhaft. Höpfner lehnte sich schwer gegen das schwarze Holzgeländer, das ihn leise ächzend stützte. Keiner von beiden machte Anstalten, das Licht anzuschalten.
„Wo wollen Sie denn überhaupt hin?“, fragte die Haushälterin mit einem metallischen Klang in der Stimme.
„Ich muss noch den Durchgang an der Scheune abmessen. Morgen soll der Öltank abgeholt werden und ich weiß gar nicht, ob er durchpasst. Dann kann ich auch gleich die Schrauben lösen.“
„Das können Sie doch auch noch morgen erledigen“, sagte die Haushälterin. „Oder Henrik kann es machen.“
Henrik war der Gärtner auf Höpfners Anwesen, eigentlich der Mann für alles, eine Art Hausmeister, aber alle nannten ihn den Gärtner. Er war immer schon da gewesen, solange Höpfner sich erinnern konnte. Ein langer, grimmiger Mann mit weißem Bart und alkoholhellem Blick.
„Henrik“, sagte Höpfner abfällig. „Das kann ja dann ewig dauern. Wenn ich es jetzt mache, ist es erledigt.“ Er dachte an Wieri.
„Hm.“ Die Haushälterin zuckte mit den Schultern und schlängelte sich vorsichtig um ihn herum. Er lächelte und schüttelte den Kopf, im Dunkeln von ihr unbemerkt. Dann trottete er nachdenklich weiter nach unten. Auf dem Treppenabsatz wandte er sich um.
„Hanne“, sagte er leise in die Dunkelheit.
„Ja?“, fragte sie flüsternd von oben. Beide schwiegen lange und sahen in die Richtung des anderen, ohne mehr zu erkennen als einen schemenhaften Schatten.
„Ach nichts“, sagte Höpfner schließlich. Graue Punkte tanzten vor seinen Augen.
Er ging ums Haus und öffnete die Tür zur Scheune. Der Öltank war beinahe so alt wie das Haus selbst und sollte endlich entsorgt werden. Damit hatte er eine Tübinger Spezialfirma beauftragt, die den Tank auf ihrem Gelände fachmännisch zerlegen würde. Aber eben nur dann, wenn sie das Ding auch durch den Eingang der Scheune abtransportieren konnte.
Er schaltete das Licht ein und flackernd leuchtete eine alte Glühbirne auf, die an einem schwarz umwickelten, verstaubten Kabel von der hohen Decke hing. Die Scheune war nicht sehr groß und früher als Werkstatt benutzt worden. Jetzt stand sie schon lange fast leer. Höpfner kramte einen Meterstab aus der alten Werkbank und maß die Tür aus. Dann ging er wieder hinein, um den Tank abzumessen.
Oben am Fenster der Bibliothek stand Wieri und blickte hinaus in die Finsternis. Er stand da, als würde er träumen, mit starrem Blick auf die Tannen, über denen ein paar Sterne zu sehen waren. Als er in der Scheune die kleine Funzel angehen sah, holte er tief Luft. Gleich darauf konnte er Höpfner beobachten, der mit dem Meterstab am Eingang hantierte und dann wieder verschwand. Wieri spielte mit einem Gegenstand in seiner Hosentasche und zog ihn schließlich heraus. Es war ein kleines, viereckiges Kästchen aus Plastik mit einem roten Knopf in der Mitte. Der Finne ging langsam zurück an seinen Schreibtisch. Überall herrschte tiefe Stille, eine Reglosigkeit, wie sie Landschaften befällt, kurz bevor der Sturm losbricht. Als würde Gott den Atem anhalten ...
Wieri schob seine Hand mit dem Kästchen wieder in die Hosentasche, biss auf die Zähne und zog die Augenbrauen zusammen, angestrengt, als würde er eine Nuss knacken. Und dann, fast im selben Moment, erschütterte eine ohrenbetäubende Explosion das Haus. Es war, als prallten Dimensionen aufeinander, als würden sich in unmittelbarer Nähe des Ohrs die elektrischen Spannungen eines Gewitters in Blitz und Donner entladen. Die Wände wackelten und die Fenster klirrten. Der Krach nahm Wieri den Atem und das Gehör. Stille.
Als der Druck auf den Ohren nachließ, hörte er den Aufprall von Gegenständen, die vor wenigen Augenblicken noch eine Scheune gewesen waren, und das Prasseln und Zischen von Flammen. Dann wurde die Tür aufgerissen.
„Ach du meine Güte. Herr Wieri“, stammelte die Haushälterin und hielt entsetzt beide Hände vor die Brust. „Herr Wieri.“
„Um Gottes willen“, murmelte Wieri blass. Ihre Worte drangen wie durch Watte zu ihm. „Was war denn das?“
Die Scheune war in die Luft geflogen. Höpfner hatte den Tank inspiziert und mit dem Meterstab den Durchmesser genommen. Er hatte sich umgesehen, irritiert durch ein Klicken aus dem Innern des Tanks. Und dann hatte er noch genug Zeit gehabt zu sehen, wie es den Behälter mit einem weißen, gezackten Blitz zerriss.
Die Erleuchtung. Stille. Dunkelheit.
Es gibt die Theorie, man könne einer Explosion nur aus dem Wege gehen, indem man direkt in sie hineinspringt. Man lässt die Druckwelle hinter sich. Da die Teile der Ladung auseinanderdriften, entsteht im Zentrum der Explosion ein Vakuum, ein leerer Raum, in dem man überlebt, wohin auch immer der Weg einen führt.
Grau ist alle Theorie. Oder Höpfner war nicht schnell genug im Mittelpunkt der Explosion gewesen. Es hatte ihn auseinandergerissen, den vielzähligen Molekülen um ihn herum gleichgemacht. Materie, Material, das der ewige Fluss des Lebens fortspülte, wieder frei zur weiteren Nutzung.