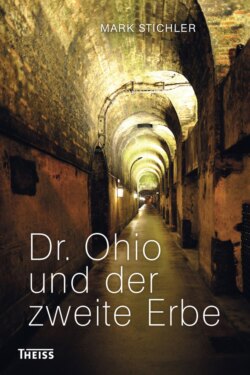Читать книгу Dr. Ohio und der zweite Erbe - Mark Stichler - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеDie flinken Schwalben
zeichnen willkürliche Bahnen
in den Horizont
Es war der zweite schwarze Anzug, den Dr. Ohio besaß. Den ersten hatte er vor über 15 Jahren in Yokohama zur Beerdigung seiner Mutter gekauft. Das war kurz bevor er angefangen hatte, in Brigitte und Heinz Manstorffs Sanatorium zu arbeiten. Den Vertrag hatte er schon unterschrieben, als ihn ein Brief seines Bruders erreichte. Dr. Ohio verschob seinen Arbeitsantritt und flog sofort nach Yokohama, wo ihn sein Bruder abholte. Dort kaufte er sich den Anzug, bevor sie zu den Trauerfeierlichkeiten in ihr Heimatdorf fuhren. Und jetzt hatte er wieder einen schwarzen Anzug gekauft, für die Beerdigung von Carl Höpfner.
Die Tage zuvor hatte er viel Zeit in Höpfners Bibliothek verbracht und morgen, einen Tag nach der Beerdigung, sollte die Testamentseröffnung sein. Seitdem war Ohio einige Male mit Laudtner in der Bibliothek zusammengetroffen. Sympathischer war ihm der Anwalt nicht geworden und er hatte sich ein bisschen über Höpfner gewundert. Allerdings schien Laudtner alles korrekt abzuwickeln, Ohio konnte ihm keinen Vorwurf machen.
Der Rechtsanwalt zeigte ihm die Liste der Personen, die zur Testamentseröffnung geladen waren. Bis auf zwei weitere Namen standen dieselben Leute darauf wie schon beim ersten Treffen.
„Herr ... Wieri sagte mir, dass es keine Verwandten gäbe?“, fragte Dr. Ohio erstaunt.
„Das ist so nicht ganz richtig“, erwiderte Dr. Laudtner zögernd. „Es gibt zwei Neffen, Boris und Karl. Allerdings scheint es nahezu aussichtslos, die beiden aufzutreiben. Ich habe in zwei überregionalen Zeitungen und in der hiesigen Regionalzeitung eine Anzeige geschaltet. Aber bisher kam keine Antwort.“
Dr. Laudtner hatte die Testamentseröffnung außerdem im Tübinger Amtsblatt ausschreiben lassen. Keine Reaktion. Eine Adresse oder nähere Angaben zur Person gab es nicht. Er mache sich große Sorgen wegen des Testaments, sagte der Anwalt. Dr. Ohio zuckte gleichgültig mit den Schultern. Er ging davon aus, dass Höpfner konkrete Anweisungen in seinem Testament hinterlassen hatte, und die würde er so gut wie möglich befolgen.
Wider Erwarten war es ein schöner Tag. Ein fröhlicher Wind trieb kleine, weiße Wolkenfetzen über den blauen Himmel. Die Sonne wärmte noch nicht richtig, gab den Wiesen aber eine kräftige Farbe und dazwischen leuchteten die hellgrünen Weizenfelder. Schwärme von Schwalben jagten sich um den Dachfirst der Kapelle des alten Tübinger Stadtfriedhofs. Der Kontrast zwischen Zeit und Ort war augenfällig und nicht jedermann angenehm. Värie Wieri stand in einem engen, kneifenden Anzug mit Hochwasserhosen, die sein Gemächt unfreiwillig und unangebracht betonten, neben Dr. Laudtner und starrte finster den Vögeln nach. Er schien nicht gewillt, der Natur ihre Pietätlosigkeit zu verzeihen.
Der Anwalt war im Gegensatz zu Wieri blendend gelaunt, ohne es am nötigen Respekt fehlen zu lassen. Er war für die Beerdigung in feinstes schwarzes Tuch gekleidet, eine dunkelrote Nelke zierte das Revers. Seine schlaffen Wangen waren von einem ungesunden Rot gefärbt, die Augen glänzten, als hätte er gestern zu viel getrunken. Dr. Ohio hatte den Eindruck, als fühle er sich in Situationen sehr wohl, in denen ein festgelegter Ritus alle hemmt und diejenigen bevorzugt, die sich darin auskennen. Er bewegte sich wie ein Ballettmeister auf dem schmalen Vorplatz der kleinen Friedhofskirche, stieß zu jener Gruppe, dirigierte eine andere etwas zur Seite, um jemanden durchzulassen, hatte hier und da ein klärendes oder mitfühlendes Wort. Mit einer gewissen weltmännischen Art breitete er die Arme aus, als wolle er Dr. Ohio mitfühlend umarmen, um ihm dann doch nur mit einem warmen Druck die Hand auf den Arm zu legen und ihn mit tönender Stimme zu begrüßen.
Dr. Ohio kam nicht allein. Zu seiner Überraschung hatte seine Gehülfin gefragt, ob sie zur Beerdigung mitkommen dürfe. Sie war Höpfner einige Male begegnet, als er zu Ohio ins Sanatorium gekommen war. Sie hatten nicht viel miteinander zu tun gehabt, aber immerhin hatte sie ihn gekannt. Zu ihrer Überraschung gestattete Dr. Ohio ihr, ihn zu begleiten, und Erika stakste in halbhohen Schuhen, die blonden Haare zu einem Pferdeschwanz gerafft, in einem schwarzen, etwas engen Kostüm neben ihrem hageren Chef her und überragte ihn beinahe.
Dr. Laudtner hielt sich nicht lange mit der Begrüßung Ohios auf und wandte sich Erika zu.
„Die Gattin?“, fragte er galant und sah sie mit feuchten Augen an. Er war kurz davor, ihr einen Handkuss zu geben, besann sich aber noch rechtzeitig auf die Spielregeln einer Beerdigung und drückte auch ihr mitfühlend die Hand.
Ohio sah ihn ausdruckslos an.
„Das ist meine Assistentin“, sagte er und hielt es nicht für nötig, weitere Erklärungen abzugeben. Auch für Erika schien die Vorstellung völlig auszureichen, und der ganz leicht aus dem Konzept gebrachte Anwalt lächelte und rieb sich die Hände.
„So, ah ja“, murmelte er leise und ging dann mit ihnen hinüber zu den anderen Trauergästen.
Värie Wieri nickte Dr. Ohio grimmig zu. Ansonsten erkannte Ohio Hanne, die Haushälterin, den Gärtner und die kleine Frau, die sich als die Köchin entpuppt hatte. Es waren auch noch viele andere Leute da. Höpfner hatte offensichtlich nicht den zurückgezogenen Lebenswandel gepflegt, den Dr. Ohio von ihm angenommen hatte. Zumindest hatte es ja eine Zeit gegeben, in der er alles andere als ein Einsiedler gewesen war. Außerdem war er angeblich ein reicher Mann und hatte somit automatisch viele Bekannte in der Gegend. Der Bürgermeister war gekommen und der Landrat. Vom Bischofssitz in Rottenburg war der Bischof persönlich angereist. Allein das bedeutete schon ein Gefolge, das über das übliche Maß an Gästen bei einer Trauerfeier hinausging.
Höpfner, so hatte sich herausgestellt, war katholisch gewesen und hatte seine Mitgliedschaft in der Kirche nie beendet. Also war es für seine Haushälterin und Dr. Laudtner selbstverständlich, ihn nach katholischen Regeln zu beerdigen. Värie Wieri hatte heftig widersprochen. Nie und nimmer sei Höpfner noch Katholik gewesen, hatte er gezetert und auf seine langjährigen Forschungen über den Calvinismus zusammen mit ihm verwiesen. Aber in diesem Fall konnte sich die Haushälterin mit Unterstützung des Anwalts durchsetzen.
Es war Wieri hoch anzurechnen, dass er trotzdem zur Beerdigung gekommen war. Seine Einstellung zur katholischen Kirche konnte, ganz konservativ calvinistisch, getrost als feindselig bezeichnet werden. Er würdigte den Bischof und dessen Gefolge keines Blickes. Auch die Kapelle betrat er nicht, er spazierte auf dem schmalen Weg und vor der Tür auf und ab.
Die anderen Trauergäste gingen hinein. Ohio wollte sich mit Erika nach hinten setzen, aber Dr. Laudtner winkte ihnen, sie sollten weiter nach vorne kommen. Um unnötiges Aufsehen zu vermeiden, gingen sie zu ihm in die zweite Reihe. Die erste Reihe war für die Verwandten reserviert und leer geblieben. Während des allgemeinen Räusperns und Füßescharrens wandte sich Ohio bei jedem leisen Quietschen zur Tür um. Vielleicht, dachte er, kommen die Neffen ja doch noch. Aber er wurde enttäuscht: Es erschien keine Verwandtschaft. Die wenigen Nachzügler drückten sich schnell in eine der hinteren Bänke.
Dr. Ohio hatte noch nie einer katholischen Begräbnisfeier beigewohnt. Erika neben ihm murmelte ein Gebet mit und bekreuzigte sich. Nachdem der Priester die Gläubigen aufgerufen hatte, nach vorne zu kommen, stand auch sie auf, kniete neben Dr. Laudtner nieder und nahm eine Oblate und einen Schluck Wein aus einem großen Kelch entgegen. Dr. Ohio fühlte sich unbehaglich. Er empfand es als sehr unhygienisch, dass jeder aus demselben Kelch trank. Zwar kannte er die Rituale der christlichen Gottesdienste einigermaßen, aber eben doch nur vom Hörensagen.
Er betrachtete Höpfners Sarg, der neben dem Altar aufgebahrt stand und von einem unwirklichen Licht angestrahlt wurde. War es die von der Gegenwart des Toten überreizte Einbildung oder die raffinierte Beleuchtung des Bestattungsunternehmers, die einen gewissen Schein um die Konturen der Blumen zog? Die erstaunlich große, hölzerne Kiste war verziert mit allerlei Ornamenten und Blumenschmuck. Wozu die Größe?, fragte sich Ohio unwillkürlich. Er war doch ... Die Explosion hatte ihn doch in kleine Fetzen zerrissen. Jedenfalls hatte Wieri ihm das erzählt.
„Es war nicht mehr viel übrig“, hatte er gesagt und fromm die Hände gefaltet, als sie sich einmal im Treppenhaus von Höpfners Haus begegnet waren. „Freilich, die Seele ...“
Ohio war auf dem Weg in die Bibliothek gewesen, als Wieri ihm entgegenkam. Oje, hatte er gedacht, aber der Calvinist schien geläutert oder zumindest nicht in Kampfstimmung zu sein. Im Gegenteil.
„Dr. Ohio“, hatte er gemessen gesagt und ihn mit seinen wässrigen Augen fixiert. „Schön, dass ich Sie treffe. Ich möchte mich noch mal in aller Form bei Ihnen entschuldigen für die Art und Weise, wie ich mich neulich in der Bibliothek aufgeführt habe.“
Dr. Ohio war erleichtert gewesen, auch wenn er sich nicht erinnern konnte, wann Wieri sich das erste Mal bei ihm entschuldigt hatte. Sie wechselten noch ein paar Worte und Wieri bot seine Hilfe an, wenn es irgendwelche Fragen geben sollte.
Und nun lag das, was nach Wieris Worten „übrig war“ von Carl Höpfner, in einem Sarg, der sicher viel zu groß war für die paar ... Teile. Die Trauergemeinde stimmte ein Lied an.
Ob eine solche Explosion, eine so verheerende Zerstörung des Körpers jemanden wohl aus dem ewigen Kreislauf wirft?, überlegte Ohio. Der Lehre nach ist die Seele unzerstörbar, aber wer weiß? Vielleicht nimmt sie ja doch Schaden, wird sozusagen aus der Umlaufbahn des Seins geschleudert, wenn man derart zugerichtet wird.
Seine Großmutter würde sagen, das spielt keine Rolle. Nichts, was unserem irdischen Leib widerfährt, spielt eine Rolle. Seishi, hätte sie gesagt und ihm eine Tafel gezeigt, auf der das Lebensrad der Buddhisten in vielen bunten Farben und Bildern dargestellt war. Als Kind hatte er diese Tafel geliebt, es gab allerlei zu entdecken, Figuren, Farben, und zu allen Gestalten wusste seine Großmutter eine Geschichte. Er sah sie vor sich, ihr glattes, strenges Gesicht, das mit den Augen lachen konnte und dann auf einmal so freundlich und weich aussah. In ihrem Wohnzimmer stand ein alter, europäischer Schrank, in dem sie ihre Bücher aufbewahrte. Alles schien plausibel und logisch, wenn sie diese Tafel daraus hervorholte und ihm zeigte. Sie erklärte nicht nur die Welt, sondern auch das, was hinter ihr steckte.
Das war lange her und für seine Großmutter hatte sich das Rad schon längst weitergedreht. Ach Skepsis, ach Europa, ach Denken, dachte Ohio mit einem kurzen, bitteren Bedauern. Vieles hatte sich geändert und der Inhalt von Höpfners Sarg ließ nur ein dumpfes Gefühl und einen unangenehmen Schauer zurück.
Als sie dem Sarg den schmalen, von Hecken und Büschen gesäumten Weg zum Grab folgten, gesellte sich Wieri zum Trauerzug und reihte sich neben Dr. Ohio ein. Erika warf er einen missbilligenden Blick zu, was Ohio ihrer Vorliebe für etwas zu enge Kleider zuschrieb. Eine Weile ging er schweigend und mit gefalteten Händen neben den beiden her.
„Großer Sarg“, flüsterte er irgendwann zu Dr. Ohio und blickte starr geradeaus. Ohio sah ihn überrascht an.
„Tja, die Explosion hat ihn ganz schön zugerichtet“, fuhr Wieri fort. Und nach einer Pause: „Na ja, was soll’s.“
„Ich dachte, Sie hätten Ihren Chef gerngehabt“, sagte Dr. Ohio ohne eine weitere erkennbare Regung.
„Es geht nicht darum, ob ich ihn gerngehabt habe oder nicht. Ich kann nicht sagen, dass er mich schlecht behandelt hat. Aber er hat seine Studien und damit auch mich irgendwann sträflich vernachlässigt.“
„Höpfner war ein Mann mit vielen Interessen.“
„Nur ein Zyniker oder ein ...“, Wieri zögerte, bevor er weitersprach, „... ein Mann anderen Glaubens kann so etwas sagen. Glaube hat nichts mit Interesse zu tun. Gott ist kein Spielzeug, dem man für kurze Zeit seine Aufmerksamkeit schenkt und es dann zu den anderen Spielsachen ins Eck wirft.“
„Das mag wohl sein. Ich habe mit Höpfner zu wenig über Glaubensfragen gesprochen. Und wenn, dann ging es meist um Informationen, nicht um die Festigkeit des Glaubens.“
Wieri nickte leicht vor sich hin.
„Haikus“, murmelte er. „Er hat seine Forschungen über den Calvinismus für kleine japanische Reime aufgegeben. Nichts für ungut, Dr. Ohio. Ich bin ein prosaischer Mensch und habe keine Ader für Lyrik. Aber was ist ein Reim, was das größte dichterische Epos von Milton wert gegenüber der Schöpfung und dem Schöpfer?“
„Sie sollten wissen, dass ich Ihnen diese Frage nicht beantworten kann. Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Aber ich kann Ihnen eine Gegenfrage stellen: Ist es nicht gleichgültig, mit welchem Bereich von Gottes Schöpfung sich der Mensch beschäftigt, solange er sich damit beschäftigt? Nicht jeder hat den Ehrgeiz, die Schöpfung allumfassend zu ergründen.“
„Wer, wie Höpfner, die Mittel dazu hat, der sollte versuchen, den Rest der Menschheit daran teilhaben zu lassen.“ Wieri nickte düster vor sich hin und Dr. Ohio konnte nicht umhin, ihm einen weiteren überraschten Seitenblick zuzuwerfen. Die Verbissenheit Wieris in Sachen Religion ging ihm etwas zu weit. Er hatte fast den Eindruck, als sei der Calvinist davon überzeugt, dass Höpfner durch Gottes Hand seiner gerechten Strafe zugeführt worden sei.
„Welche Mittel meinen Sie?“, fragte er. Es konnten wohl kaum die finanziellen Mittel gemeint sein. Denn selbst wenn Höpfner reich gewesen war, wovon er ausging, so gab es wohl eine Menge andere, die noch wesentlich reicher waren als er.
Wieris Miene wurde plötzlich verschlossen.
„Wir haben lange an Schriften geforscht, die Hinweise auf ein bestimmtes Buch lieferten. Dieses Buch, davon bin ich überzeugt, wird uns tief greifende Erkenntnisse über Calvin und seine Lehre liefern“, sagte er stockend.
„Und das befindet sich in Höpfners Bibliothek?“, fragte Dr. Ohio neugierig.
„Ich weiß es nicht“, sagte Wieri schnell und wechselte das Thema: „Die Feuerwehr hat ihre Untersuchung an dem Tank, der in die Luft geflogen ist, abgeschlossen. Es war wohl ein Defekt in einem Zulaufventil. Irgendein Relais hatte einen Kurzschluss und das Ganze zum Explodieren gebracht. Sie schließen Fremdeinwirkung praktisch aus.“ Er sah Ohio befremdlich an. Praktisch?, dachte Ohio. Er sah misstrauisch und einen Augenblick zu lange in Wieris schwimmende, blasse Augen.
„Morgen ist die Testamentseröffnung und ich bin guter Dinge, dass der Zugang zur Bibliothek dann nicht weiter gesperrt sein wird“, fuhr der Calvinist schnell fort und kratzte sich nervös im Schritt. „Wir werden sehen, was Höpfner verfügt hat ...“
Dr. Ohio antwortete nicht. Er hatte das dumpfe Gefühl, als wüsste Wieri schon genau, was morgen passieren würde. Dr. Laudtner traute er durchaus zu, dass er etwas ausgeplaudert hatte. Weiter vorne geriet der Zug ins Stocken und kam zum Stillstand. Die Trauergäste gruppierten sich um Höpfners Grab. Als Ohio das Familiengrab sah, war ihm klar, dass es keine andere Möglichkeit gegeben hatte, als Höpfner hier zu beerdigen. Seit Generationen wurden die Mitglieder der Familie auf dem Stadtfriedhof beigesetzt. Die Höpfners galten etwas in der Stadt, waren eine alteingesessene Familie von Buchhändlern, einem Metier, dem in der Universitätsstadt immer Hochachtung entgegengebracht wurde.
Zwischen den kleinen, in den engen Parzellen des Stadtfriedhofs dicht gedrängten Gräbern und teilweise schon halb umgesunkenen Kreuzen und Grabsteinen nahm sich das Grab der Höpfners fast monumental aus. Der Grabstein zeigte eine kleine, kniende Figur auf einem breiten Sockel, die ein offenes Buch in den Händen hielt. Auf den Steinseiten waren Verse eingraviert, darunter standen die Namen der verstorbenen Familienmitglieder. Höpfners Name war noch nicht eingemeißelt. Lediglich ein schlichtes, hölzernes Kreuz mit seinem Namen, seinem Geburts- und Todestag stand neben der aufgeworfenen Grabstelle.
Wieri ging zu den Hausangestellten hinüber und warf finstere Blicke auf den Bischof und sein Gefolge. Dr. Ohio war überzeugt davon, dass es für Höpfner im Himmel keinen Platz gab. Nicht in Wieris Himmel. Auch der Bischof und er selbst, Ohio, hätten wohl schwerlich Zugang. Man wird sehen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Alte japanische Weisheit, dachte Dr. Ohio und lächelte. Auch für Höpfner hatte sich das Rad weitergedreht. Wer weiß, in welche Richtung.
„Ein unangenehmer Mensch“, sagte Erika neben ihm.
„Wieri?“
„Na, der da gerade eben. Der Kleine mit den fettigen Haaren.“
„Für Sie ist doch jeder ein unangenehmer Mensch“, sagte Dr. Ohio unbewegt.
„Das stimmt nicht. Es gibt Ausnahmen, aber vor allem viele Sünder da draußen.“
Ohio warf einen Blick auf sie, ihre langen, blonden Haare, ihr frisches Gesicht und ihr etwas zu enges Kostüm. Gewiss wusste sie, wovon sie sprach.
„Es gibt hier jemanden, den Sie mit Ihrer Aussage sicher sehr glücklich gemacht hätten.“
Erika fixierte ihn kühl mit ihren graublauen Augen.
„Schade, dass Sie es nicht sind“, erwiderte sie.
„Hmhm.“ Dr. Ohio wurde es wieder unbehaglich. Er sah sich verlegen um und scharrte mit seinem Schuh etwas Erde weg.
Nach der Beerdigung gingen sie noch ein Stück spazieren, an der Ammer entlang durch den Park an der Uni. Dort in der Nähe lag Erikas kleine Wohnung, wo es den Berg hinaufging, hinter dem Arsenal-Kino. Höpfner hatte Ohio davon erzählt, der Gründer des Kinos war mit ihm auf die Schule gegangen. Sie hatten dort später oft und lange im Café gesessen und er war nachts stockbetrunken zurück nach Waldenbuch gefahren.
Erika hätte auch im Schwesternwohnheim des Sanatoriums ein Zimmer bekommen, aber das war ihr zu nahe an ihrem Job. Sie wollte in ihrer Freizeit möglichst wenig von der Klinik sehen und hören. Das schloss Dr. Ohio nicht ein. Er hatte seine Gehülfin nie gefragt, ob sie einen Narren an ihm gefressen hatte. Aber dass es so war, behaupteten nicht nur beide Dr. Manstorffs. Heinz zwinkerte Ohio immer jovial zu, wenn die Sprache auf seine Assistentin kam. Ohio schrieb es seinem versteckten Schuldkomplex zu, den er ihm gegenüber ohne Frage haben musste, seit er Brigitte geheiratet hatte.
Er deutete auf eine Reihe alter Häuser am Stadtgraben, die den Anfang der Altstadt bildeten.
„Dort drüben habe ich öfter mit ihm Schach gespielt“, sagte er.
„In dem dreckigen Haus da hinten?“
„Ja. Entweder da oder ein paar Straßen weiter im ,Storchen‘ “. Man kann dort rauchen, das war wichtig für Höpfner. Die Gaststätte hier heißt ‚Zur Träumenden Taube’. Da treffen sich viele Schach- und Kartenspieler.“
„Ein sehr poetischer Name für eine Eckkneipe“, meinte Erika. Dr. Ohio lächelte.
„Ja. Aber er beruht auf Tatsachen. Passen Sie auf.“
Sie gingen hinüber zur Unterführung, die den Park mit der Altstadt verband. Mitten auf dem Weg vor einer Parkbank und einer kleinen, silbernen Mülltonne saß eine gewöhnliche, steingraublaue Taube. Sie saß nur da, pickte nichts und lief nicht herum.
„Da“, sagte Dr. Ohio leise. Die Taube bemerkte sie nicht, auch als sie sich weiter näherten. Sie saß da, ihr leerer Blick war auf irgendeinen Gegenstand gerichtet, den niemand kannte. Ihr Kopf bewegte sich langsam, wie in halbem Schlaf. Erst als sie schon fast auf sie traten, schüttelte sie sich, als schrecke sie aus einem schweren Traum hoch, sah Erika und Dr. Ohio beinahe vorwurfsvoll an und flatterte zur Seite.
„Sehen Sie? Die träumende Taube“, sagte Dr. Ohio. „Ich habe sie auf einem Spaziergang mit Höpfner hier entdeckt.“
Erika sah der Taube erstaunt nach.
„Bestimmt hat sie etwas an den Augen“, sagte sie. Dr. Ohio verzog leicht den Mund.
Sie gingen in das Lokal und bestellten Kaffee.
„Sie haben wirklich viel mit Höpfner unternommen“, sagte Erika einfühlsam, als sie im Halbdunkel an einem der hölzernen Tische Platz genommen hatten. Ein paar wenige Gäste, ausschließlich Männer, saßen an den anderen Tischen, spielten Karten und tranken Bier. „Er muss Ihnen viel bedeutet haben.“
Ohio zuckte mit den Schultern.
„Ich weiß nicht. Es klingt so, als seien wir gute Freunde gewesen, das stimmt. Aber niemand ist darüber mehr überrascht als ich selbst. Hätten Sie mich letzte Woche gefragt, hätte ich gesagt, Höpfner ist lediglich ein flüchtiger Bekannter. Erst nach seinem Tod wird daraus eine Freundschaft. Oder ich habe es vorher nicht gemerkt. Wie schon so oft“, fügte er leise für sich hinzu.
„Diese Rituale in der Kirche und am Grab haben mich sehr irritiert“, schob er schnell hinterher, um eventuelle Fragen abzublocken. „Warum trinken alle aus einem Becher und warum werfen die Trauergäste Erde in das Grab? Ich habe das schon in Filmen gesehen, aber eigentlich nie darauf geachtet. In Japan würde man das für sehr unhygienisch halten.“
Erika lachte.
„Na ja, unhygienisch ist es schon, zumindest das Trinken aus einem Becher oder Kelch, obwohl der Priester den Rand jedes Mal mit einem Tuch abwischt. Aber Sie werden mir nicht glauben, wenn ich Ihnen sage, was es bedeutet. Es ist das symbolische Blut Christi, der für die Leiden und Sünden der Menschen gestorben ist. Eines Tages wird er uns alle erlösen und in den Himmel führen, heißt es.“
„Ich erinnere mich.“ Dr. Ohio schüttelte sich. „Eine sehr kannibalische Religion, das Christentum.“
Am nächsten Tag waren dieselben Leute in Höpfners Bibliothek versammelt wie beim ersten Treffen. Die Haushälterin, der Gärtner und die Köchin saßen wieder auf den Stühlen, die für sie bereitgestellt waren. Värie Wieri saß aufrecht auf der Kante eines Lesesessels. Nur eine Änderung gab es: Neben Dr. Laudtner hatte ein älterer Herr mit streng gescheiteltem Haar und randloser Brille hinter dem Schreibtisch Platz genommen. Es war ein Notar vom Nachlassgericht, der das Testament Höpfners korrekt und vollständig verlesen sollte.
Die beiden Erben, von denen Dr. Laudtner gesprochen hatte, erschienen zum festgesetzten Termin um 14.00 Uhr nicht. Der Anwalt und der Notar beschlossen, der Form halber noch eine halbe Stunde zu warten, die unter dem lauten Ticken einer alten Tischuhr auf dem Kaminsims, die Dr. Ohio vorher nie bemerkt hatte, quälend langsam verging.
Er trat ans Fenster und sah hinaus. Es war kühl draußen, immer noch frühlingshaft, und die Sonne hatte es nicht geschafft, durch den Hochnebel zu dringen. Aus irgendeinem Grund dachte Ohio an die träumende Taube, deren Gedankengänge er sich ebenso verschleiert vorstellte wie die dunklen Bäume des Tannenwalds, den die dünnen Nebelschwaden wabernd umfingen.
In der Bibliothek herrschte ein undeutliches Zwielicht, die kleinen Leselampen waren eingeschaltet, trugen aber nicht zu einer allgemeinen Erhellung des Raums bei, sondern strahlten stur auf die kleine Tischfläche unter sich. Dr. Laudtner war aufgestanden und unterhielt sich flüsternd mit Wieri, die Köchin und die Haushälterin tauschten leise einige Worte. Das Licht und der Staub der Bücher strickten die kleine Gesellschaft in ein fein gewebtes Netz und der Sekundenzeiger der Uhr schien immer auf derselben Stelle zu ticken. Nie wieder, dachte Dr. Ohio. Nie wieder ...
„So, ich denke, jetzt reicht es“, sagte Dr. Laudtner auf einmal laut in den Raum. Dr. Ohio und der Gärtner, der vielleicht ein bisschen eingenickt war, zuckten zusammen. Mit einem Blick auf die Uhr nickte der Notar. Ohio atmete auf. Die halbe Stunde war noch nicht ganz um, aber ehe die Zeit ihr Blatt ganz ausspielte, war es besser, zu beginnen. Und sollte doch noch jemand kommen, wäre das auch kein Problem.