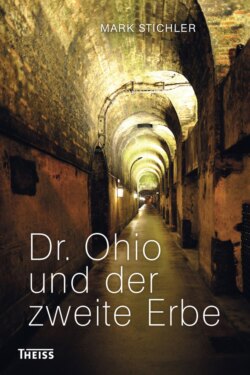Читать книгу Dr. Ohio und der zweite Erbe - Mark Stichler - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеGlitzernder Regen
und aus der dunklen Erde
steigt grün der Frühling
Höpfner war zum Ende des Frühlings gestorben. Doch schon, würde sein Rechtsanwalt Dr. Laudtner sagen. Überraschend, würde Dr. Ohio sagen. Er war erstaunt, wie kalt Höpfners Tod ihn ließ. Sie hatten sich über die Literatur kennengelernt, über japanische Haikus geredet und ziemlich regelmäßig Schach gespielt, in Höpfners Villa, in der „Träumenden Taube“, einer kleinen Tübinger Eckkneipe gegenüber dem Park am Stadtgraben, oder im „Storchen“, der etwas weiter in der Altstadt lag, in einer der schmalen, blumengeschmückten Gassen, in denen die einst krummen und schiefen Häuser renoviert waren und kaum noch an den Mief und Dreck des Mittelalters erinnerten, aus dem sie stammten. Ab und zu saßen sie auch auf der schmalen Veranda von Dr. Ohios kleinem Ärzte-Appartement. Die Wohnung war an das Sanatorium im Schönbuch angeschlossen, in dem er die psychiatrische Abteilung leitete.
Das Städtchen Waldenbuch in der Nähe war deutlich gewachsen, seit sich vor über 20 Jahren einige Kliniken und Sanatorien hier angesiedelt hatten. Dank des nahe gelegenen Tübingens mit der Universitätsklinik war die Doktorendichte ziemlich hoch und stieg immer noch. Viele der Ärzte hatten an den Hängen von Liebenau und in den umliegenden Dörfern günstige Grundstücke gekauft und gebaut. Junge Ärzte und ältere Junggesellen wie Dr. Ohio lebten allerdings oft in von den Kliniken bereitgestellten Appartements.
Ohio saß auf der Couch und ließ seinen Blick über das sanft gewellte Land schweifen, über die Wiesen und Felder und den tief hängenden, dunklen Wolkenhimmel, der an wenigen Stellen von Helligkeit durchbrochen wurde. Weit hinten in der Ebene ging ein heftiger Regenschauer nieder. Ein böiger Wind bog die Wipfel der Bäume im Park des Sanatoriums und die düsteren Tannen im Schönbuch.
„Klopstock“, flüsterte Dr. Ohio, als ein paar schwarze Krähen aufflogen und träge hinüber zu den sprießenden Feldern flappten. Die Wiesen vor dem Haus schimmerten graugrün in Erwartung des Regens.
Es klopfte. Dr. Ohio legte seine Brille auf den Couchtisch neben sich und fuhr mit der Hand über seine schmalen, dunklen Augen und die an einigen Stellen grau gewordenen, kurz geschnittenen Haare. Er erhob sich, seine Strickjacke und die ausgebeulte Cordhose schlotterten um seine Glieder. Vor der Tür stand seine Gehülfin. Erika nannte sich selbst Assistentin, aber Ohio fand, Gehülfin passe besser zu dem drallen, blonden Geschöpf in ihrem immer etwas zu eng wirkenden, weißen Krankenschwesternkleid, über das sie heute eine Strickjacke gezogen hatte.
Der Doktor hatte keine Ahnung, wer Erika eingestellt hatte – und warum. Mit der Zeit hatte er sich an dieses große Mädchen gewöhnt. Und er hatte sich daran gewöhnt, dass ihm, wenn er mit ihr auf den Gängen des Sanatoriums unterwegs war, die jungen Ärzte und die männlichen Patienten hinterhersahen. Erika achtete kaum auf die Blicke ihrer Umgebung. Wenn sie mit Dr. Ohio unterwegs war, schenkte sie nur ihm Beachtung.
Neugierig linste sie an ihm vorbei in den Flur. Sie war noch nie hier gewesen.
„Hallo Doktor“, sagte sie mit honiggelber Stimme. Ohio lächelte.
„Hallo.“ Er nahm seinen Arztkittel vom Haken neben der Tür und zog ihn über seine grobe Strickjacke. „Ich bin fertig. Wir können gehen.“
„Hm.“ Erika war unzufrieden.
„Wir haben noch Zeit“, sagte sie. „Ich habe von ... das mit Höpfner erfahren und vielleicht möchten Sie mit jemandem reden?“ Sie lächelte ihn mit geschlossenen Lippen an, ein leichtes Beben schien sie zu erschüttern, das bei Dr. Ohio ein Gefühl von Ungewissheit oder Ahnung angesichts eines schon lange nicht mehr ausgebrochenen Vulkans erweckte. Sie sah ihm gerade in die Augen.
„Je früher wir beginnen, desto früher sind wir fertig“, beeilte er sich zu sagen und stapfte an ihr vorbei, bevor sie eventuell seine Hand nehmen oder etwas ähnlich Mitfühlendes versuchen konnte.
Das Gebäude mit den Appartements wurde das Ärztehaus genannt und war durch einen unterirdischen Gang mit dem Hauptgebäude des Sanatoriums verbunden. Die Patienten waren meistens wohlhabende Leute: Manager mit Burn-out-Syndrom, gealterte Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich hierher zurückgezogen hatten, um ihren Spleen zu kultivieren, und einige degenerierte junge Männer, die eine lange Ahnenliste vorweisen konnten. Die wenigen, die nicht freiwillig hier waren, wurden fast ausschließlich von Dr. Ohio betreut. Auch hier stammten viele aus wohlhabenden Familien. Einige Patienten mit schweren psychischen Störungen nahm Dr. Manstorff, der Chef der Klinik, auch aus humanitären und Prestigegründen auf.
Er und seine Frau kümmerten sich hauptsächlich um die Wehwehchen der Schönen und Reichen, deren hauptsächliches Problem oft das in Alkohol ertränkte Desinteresse der Öffentlichkeit war. Dr. Ohio war dagegen für die „wahren Irren“ verantwortlich, wie Dr. Manstorff manchmal kichernd sagte. Brigitte, seine Frau, die ebenfalls als Ärztin im Sanatorium arbeitete, verdrehte dann die Augen und Ohio sagte nichts.
Er ging mit Erika den langen, niedrigen und spärlich beleuchteten Gang zum Hauptgebäude entlang. Seine Schuhe gaben auf dem gelblichen Linoleumboden ein leichtes Quietschen von sich. Weiter vorne flackerte das weiße Licht des Aufzugs und ein leichter Windzug kam aus dem Treppenhaus. Die Tür des Lifts öffnete sich und Dr. Brigitte Manstorff stieg aus. Sie winkte, als sie Ohio und Erika sah. Dr. Ohio kam kurz aus dem Tritt, als ob sein Herz einen kleinen Sprung gemacht hätte. Er fing sich aber sofort wieder.
„Ah“, lachte Dr. Manstorff. „Das seltsame Paar.“ Sie zwinkerte Ohio zu.
„Höpfner ist tot“, sagte Erika dunkel, blitzte Dr. Manstorff aus ihren blauen Augen an und ging weiter.
„Was?“ Dr. Manstorff sah Ohio betroffen an und fasste ihn am Arm. Ohio zuckte ein klein wenig zurück. Sie runzelte die Stirn.
„Das tut mir leid. Entschuldige“, sagte sie, und leiser: „Das war dein einziger Freund hier, nicht wahr?“
„Wir Japaner legen mehr Wert auf die Familie.“ Dr. Ohio lächelte vielsagend.
Dr. Manstorff schüttelte den Kopf. Sie war noch immer eine schöne Frau, auch wenn sie die 40 schon weit hinter sich gelassen hatte. Ihre Stirn war nicht mehr so glatt wie früher, um den Mund zogen sich ein paar scharfe Falten und an den Hüften hatte sie etwas zugelegt. Aber ihre braunen Locken, die sie heute zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, ihre forschenden, blaugrauen Augen und ihr spöttisches, kleines Lächeln waren wie früher. Dr. Ohio konnte es nie vergessen.
Wie lange ist das her, dachte er, während er sie betrachtete. Sie hatten in Tübingen zusammen studiert. Brigitte war gerade 20 gewesen und er nur wenige Jahre älter. Als Austauschstudent war er für ein Jahr von der Universität in Yokohama gekommen. Und jetzt war er immer noch hier. Wegen ihr, ging ihm durch den Kopf. Aber sie hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als Heinz zu heiraten. Seinen Kumpel Heinz Manstorff ...
„Ich würde dir gerne helfen“, sagte sie. „Oder, wenn du nicht allein sein möchtest ...“
„Ich bin in Begleitung“, erwiderte Ohio und deutete mit einem Kopfnicken auf Erika, die einen Fuß zwischen Tür und Aufzug geklemmt hatte und wartete.
Dr. Manstorff verdrehte die Augen.
„Mmmh. Dieses kleine ...“, sie warf Erika einen Blick zu, „... oder große Biest.“ Dann wandte sie sich wieder zu Ohio. „Du weißt, was ich meine.“
Er lächelte.
„Nicht genau, Brigitte. Und Erika ist kein Biest. Sie ist meine Gehülfin.“ Das ü hatte er von einem Schriftsteller abgeschaut und er fand, dass es Erikas Position etwas mehr Würde verlieh.
„Wie sie mich behandelt, ist, gelinde gesagt, eine Frechheit“, sagte Brigitte ärgerlich. „Ich bin immerhin ihre Chefin.“
„Oh“, hauchte Dr. Ohio. „Ich dachte, ich wäre ihr Chef.“
„Du weißt, wie ich das meine.“ Dr. Manstorff nickte ihm fragend zu. Ihre Stimme wurde weicher: „Ich will nicht mit dir streiten wegen der da. Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Ruf an ... oder ich schau heute Abend mal kurz bei dir vorbei.“
Ohio zuckte mit den Schultern.
„Ich weiß nicht, ob ich heute Abend da bin.“
Brigitte lächelte.
„Einen Versuch ist es wert.“ Sie drückte noch einmal seinen Arm und ging dann schnell den Gang entlang.
Ohio seufzte und stieg zu Erika in den Aufzug.
„Diese ...“, sagte Erika, als die Tür zufiel.
Ohio hob die Hand und verzog das Gesicht wie bei einem plötzlichen, körperlichen Schmerz.
„Bitte.“
„Schon gut, schon gut“, beruhigte ihn seine Gehülfin. Sie würde nichts sagen. Jetzt nicht ...
Sie stiegen im zweiten Stock aus, in dem Dr. Ohios Büro und seine Behandlungsräume lagen. Heute war Sonntag und es gab nicht viel zu tun. Ohio hatte Bereitschaft und wollte ein bisschen Papierkram erledigen. Außerdem hatte Erika einen Termin vereinbart mit einem Neuankömmling, der eigentlich mehr in das Schema der Manstorffs passte, Dr. Ohio aber unbedingt persönlich kennenlernen wollte.
Sie betraten sein Sprechzimmer. Ohio blieb einen Augenblick lang stehen und ging dann weiter durch die Verbindungstür zu seinem Büro. Es bot beinahe die gleiche Aussicht wie seine Wohnung. Nur war hier alles in hellem Beige und Weiß gehalten. Bei ihm standen alte Ledersessel und eine Couch mit Holzrahmen. In seinem Büro waren nur die Beine seines Schreibtischs aus Holz, der Rest war Glas, Metall, Plastik.
Der Schreibtisch stand quer vor der Fensterfront, die den Blick auf die Felder und Wälder auf der gegenüberliegenden Seite des Tals freigab, sodass Dr. Ohio mit dem Rücken dazu saß. Entfernt waren die ersten Häuser von Glashütte zu sehen. Rechts und links an den Wänden seines Büros hingen die üblichen Bilder. Nichts Aufgeregtes, alles in beruhigenden Farben gehalten. Einzig eine kleine Tusche- oder Tintenkleckserei, die ein bisschen an einen Rorschachtest erinnerte, fiel aus dem Rahmen. Schräg gegenüber davon befand sich eine kleine Sitzecke mit einem Glastisch und cremefarbenen Sesseln. Alles in allem kein unangenehmes Büro, aber heute Nachmittag fiel es Ohio schwer, auf seinem breiten Bürosessel Platz zu nehmen.
Er schwenkte ihn herum und sah hinaus aufs Land.
„Heute ist es, als würde es schon wieder Herbst werden“, sagte er leise und spielte mit einem Bleistift. „Als würde die Zeit es noch eiliger haben und schon ganze Jahreszeiten ausfallen lassen.“
Erika schloss die Tür.
„Soll ich den Termin absagen?“, fragte sie vorsichtig.
„Ach, ich bitte Sie. Behandeln Sie mich nicht wie ein kleines Kind.“ Ärgerlich drehte er seinen Sessel wieder dem Zimmer zu.
In diesem Moment wurde die Tür aufgerissen und ein breiter Mann mit einem strahlenden Lächeln kam herein. Er trug eine offensichtlich brandneue Freizeitausrüstung, braune Sneakers, weiße, zu enge Hosen und ein gestreiftes Polohemd, auf dem ein Abzeichen prangte, das jedem Golf- oder Yachtclub Ehre gemacht hätte. Seine Augen strahlten wie sein Lächeln aus einem roten, runden Kopf, der spärlich mit dunkelbraunen Haaren bewachsen war.
„Dr. Ohaijoh!“, rief er und eilte mit ausgestrecktem, wollebewachsenem Arm auf Ohio zu. „Walton. Arthur Walton.“
„Es ist eigentlich nicht üblich, sich selbst hereinzulassen“, sagte Dr. Ohio kühl und reichte ihm die Hand. „Man wartet im Sprechzimmer, bis man aufgerufen wird ... oder hereingebracht.“
Der Mann hob entschuldigend die Hände.
„Es war niemand da. Aber wenn ich gewusst hätte, dass Sie so aparten Besuch haben ...“ Er deutete mit dem Kopf auf Erika und zeigte eine Reihe weißer Zähne.
„Das ist meine Gehül... meine Assistentin.“
„Ja, ja. Ja, ja“, sagte der Mann und rieb sich die Hände. „Dr. Ohaijoh, Sie glauben gar nicht, wie ich mich freue, Sie kennenzulernen. Sie sehen, Ihr Ruf eilt Ihnen voraus bis in ferne Länder.“ Er deutete mit dem Daumen auf sich.
„Setzen Sie sich.“ Ohio zeigte auf einen Stuhl. „Und es heißt Ohio. Wie man es schreibt. Ich bin nicht aus den Südstaaten. Ich bin Japaner.“
Er bedeutete Erika, aus dem Zimmer zu gehen und die Tür zu schließen.
„Ja, ich sehe, ich sehe. Dr. Ohaijoh ...“, hörte sie, bevor sie die gedämpfte Tür zuzog. Sie verdrehte die Augen und setzte sich an ihren Schreibtisch im Vorzimmer.
Später schlurfte Dr. Ohio den Gang entlang zurück zu seinem Appartement und öffnete die Tür. Es dämmerte bereits und durch das große Panoramafenster kam ein unbestimmtes, blaues Licht. Hinten am Horizont schimmerte in einem schmalen Streifen ein Rest silberne Helligkeit. Dr. Ohio blieb einen Augenblick im Dunkeln stehen und sah hinaus, bevor er die Stehlampe bei der Couch einschaltete.
Seine kleine Wohnung war pragmatisch eingerichtet. Die kleine Sitzecke mit der Couch und den zwei Sesseln, deren Leder schon etwas zerschlissen war, standen um einen sehr niedrigen Tisch. Daneben befand sich die Tür zum Balkon. Das Zimmer wirkte geräumig, denn einen Esstisch oder sonstige Sitzgelegenheiten gab es nicht, sah man von den zwei Hockern an einer Art Theke ab, die eine schmale Küchenzeile vom Rest der Wohnung trennte. An der hinteren Front zog sich eine lange Wand mit Büchern entlang. Dazwischen, etwas tiefer eingelassen, standen einige Flaschen und Gläser.
Ohio schenkte sich einen Whisky ein und ließ sich auf die Couch fallen. Da saß er und starrte eine Zeit lang auf die matte, nachtblaue Glasscheibe des Fensters, das den Raum reflektierte. Auf die Stehlampe und ihr gedämpftes Licht, das Regal, die Sitzecke und, als dunklen, kleinen Schatten mit seltsam eingezogenem Nacken und kleinem Kopf, sich selbst. Um ihn herum herrschte eine Stille, die fast spürbar war, wie Materie fing sie an, auf dem Raum zu lasten, ihn auszufüllen, sie versetzte den Drink in seiner Hand in eine leichte Schwingung. Dann klingelte das Telefon. Mit einem leichten Zittern stellte Dr. Ohio das Glas auf den Couchtisch, ging zur Theke und nahm den Hörer ab.
„Dr. Ohio“, sagte er leise.
„Spreche ich mit Dr. Ohio?“, drang eine dünne, etwas künstlich klingende Stimme aus dem Hörer.
„Hier Dr. Ohio“, sagte er, dieses Mal etwas lauter.
„Hier spricht Wieri, Dr. Ohio.“ Ohio konnte mit dem Namen nichts anfangen. Schweigen.
„Värie Wieri. Der Assistent von Herrn Höpfner“, sagte die Stimme schließlich.
„Ah. Herr Wieri.“ Vor Dr. Ohio stieg das Bild eines schmächtigen, nicht sehr großen Mannes mit schütterem, hellbraunem Haar und wässrigen Augen auf. Die Augen waren das Raumeinnehmende in seinem Gesicht. Wässrig wie Leitungswasser und doch durchdringend. Prüfend. Dr. Ohio konnte sich durch seine asiatische Undurchdringlichkeit vor ihnen schützen, aber sie waren ihm unangenehm. Wieri, der Assistent von Höpfner. Der gewesene Assistent, fügte Ohio in Gedanken hinzu.
„Ja, Dr. Ohio“, sagte Wieri zögernd. „Ich nehme an, Sie haben bereits erfahren, was passiert ist?“
„Ich weiß nur, dass er gestorben ist“, sagte Ohio. „Näheres ist mir nicht bekannt.“
„Tja.“ Kurzes Schweigen. „Er ist verbrannt.“
„Was?“ Dr. Ohio strich sich unwillkürlich über den Unterarm. „Du meine Güte. Wie ist denn das passiert?“
„Auf dem Anwesen stand eine Scheune. Dort war der Öltank für das Haus deponiert. Sie wissen, es war ein sehr altes Haus ... Soweit die Feuerwehr es schon sagen kann, müssen Dämpfe und ein Kurzschluss den Tank zur Explosion gebracht haben. Herr Höpfner befand sich zu dem Zeitpunkt in der Scheune ...“
Dr. Ohio lief eine Gänsehaut über den Rücken. Er wusste nicht, ob sie von der Vorstellung herrührte, von einem Öltank in die Luft gejagt zu werden, oder von der Kühle der Stimme, die ihm das Ereignis schilderte.
„Ich habe nicht viel Zeit“, fuhr die eisige Stimme zögerlich fort. „Wie Sie sich denken können. Ich wollte Ihnen nur kurz die näheren Umstände mitteilen.“
„Ja, ich danke Ihnen“, sagte Dr. Ohio und wusste nicht, was er noch sagen sollte. Weitere Fragen waren eigentlich unnötig.
„Ich hoffe, die Verwandten sind informiert?“, sagte er überflüssigerweise noch.
„Es gibt keine Verwandten. Herr Höpfner war, soweit ich weiß, alleine. Gute Nacht, Dr. Ohio.“
„Nun ja, dann. Gute Nacht.“ Dr. Ohio legte auf, nachdem aus dem Hörer ein leises Klicken gekommen war. Er setzte sich wieder auf die Couch und nahm einen großen Schluck aus seinem Whiskyglas. Der Schnaps durchfloss ihn wie Feuer und Dr. Ohio vermeinte, für einen Augenblick körperlich zu spüren, zu wissen, wie es ist, in Bruchteilen von Sekunden in kleinste molekulare Teile zerlegt zu werden.
Dr. Ohio kannte Carl Höpfner seit ungefähr vier Jahren. Es war an einem verregneten Mittag gewesen, als sie sich kennenlernten. Ohio konnte sich sogar noch an den Tag erinnern. Es war ein Montag. Zuvor hatte er einen sehr anstrengenden Wochenenddienst hinter sich gebracht und wollte bei einem guten Buch entspannen. Er ging in Waldenbuch in eine Buchhandlung und suchte nach einem Roman.
„Inoue“, sagte er dem Angestellten, der neben ihm am Regal stand. „Yasushi Inoue. Er ist ein sehr bekannter Autor.“
„Das mag sein, aber wir können nicht alle Bücher auf Lager haben.“ Der Angestellte suchte mit den Augen das Regal ab, kam aber zum gleichen Ergebnis wie Ohio. Von Inoue war nichts da.
„Vielleicht können Sie mal in Ihrem Computer nachsehen?“, fragte Dr. Ohio vorsichtig.
„Das kann ich natürlich“, erwiderte der junge Mann gereizt. „Aber wenn es nicht im Regal steht, haben wir es nicht vorrätig. Ich muss es bestellen. Aber Sie sagten, Sie brauchen es sofort.“
„Sofort, ja“, brummte Dr. Ohio unschlüssig. Der Mann war nicht unfreundlich, aber auch nicht überdurchschnittlich hilfsbereit. Was war zu tun?
„Vielleicht könnten Sie ja trotzdem mal ...? Ich sehe mich so lange noch ein bisschen um.“
Der Angestellte rollte mit den Augen.
„Gibt’s irgendwelche Probleme? Kann ich vielleicht helfen?“, ertönte hinter ihrem Rücken eine tiefe, sonore Stimme. Beide drehten sich um. Dicht vor ihnen stand ein älterer Herr in einem feinen, dicht gewebten Wollmantel, auf dem die Regentropfen in runden Perlen lagen, und starrte den Verkäufer durchdringend an. Sein dunkelgrauer Haarkranz war hinten zu einem dünnen Zopf gefasst. Er war ungefähr so groß wie Dr. Ohio, aber mindestens doppelt so breit.
„Nein, danke“, sagte Dr. Ohio. „Ich habe ein bestimmtes Buch gesucht. Aber es ist nicht vorrätig.“
„So, so. Ein bestimmtes Buch“, sagte der Herr und sah weiterhin den Verkäufer an. „Und es ist nicht vorrätig. Darf man erfahren, was das denn für ein Buch sein soll?“
„Es ist von Inoue“, sagte der Verkäufer leise, und Dr. Ohio sah ihn nun seinerseits erstaunt an. Was war mit dem Mann los, der noch vor weniger als einer Minute eher mürrisch versucht hatte, ihn loszuwerden?
„Mhm. Von Inoue“, sagte der Herr im Wollmantel.
„Der Titel lautet ...“, der Verkäufer blickte Hilfe suchend Dr. Ohio an.
„,Der Sturm’“, beeilte Dr. Ohio sich zu sagen.
„Tja. Es ist nicht vorrätig. Nun ja, es kann ja nicht alles vorrätig sein, nicht wahr?“
Dr. Ohio nickte bestätigend.
„Aber dass gar nichts von Inoue im Regal steht, das finde ich schon fatal“, fuhr der Herr fort, und seine Kiefermuskeln zuckten in seinem breiten Gesicht. Die von der Kälte grauen Wangen bekamen ein ungesundes Rot. „Das ist, das ist eigentlich unverzeihlich. Finden Sie nicht?“
Der Verkäufer schien immer kleiner zu werden und versuchte, sich hinter Dr. Ohio zu verstecken.
„Also, es ist nicht so tragisch“, versuchte Dr. Ohio einzugreifen. „Ich suche mir ein anderes Buch.“
„Das mag schon sein“, sagte der Herr im Regenmantel und wurde immer lauter. „Aber was für ein Licht wirft das auf meine Buchhandlungen? Wir haben nicht einmal einen Literaten von einem solchen Ruf in unseren Regalen stehen. Was soll ich dazu sagen? Ein großartiger Schriftsteller, aber von den Buchhandlungen eines Charlie Höpfners schnöde missachtet? Nicht, dass alle Schriften dieses Mannes immer vorhanden sein müssten, so weit will ich nicht gehen. Aber ein, zwei Werke sollten sich doch auch in der letzten Hinterwäldlerfiliale meiner Buchhandlungen finden lassen. Liege ich da richtig?“
Dr. Ohio und der Verkäufer nickten eifrig. Aber das besänftigte Höpfner nicht.
„Und ausgerechnet die Japaner. Die Japaner. Sind Sie Japaner, mein Herr?“
Dr. Ohio nickte wieder und der Verkäufer stimmte mit ein.
„Ach ja. Ich liebe ihre Literatur. Und ihre Dichtung. Kennen Sie Haikus?“
„Ja“, sagte Dr. Ohio. Der Verkäufer zog es vor zu schweigen.
So hatten sie sich kennengelernt, Höpfner und Dr. Ohio. Es wurde eine Art Freundschaft daraus. Höpfner war tatsächlich nicht nur der Besitzer dieser einen Buchhandlung, sondern einer ganzen Kette von Buchhandlungen, die quer über die Republik verstreut lagen. Seit einiger Zeit hatte er sich in die japanische Dichtkunst vertieft und seine besondere Aufmerksamkeit galt den Haikus. Damit war auch seine Empörung in der Buchhandlung zu erklären, denn im Allgemeinen interessierte sich Charlie Höpfner nicht mehr besonders für die Filialen, die ihm aber immer noch ein luxuriöses Auskommen garantierten. Schon längst verwaltete seine Anwaltskanzlei die Geschäfte. Das war nicht unbedingt der Idealfall und schon längst hätte er sich um einen vernünftigen Repräsentanten kümmern müssen.
Aber Höpfner interessierte das nur am Rande. Er war immer ein enthusiastischer Mann gewesen, der sich für die verschiedensten Dinge begeistern konnte. Allerdings war sein Interesse jedes Mal nur begrenzt haltbar. Zuerst hatte er sein Sprachstudium abgebrochen, um die Buchhandlungen seines Vaters weiterzuführen. Anfangs ging das gut und Höpfner expandierte kräftig. Nachdem das Geld floss, sprang Höpfners Interesse über auf schnelle Autos und Frauen mit streng nach hinten gekämmten Haaren. Nach Ausflügen in den Sport und die Kunst wurde das Schachspiel seine Leidenschaft. In den letzten Jahren hatte er sich mit Religionen beschäftigt, hauptsächlich mit dem Calvinismus. Dort gipfelte sein Enthusiasmus in der Anstellung seines finnischen Assistenten Värie Wieri, der als Spezialist auf dem Gebiet galt. Und seit neuestem waren es eben Haikus.
Seit jenem Nachmittag in der Buchhandlung trafen sich Dr. Ohio und Höpfner öfter und gingen in Tübingen im Park bei der Uni oder auf der Neckarinsel spazieren. Am Wochenende war immer viel los dort, Spaziergänger, Familien mit Kindern und Hunden. Angestrengte Studenten stocherten ihre Kommilitonen und Freundinnen in ihren Kähnen mehr schlecht als recht den Fluss entlang, vorbei an den Fachwerkhäusern, die den Rand der Altstadt markierten. Aber an den anderen Tagen war es ruhig da draußen am Fluss, der die Stadt in einen alten und einen neuen Teil trennte. Dr. Ohio mochte vor allem die Vormittage im Herbst, wenn sich der Nebel des Neckartals über den Fluss und die Insel legte, wenn das Zeitalter keine Rolle mehr zu spielen schien und man nie wissen konnte, wer einem gleich aus welcher Zeit aus dem Nebel entgegenkommen würde. Die Stadt war dann nur noch schemenhaft zu erkennen und manchmal ragte das Dach des Schlosses oder der Kirchturm, oberhalb des Nebels von bleichem Sonnenlicht bestrahlt, aus dem Dunst.
Sie gingen langsam durchs raschelnde Laub bis zum Silcherdenkmal, das grün und verloren zwischen den Bäumen der Allee auftauchte, und unterhielten sich über japanische Dichter und Verse. Manchmal brachte Ohio Höpfner ein kleines Bändchen mit Haikus mit. Erst später begannen sie, in der „Träumenden Taube“, im „Storchen“, bei Dr. Ohio oder in Höpfners Villa eine Partie Schach zu spielen.
Höpfners eigentliches Bestreben war es, eigene Haikus zu verfassen. Er wollte das Prinzip durchschauen und seine eigenen Gedichte zur Perfektion bringen. Von der Perfektion war er nach Ansicht Ohios allerdings weit entfernt und sie führten oft hitzige Debatten. Deren Nichtigkeit löste bei Wieri, wenn er ab und zu den Kopf in Höpfners Bibliothek steckte, nur verständnisloses Kopfschütteln aus. Eines Tages hatte Höpfner Ohio sogar gebeten, sein Lehrer zu sein. Ohio brach in Lachen aus – und das kam nicht oft vor.
„Höpfner“, sagte er. Sie nannten sich beim Nachnamen, denn Dr. Ohio wollte nicht „Charlie“ sagen. „Höpfner, ich bringe vielleicht einen halbwegs ansehnlichen Haiku zustande. Aber ich bin weit davon entfernt, irgendjemandes Lehrer zu sein. Und so soll es auch bleiben.“
Und jetzt war Höpfner tot.
Samtblaues Dunkel,
helle Nadeln durchbohren
die erstickende Nacht
Es war ein Elend. Ohio war vor der Whiskyflasche auf der Couch eingeschlafen und wachte im trüben Morgengrauen auf. Seufzend hob er den Kopf und warf einen Blick zum Fenster hinaus. Wolkenfetzen trieben vorbei, ab und zu war ein Stück blauer Himmel zu sehen. Neben seinem Glas lagen Stift und Papier, aber nichts war daraufgeschrieben.
Dr. Ohio fuhr sich durch die Haare, stand auf und ging ins Bad. Der Spiegel zeigte ihm einen Mann mit gräulicher Haut, auf den schmalen Wangen sprossen ein paar spärliche Bartstoppeln. Unterhalb der Augen hatten sich leicht violette Ringe gebildet. Seine vollen, angegrauten Haare standen in Büscheln vom Kopf ab.
Ohio warf dem Mann im Spiegel einen beinahe erschrockenen Blick zu. Dann putzte er die Zähne, um den trockenen, etwas säuerlichen Geschmack der letzten Nacht aus dem Mund zu spülen. Er ging in die Küche und kochte Kaffee, als das Telefon klingelte.
Sie ist nicht gekommen, dachte Ohio. Natürlich nicht.
„Brigitte. Ich weiß schon. Du hast es nicht geschafft“, sagte er mit leichtem Spott in den Hörer.
„Wie bitte?“ Die weibliche Stimme am anderen Ende war irritiert. „Spreche ich mit Dr. ...“, sie zögerte leicht, „... Ohaijo?“
„Oh, Entschuldigung“, sagte Dr. Ohio verwirrt. „Ich habe jemand anderen erwartet. Es heißt Ohio, wie man es schreibt. Ich bin Japaner, nicht aus den Staaten.“
„Aha. Dr. Ohio.“ Die Stimme räusperte sich. „Hier spricht die Sekretärin von Dr. Laudtner, Dr. Ohio. Dr. Laudtner ist der Anwalt von Herrn Höpfner ...“ Sie zögerte.
Ohios Nackenhaare sträubten sich.
„Ja?“, fragte er.
„Dr. Laudtner lässt fragen, ob Sie wohl heute Nachmittag um 17.00 Uhr in Herrn Höpfners Bibliothek kommen könnten? Er hat etwas mit Ihnen zu besprechen.“
„Wie viel Uhr ist es denn, bitte?“, fragte Dr. Ohio unpassenderweise zurück.
„Äh, es ist gleich neun. Oh, Entschuldigung. Habe ich Sie etwa geweckt?“
„Nein, nein“, beeilte sich Ohio zu sagen. Er überlegte. Bis 17.00 Uhr müsste er eigentlich alles erledigt haben. Und sollte doch etwas sein, könnte sich Erika darum kümmern.
„Ist gut. Ich komme. Auf Wiedersehen“, sagte er und legte auf. Nachdenklich schenkte er sich eine Tasse Kaffee ein und setzte sich an die Küchentheke.