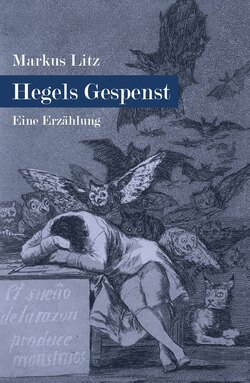Читать книгу Hegels Gespenst - Markus Litz - Страница 6
ОглавлениеDie erste Nacht
Es ist gegen neun Uhr abends, als Hegel sein Haus am Kupfergraben erreicht. Der Gedanke einer bevorstehenden Verwilderung der Zukunft läßt ihm während der holprigen Fahrt auf dem vom Regen geschwärzten Kopfsteinpflaster mehrmals den Atem stocken. Er memoriert Namen, mischt wirkliche und erfundene. Eine Prozession imaginärer Larven, die nicht aufzuhalten ist. Auf halbem Weg spürt er einen kleinen Schmerz am linken Auge; eine Nadel, die ins Tränenbein sticht. Er hört den Regen nun deutlich, doch diesmal beruhigt es ihn nicht. Auf dem schwarzen Pflaster glaubt er plötzlich etwas aufblitzen zu sehen, was eine entfernte Ähnlichkeit mit einem Raubtierfell haben könnte. Sicher nur eine getigerte Laune der Einbildung.
Alles ist mehr oder weniger in Auflösung begriffen, denkt er, während ihm die Haustür von einem weiblichen Schatten geöffnet wird. Die Aufwartefrau ist verschnupft und macht ein griesgrämiges Gesicht, als sie ihn erblickt. Die Kinder seien bereits zu Bett und seine Frau noch bei einer Freundin, die auch an einem Katarrh litte.
Alle sind krank, denkt sich Hegel, während er den Stoß Zeitungen sortiert, der auf dem Tisch im Empfangszimmer liegt. Krank und verdorben. Lauter Zerfall, ungeordnete Lebensreste. Ein Berg von zusammenhanglosen Vorgängen und Tatsachen. Das ist der Kehrichthaufen der Geschichte. Man sollte sämtliche Zeitungen verbrennen, und mit der Asche andere Namen in den Staub schreiben.
Unter dem Stapel der Neuigkeiten findet sich auch ein sorgfältig ausgeschnittener kleiner Artikel über seine Rede anläßlich des dreihundertsten Jahrestages der Augsburger Konfession. Gänzlich verdreht, meint er, während er den Artikel nochmals überfliegt, alles nur halbgares Zeug. Zerstörung der Familie durch den Zölibat, Vergötzung der Armut und Vernichtung des Fleißes durch Faulheit, Auflösung der Gewissenhaftigkeit durch blinden Gehorsam, all das seien die Krebsübel des Katholizismus, welche die protestantische Konfession hingegen längst hinter sich gelassen habe. Meinungen, halbgare Gedanken.
Es kommt ihm mit einem Mal seltsam vor, was er da gesagt und geschrieben hat. Als hätte nicht er, sondern ein Anderer dieses geschrieben. Die Worte zerfallen einem im Mund, zerbröckeln im Nachdenken. Unaufhörlicher Gedankenabbau. Am besten geht man ins Bett und überläßt sich seinen Träumen. Dann kommt der Schlaf und mit ihm die heilsame Auflösung der Vernunft im Ungeformten. Keine unfruchtbaren Ideen mehr hegen.
Er erinnert sich, was er gestern gelesen hat, eine kleine Frühschrift des alten Kant, die „Träume eines Geistersehers“. Ein Geist, der Vernunft besitzt, muß folglich auch real sein. Was dieser Gedanke für Folgen haben könnte. In unseren Tagträumen begegnen uns nämlich unzählige Wesen unerklärlicher Herkunft, und sie sprechen auch noch zu uns. Da diese Gestalten tatsächlich unseren Gedanken entsprungen sind, kann ihnen auch ein gewisses Maß an Vernünftigkeit nicht aberkannt werden. Aber das heillose Durcheinander ihrer Worte und Handlungen verursacht eine Verwirrung, die sich im Nachdenken niemals auflösen ließe. Wenn all das Kopfgewimmel wirklich wäre, dann würde jene andere Wirklichkeit die begreifbare Welt zweifellos zum Einsturz bringen.
Er ruft die Aufwartefrau und läßt sich einen Cognac kommen. Vor dem Schlafengehen bewirkt dieses Getränk zuweilen eine vorübergehende Beruhigung seiner Gedanken, ein sanftes Hinübergleiten in einen anderen Zustand, der keinerlei Ähnlichkeit mit dem vorangehenden besitzt.
Die Wachstränen am Kerzenleuchter, und eine Handbreit darüber das flackernde Licht. Nicht in die Flamme hineinschauen: es könnte das Ende bedeuten. Etwas schwirrt durch das Zimmer. Die Aufwartefrau muß das Fenster offen gelassen haben. Fliegen sind eine Plag. Ihre nervtötende Unruhe, die abscheuliche Vorliebe für Exkremente, das tausendfach einfältige Auge, welches nichts zu erkennen weiß. Ein Tier, das niemals hätte erschaffen werden sollen. Aber die Logik der Schöpfung unterliegt ganz anderen Gesetzen. Diese bleiben ihm unerfindlich, und vielleicht ist es auch gut so.
Er läßt sich in dem kleinen Sessel nieder, der noch aus dem Besitz seiner Eltern stammt. An der Wand hängt ein Spiegel, in den er als Kind gern geschaut hat. Es ist ein gewölbter Rundspiegel in einer wurmstichigen Eichenholzfassung. All die Gestalten, welche er einfängt, erscheinen darin verkleinert und zugleich auch ein wenig verzerrt. Durch die künstliche Vergrößerung des Blickwinkels wird der Raum jedoch scheinbar weiter, und das schwerlich Einsehbare rückt plötzlich in das Gesichtsfeld.
Die Kinderaugen erkannten, was er jetzt sieht: Ein schwarzer fliegenähnlicher Punkt am oberen Spiegelrand vergrößert sich langsam, verwandelt sich in ein Gesicht. Es ist ganz schwarz, nur das Weiße in den Augen tritt überdeutlich hervor. Eine Hand greift nach dem Gesicht, versucht es wegzuwischen. Es ist eine schneeweiße Frauenhand, die zu einem anderen Körper gehören mag. Und eine erträumte Stimme säuselt hinzu:
Oh, Teufel! könnte
Die Erde sich von Weibertränen schwängern
Aus jedem Tropfen wüchs ein Krokodil –
Mir aus den Augen fällt ein Splitter, der auf dem Boden zu einem Felsbrocken wird. Das ist die Last der ungehegten Wünsche. Jetzt scheint ihre Form deutlich umrissen: Es könnte eine versteinerte Schlange sein, die wie eine Felsnadel in den Himmel ragt. Irgendwo in der Ferne, in einem Reich, wo die Löwen umgehen, gibt es sie wirklich. Jebel Barkal: Der reine Berg. Aus ihm wird alles hervorgegangen sein. Der Himmel und auch die Erde, und ebenso das, was noch dazwischen liegt.
Im Zwischenreich hat alles seine Stimme. Das Lamm spricht zum Löwen und übergibt ihm den Schlüssel der Nacht. Im Johannisstrauch lodert ein goldgelbes Meer, und seine Sonnen vergeben den dornigen Blicken. Die Hyäne schreit den kalkweißen Mond an, und denkt dabei vielleicht an den Hasen und dessen erloschenes Feuer. Über dem Sand und den Steinen schweben die Adler mit blutigen Schwingen. Es gibt nichts, was es nicht geben kann: Das ist der Trost jeglicher Einbildung.
Das schwarze Gesicht hat noch keinen Namen, wohl aber eine Stimme. Und diese spricht in einer Sprache, die einem merkwürdig vorkommt: als hätte die Fremde ihren eigenen Atem verstoßen. Die Spiegelgestalt wird immer größer, je länger sie die Sätze zu einem Scheiterhaufen der Sprache aufschichtet. Flammende Sätze, die in dieser Glut aufwirbeln. Die Gestalt reicht schließlich über den Spiegel hinaus. Dann ist sie ganz nah und steht vor dem Träumenden. Keine Macht der Stille vermag sie jetzt aufzuhalten.
Und die Sprache spricht. Im Laufe der hingemurmelten Erzählung wird jenes fremde Wortreich deutlicher, sogar verständlich, und mündet schließlich in die folgende Geschichte:
Der alte Hase kochte sein Essen. Das sah die Hyäne, schlich heran und sagte: »Hase, einen guten Tag«. Der Hase sah sie von der Seite an, sprach: »Dir auch«, und kochte weiter, worauf die Hyäne einen Kratzfuß machte und grinste. »Was willst du«? fragte der Hase. »Dich um etwas bitten«, sagte die Hyäne. – »Was denn?« – »Bei mir zu Hause ist das Feuer ausgegangen. Um etwas Feuer möchte ich dich bitten«.
»Da hast du’s«, sagte der Hase und gab ihr einen brennenden Kienspan. Die Hyäne nahm ihn, ging ihres Weges und – löschte ihn aus. Dann kam sie zurück.
»Bist du schon wieder da«? fragte der Hase.
»Ja, es ist mir etwas zugestoßen«.
»Was denn?«
»Das Feuer ist mir wieder erloschen«.
»Also, da hast du einen anderen Kienspan«.
Sie nahm ihn, ging und löschte ihn wieder aus.
Als sie wiederkam, sagte der Hase: »Mein Lieber, du siehst, daß ich Essen koche und darum hast du mit dem Feuer so viel Unglück«.
»Oh«, sagte die Hyäne grinsend, »das ist es nicht«.
»Doch, doch«, erwiderte der Hase. »Ich kenne dich, gefräßig bist du. Also, ich werde dir etwas vom Essen geben, aber dafür mußt du das Feuer anblasen. Es ist schon ganz herabgebrannt und wenn du hineinblasen wirst, wird das Essen rascher fertig werden«.
Da sagte die Hyäne, daß es gut sei, und setzte sich zum Feuer hin. Aber statt zu blasen, sah sie fortwährend nach dem Topf mit dem Essen hin, der dort an der Seite stand, und den der Hase erst, wenn das Feuer tüchtig brannte, auf den Herd setzen wollte. Und der Hase sagte: »Schau doch nicht so herum, sondern blase, sonst dauert’s noch länger. Nichts werde ich dir geben, bevor das Essen nicht gekocht ist. Also, sieh ins Feuer«.
Da blies denn die Hyäne hinein. Unterdessen holte der Hase das Fell eines Leoparden und nähte es der Hyäne auf den Rücken. Das machte er so fein und heimlich, daß die Hyäne es gar nicht spürte. Dann wurde das Essen fertig, der Hase aß, die Hyäne bekam ihren Teil, und wie sie fertig waren und sie wieder gehen wollte, sagte der Hase:
»Wie, das Feuer vergißt du«?
»Ach wirklich«, sagte die Hyäne und nahm jetzt zwei brennende Holzspäne und kehrte damit zu ihrem Hause zurück.
Wie sie so dahin hopste, erblickte sie aber das Leopardenfell, das hinter ihr her schleifte und da sie nicht wußte, daß es ihr auf den Rücken genäht war, erschrak sie und schrie: uj, uj. Dazu machte das Fell hinter ihr fortwährend: wawalaga, wawalaga, so daß sie in ihrer Angst flüsterte: »Der Leopard verfolgt mich« und immer schneller lief.
So kam sie zu ihrem Hause und wie sie hineinrannte, zerriß die Naht auf ihrem Rücken und das Leopardenfell fiel herab. Da sagte sie nun, als sie ins Zimmer hineinkam, voller Angst zu Weib und Kindern: »Meine Lieben, ein Unglück ist geschehen, ein Leopard hat mich verfolgt – da liegt er an der Tür«. Weib und Kinder fuhren entsetzt in die Höhe und blickten erschrocken hinaus und flüsterten: »Wirklich, es ist ein Leopard, der da vor der Tür liegt. Was sollen wir tun«?
Nun verging die Zeit und sie wurden hungrig. Es schmerzt gar sehr, wenn man hungert; und immerfort sprachen sie: »Wo sollen wir ein Essen hernehmen, wenn der Leopard sich von unserer Tür nicht wegrührt? Wie kommen wir nun an ihm vorbei«? Und wie der Hunger immer mehr schmerzte, sprach die Hyäne:
»Meine Kinder, es bleibt uns nichts, als daß wir miteinander wettringen. Wenn ich falle, bin ich euer Braten und wenn ihr fallet, dann seid ihr mein Braten«. Darauf weinten die Kinder und sagten: »Vater, Ihr seid stärker«. Die Hyäne erwiderte: »Das kann man nicht wissen, wir müssen es doch probieren«. So umfaßte sie ein Kind, warf es zu Boden und fraß es auf. Nach einer Zeit faßte sie ein zweites Kind, warf es zu Boden und fraß es ebenfalls auf; und so geschah es auch mit dem dritten und vierten Kinde, bis sie nur noch beide übrigblieben, der Mann und das Weib.
Da sprach er, wie er wieder fressen wollte, zu ihr: »Faß an, wenn ich falle, bin ich dein Braten, wenn du fällst, bist du mein Braten«, worauf das Weib sagte: »Du bist doch jetzt viel stärker, weil du gefressen hast«. Er antwortete: »Das kann man nicht wissen, man muß es probieren«.
Sie begannen zu ringen, und da erschrak er, das Weib warf ihn hin und sie lachte und sagte:
»Nun wird sie ihn fressen…«
Er lachte ebenfalls und sagte: »Warte, spielen wir noch einmal«.
Sie faßten sich wiederum an. Er wurde wieder geworfen und sie lachte:
»So, nun frißt sie ihn…«
Er erwiderte: »Das war ein guter Spaß. Warte, spielen wir zum dritten Mal«.
»Gut«, sagte sie und sie lachte, als sie jetzt geworfen wurde. Dann aber fraß er sie auf.
So war er nun allein und sagte: »Ja, der Hunger schmerzt gar sehr.« Und da er zu Hause nichts mehr zu fressen hatte, blickte er hinaus, ob sich nicht der Leopard endlich doch wieder entfernt hätte und sah, daß die Haut ganz zusammengefallen auf dem Boden lag. Nun traute er sich heran und erkannte, daß sie inzwischen vertrocknet war und daß ihn der Hase zum Narren gehalten hatte.
»Oh, der Hase, dieser Schwindler«, rief er darauf, »er ist schuld, daß ich mein armes Weib und meine guten Kinderchen alle verloren habe«! Und als er dann mit den anderen Hyänen zusammenkam, weinte er über die Hartherzigkeit des Hasen und die Schlechtigkeit dieser Welt.
So endet diese Geschichte und es beginnt eine neue: Jetzt nimmt die schwarze Gestalt den Träumenden an der Hand. Sie gehen durch die Mauer als wäre sie Luft. Es ist immer noch Nacht, und auf der Straße ist niemand zu sehen. Dennoch dieses Gefühl, verfolgt zu werden, und sei es bloß der eigene Schatten, der einen jagt. Stiefelschritte im Hirn, ein innerer Marsch, der zum Tod führen wird. Und das jähe Bedürfnis, sich in den Abgrund zu stürzen, irgendeinen. Verschlungen ist nun die ganze Welt. Wer versteht schon die Lektionen der Finsternis?
Der Träumende sieht die schwarze Gestalt von der Seite an: erst schüchtern, verzagt. Der Makel zu großer Höflichkeit angesichts eines Fremden. Kann es wirklich Gestalten geben, die sich in Schönheit auflösen? Wunderbare nächtliche Geschöpfe, schön und schrecklich. Ist es denn möglich, mit jemand zu sprechen, der gar nicht da ist? Er wagt also nicht, das Wort an jemand zu richten, der vielleicht schon im Begriff ist, sich in Nichts aufzulösen. Dieses Nichts: Es wäre schon etwas, nämlich das hinreißende und unsichtbare Gewand einer Schönheit.
Besser den Blick aufheben, um dieses Wesen genauer zu sehen: ein fremdartiges Gesicht. Eine schwarz glänzende Haut und das prächtige Gewand darüber. Er denkt zunächst, es sei ein Tigerfell, aber es ist etwas anderes, ein überquellendes Rot, das einen ganzen Körper füllen könnte mit seinem verborgenen Blut. Er hat etwas Ähnliches einmal auf einem verblassenden Gemälde in der königlichen Residenz gesehen: da war es ein Fürst einer untergegangenen Zeit, welcher einen prachtvollen Herrenrock aus purpurfarbenem Samt mit goldroten Tressen und Borten trug, justaucorps, wie es sich gehört. Und dieser hier trägt genau dasselbe Gewand, aber farbkräftiger, so daß sich sein Muskelspiel umso verlockender hervorhebt. Und den Kopf krönt ein kanariengelber Dreispitz, der das krauslockige Haar mühsam verdeckt.
Ein echter Edelmann, kein dahergelaufener Bursche. Sicherlich hat er einen fremdländischen Namen, und ist vielleicht sogar aus königlichem Geblüt. Jetzt macht er tatsächlich eine Art Kratzfuß, und sagt dann mit tiefer, durchaus wohlklingender Stimme „Untertänigst, Scardanelli.“
Irgendwann hat der Träumende diesen seltenen Namen bereits gehört. Es muß vor langer Zeit gewesen sein, denn die Erinnerung daran ruft nur ein schwaches Echo in seinen Gedanken hervor. Erinnert sich das Gehör, ist im Klang eines Namens die ganze Person schon enthalten? Scardanelli, Sgardanelle, Scaramelli. Aus dem Irgendwo steigt eine vage Erinnerung.
Blasser Nebel schwebt über dem schwarzen Pflaster. Durch dieses hingehauchte Weiß müssen wir, um dahin zu gelangen, wo das Weiß nicht mehr gilt. Die Stille hat keinen Schatten. Sie ist die leere Haut, aus der ein Körper entflohen ist, um sich in einem anderen wiederzufinden.
Der Träumende bleibt stehen, schaut wieder auf seine Hände, und bemerkt mit Erstaunen, wie weich, weiß und marmorkalt sie sind. Frauenhände. Er würde gerne von solchen Händen liebkost werden. Mit den Händen fängt die Verwandlung an. Daphnes Hände werden zu Zweigen, Apollons Finger zu Krallen des Adlers. Mit Krallenfingern schreibt es sich anders.
Im Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist ein Fenster erleuchtet. Der Träumende sieht eine Szene, wie zwei Figuren eines Schattenspiels. Vater und Sohn, Herr und Knecht. Der größere hebt die Hand, während der Kleinere sich duckt. Schon fällt ein Schlag. Stumm ist der Schrei, der zu Herzen geht. „Die Menschen sind hartherzig und die Welt ist schlecht“, sagt die schwarze Gestalt mit einer Kinderstimme.
Jetzt ist es Zeit. Die Nacht kann nicht ewig dauern. Sobald die Straße überquert ist, mag ein anderer Traum entstehen, der vielleicht schon der Wirklichkeit gefährlich nahekommt. Der Träumende sieht, wie das Lächeln des Schwarzen erstirbt. Mit seinem verschwindenden Lächeln, schrumpft auch er selbst, bis er schließlich nur noch ein dunkler Fleck ist, daumennagelgroß.