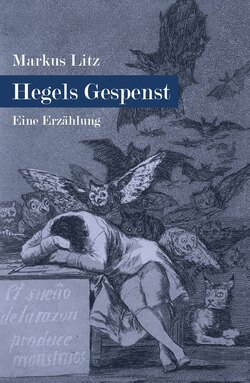Читать книгу Hegels Gespenst - Markus Litz - Страница 7
ОглавлениеDie zweite Nacht
Was unwirklich ist, das ist unvernünftig, denkt Hegel gleich nach dem Erwachen, während er ausgiebig erst seinen rechten und danach auch seinen linken Daumennagel in Augenschein nimmt. Keine Spur von einem schwarzen Fleck. Er bemerkt zum ersten Mal, das beide Nägel leicht spiegeln, und das milchig weiße Nagelmöndlein ein halbes Gesicht zeigt.
Der Traum tritt ihm wieder vor Augen, und es wird ihm unheimlich dabei. Jener unglückselige Spiegel, dieser Fleck am oberen Rand, die Verwandlung, danach der Mohr im Festgewand, dessen verworrene Fabel, der Name Scardanelli, der Gang über die nächtliche Straße und schließlich die unerklärliche Verzwergung.
Das Unvernünftige ist das Unwirkliche, sagt Hegel zur Aufwartefrau, als diese ins Zimmer tritt und wieder ihre grimmige Miene zur Schau stellt. Dieser vollkommen verständnislose Ausdruck. Sie trägt ein Tablett, darauf eine Kanne mit seinem Morgenkaffee und zwei Milchbrötchen, die er in den dampfenden Kaffee einzutunken pflegt. „Sie haben wieder im Sessel geschlafen“, krittelt die Aufwartefrau, „das ist gar nicht gut für ihre Gesundheit! Ein anständiger Mensch schläft im Bett, und zwar in seinem eigenen!“
Ich habe ihren Namen vergessen, denkt Hegel, er ist mir tatsächlich entfallen. Aufwartefrauen kommen und gehen. Kaum hat man sich ihr Gesicht gemerkt, sind sie schon wieder über alle Berge. Diese hier ist seit einem halben Jahr im Hause. Eine ausgesprochen griesgrämige Person. Sie ist zwar noch recht jung, vielleicht Mitte dreißig, hat aber trotzdem etwas von einer unfreiwilligen Greisin. Ihr Mann hat sie verlassen, zwei Kinder sind ihr gestorben, das dritte soll ein Kretin sein. Ein Junge mit Wasserkopf und schiefem Lächeln, der außerdem kaum zu sprechen vermag. Einmal hat Hegel ihn auf der Straße gesehen: Seine Mutter zog ihn in einem wackligen Kastenwagen, darin saß der Junge und strahlte, als sei er in Wahrheit ein König.
Der Geist, sofern er reiner Geist ist, kann nicht krank sein, denkt Hegel, und deutet das offenkundige Glück des Jungen als ein Zeichen von dessen vollkommener Verwirrtheit. Er spricht ja gar nicht, gibt nur Laute von sich, ganz wie ein Säugling oder ein unmündiger Greis.
Marie kommt unversehens ins Zimmer. Sie trägt das rote Kleid mit dem geblümten Muster, das er sehr liebt. Aber diese Hammelkeulenärmel mag er eigentlich gar nicht, weil sie auf den ersten Blick plump wirken und nur durch Fischbein in Form gebracht werden können. Jedoch muß er insgeheim an ihre nackten Schultern denken, und dieser Gedanke versöhnt ihn. Es gibt sie also: die sinnliche Gewißheit.
Ein leichter Duft von Veilchen verbreitet sich. Das Parfüm, das er seiner Frau zu ihrem letzten Geburtstag geschenkt hat. Erinnerung an einen empfindsamen Nachmittag im Mai, das Panorama der Stadt Nürnberg wie durch ein umgekehrtes Opernglas betrachtet: Eine Spielzeuglandschaft des Geistes.
Jetzt ist es anders. Die Pflichten rufen. Schnell wird das Frühstück beendet. Man hat Termine, die es einzuhalten gilt. Der Rektor der Berliner Universität kommt niemals zu spät, das ist er sich schuldig. Um neun Uhr wartet bereits der Kustos der Universitätsbibliothek, um über die notwendigen Neuanschaffungen zu sprechen. Dabei mag dieser alte, stets nach ranziger Butter riechende Bücherhirt viel lieber die alten und uralten Folianten, die er hütet als sei es der Schatz der Nibelungen.
Irgendwann hat er Hegel einmal eine seiner Wiederentdeckungen gezeigt, ein Buch des Jenaer Professors Georg Grau aus dem Jahre 1688. Die „Hypnologia“, das Werk des besagten Professors, beschäftigte sich mit dem Schlaf und den verdrießlichen Nächten, die einem üble Träume und das möglicherweise durch sie hervorgerufene Aussetzen des Atems während des Schlafens bescheren können. Der Tod, er kommt auf leisen Sohlen und meist über Nacht.
Ich werde ihn nach diesem Buch fragen, sagt sich Hegel, während er in der Kutsche sitzt und die Menschen draußen wie Figuren eines fahrenden Theaters an sich vorüberfliegen sieht. Das Leben ein Traum. Der Traum ein Leben. Auch die „Träume eines Geistersehers“ könnten vielleicht ein wenig Aufklärung bringen. Aber Kant ist längst dort, wo er keiner Träume mehr bedarf.
An der Einfahrt zur Universität ist ein kleiner Menschenauflauf entstanden: Mützenschwenkende Studenten, schwarze und weiße Kokarden, Wortfetzen aus halbvergessenen Liedern. Meum est propositum in taberna mori, wir jubeln, singen, trinken wohl durch die ganze Nacht. Ein junger Mann steht abseits und würgt, bevor er die Reste der durchzechten Nacht in einem Schwall erbricht. Es lohnt nicht, die jungen Leute zur Ordnung zu rufen, denkt Hegel.
Es folgen fünf Termine, rasch nacheinander. Zuerst dieser Kustos, der in übler Verfassung zu sein scheint. Er muß getrunken haben, sagt sich Hegel, während er den Kustos schwadronieren hört. Soviel Unsinn in einem einzigen bandwurmartigen Satz. Er läßt ihn also reden, und schaut unterdessen zum Fenster hinaus: Fassaden und Fenster, Spiegelgebilde von Wolken.
Danach kommt erst der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät, ein fettleibiger Schwätzer mit Nickelbrille, dann ein Ministerialrat, der absolut nichts zu sagen weiß, das Ehepaar Weisbrod, Gönner und Mäzene höherer Lehranstalten, und schließlich ein Herr de Varga, wohl portugiesischer Abstammung, welcher leicht schielt, aber durchaus Anregendes zu erzählen weiß, wie zum Beispiel über eine Stadt namens San Andréa oder Sassandra am westafrikanischen Golf von Guinea. Der letzte Termin entfällt, weil den angekündigten Gast am Tag zuvor der Schlag getroffen hat.
Es gibt eine kleine Ruhepause gegen dreizehn Uhr. Ein schweigsamer Diener bringt einen Teller Kalbfleisch mit Kraut, dazu einen Krug Mineralwasser, eisgekühlt. Seine Joppe aus rötlichem Loden hat am linken Ärmel einen daumenbreiten Riß, der an eine Wunde denken läßt. Den Nachmittag über ist Hegel mit Korrespondenzen beschäftigt und verläßt die Universität bereits gegen siebzehn Uhr, weil ein heftiges Kopfweh plötzlich den freien Lauf seines Geistes behindert.
Zuhause findet er sich allein. Auf dem Tisch im Flur liegt ein versiegelter Brief. Er erkennt die Handschrift seines Schwagers Gottlieb: verhuschte schwarze Buchstaben, kaum mehr als ameisengroß. Sicherlich neue Nachrichten über jene unglückliche Person, die vor einem Jahr in Ansbach wie aus dem Nichts aufgetaucht ist. Ein verwildertes Wesen namens Kaspar Hauser. Dieser soll fünfzehn Jahre im Dunkeln gelebt haben; vollkommen abgesondert von der Welt.
Er trinkt einen halben Liter Bier, um zur Ruhe zu kommen. Der Kopf ist eine Mördergrube verwesender Gedanken. Jetzt einzuschlafen wäre ein Glück. Aber es geht nicht. Für den Abend hat sich noch ein Gast angesagt, der wahrscheinlich zum Essen bleiben wird. Echtermeyer. Der einarmige Ästhetiker. In gewisser Weise eine traurige Gestalt. Er soll einen Verein gegründet haben, der sich die Gesellschaft zum ungelegten Ei nennt.
Nun geht er doch ins Schlafzimmer, um wenigstens eine halbe Stunde zu ruhen. Er zieht also die Schuhe aus und legt sich angezogen aufs Bett. An der grauweißen Zimmerdecke huscht eine Spinne, eine Art Weberknecht. Acht Beine, die nichts zu weben vermögen. Es ist still, so still, daß ihm der Gedanke kommen könnte, er selbst sei der letzte Überlebende einer verschwindenden Welt.
Die Augen schließen, um nichts mehr sehen zu müssen. Auf einmal kommen die inneren Bilder ins Spiel. Hinterrücks, als lauerten sie unter den Lidern, all die tollgewordenen Schnipsel einer zerschnittenen Wirklichkeit. Dann setzt der Atem für einen Moment lang aus: Und der Träumende sieht seine gestrige Traumgestalt. Es ist derselbe Mohr, der sich geziert vor ihm verbeugt, als wolle er sich eigentlich über ihn belustigen.
Scardanelli, wenn ich nicht irre, sagt der Träumende, aber der Mohr lächelt verschmitzt und erwidert: Escobar. Er hält etwas in seiner rechten Hand, das an eine Landkarte erinnert: Darauf eine schädelförmige Insel, die wie an zwei Girlanden aufgehängt ist, umgeben von Wasser. Am unteren Rand stehen zwei Männer, in ein Gespräch vertieft. Über ihnen wölbt sich ein mächtiger Schiffsbauch. Und ein anderer Mann, vielleicht der Entdecker jener Insel, steht vereinzelt an der anderen Seite, abgewandt, mit verdecktem Gesicht. Und jener, der sich Escobar nennt, öffnet den fleischigen Mund. So viel Unsinniges, das sich in Sprache verhüllt. Das leere Geschwätz eines Gottes. Er spricht, während seine Augen wie Murmeln hin und her rollen:
„Ich bin Pèrito, Sohn des Pèro Escobar, Entdecker von Sassandra am Palmenstrand von Guinea, und auch der Insel Sao Tomé. Das hölzerne Schiff meines Vaters erreichte am 21. Dezember 1471, dem Festtag des heiligen Thomas, jene Insel. Die Sonne hatte die Männer wahnsinnig gemacht. Fünf Seeleute waren bereits über Bord gegangen, um im Meer ihre überhitzten Hirne zu kühlen. Alle ertranken. Als die Seemänner dann endlich Land sahen, brachen die meisten in Tränen aus. Hartgesottene Männer heulten wie alte Weiber. Seit Monaten hatten sie nichts weiter vor Augen gehabt als das von Stürmen durchpflügte Meer. Der Proviant war verbraucht. Es gab nur noch verrottete Zwiebeln, verschimmeltes Wasser und ein paar Fässer Branntwein, der den Durst nicht zu stillen vermochte. Sie gingen also an Land, und entdeckten ein Paradies, aus dem die Engel entflohen waren. Männer, Frauen und Kinder; so schwarz wie die Hälfte der Nacht. Das Fremde ist immer das, was Angst hervorruft und mit ihr am Ende das Grauen.
Aber zuerst war es die reine Freude. Wohlschmeckendes Wasser, Früchte im Überfluß und eine weiche, von Träumen geschwängerte Luft. So ließ es sich leben. Drei Tage lang schliefen die Männer, traumlos und fest. Dann machten sie sich auf, um die Insel zu erkunden. Sie sahen den weißen Sand der Strände, Palmen, Bäume voll seltsamer Früchte, Bäche kristallklaren Wassers, bewaldete Hügel und die aus Bananenstauden gefertigten Hütten der Eingeborenen. Am Anfang hielten diese sich verborgen, wagten sich kaum hervor aus ihren Behausungen, um jene weißen Wesen zu sehen.
Am vierten oder fünften Tag erreichten einige der Entdecker den in der Mitte der Insel gelegenen Markt der Zauberer. Es war ein lautstarkes Gewimmel aus lauter zusammengewürfelten Einzelheiten. In der flirrenden Mittagshitze sahen sie halbverweste Bisamratten, auf lange Hölzer gespießt, getrocknete Igel, tote Schlangen, die man um Speere gewunden hatte, schwarzgrüne Krötenköpfe mit überquellenden Augen, außerdem auch giftige Kräuter, zu welken Sträußen zusammengebunden. Es gab Zaubertränke, die auf offenem Feuer zusammengerührt und gekocht wurden. Eine brodelnde Hexenküche. Die Zauberer trugen Masken mit den geschnitzten Gesichtern ihrer Götter und Ahnen.
Die Menschen sangen dabei in einer Sprache, die fern und fremdartig klang. Den Seeleuten erschien es wie ein Gesang, der aus den Wolken gekommen war, um das Gehör zu erfrischen. Sie tranken das aus Bananen gebraute Bier, welches ihnen angeboten wurde. Es war süß und berauschend. Während die Zauberer vor ihren Augen mit langen Nadeln in das Herz einer tollwütigen Ziege stachen und unterdessen ihre Zaubersprüche und Verwünschungen ausstießen, fiel die Nacht wie ein Vorhang herab, bedeckte den Markt, und diesen verwunschenen Winkel der Welt.
In jener Nacht träumten sie alle denselben Traum. Die Welt war untergegangen und nur sie allein übriggeblieben. Neun Männer, verlassen, im Nichts ausgesetzt. Es gab nur noch den schwarzen unendlichen Raum, und daraus auftauchend zuweilen die Fratzen, welche die Einbildungskraft hervorzaubert. Schwarze Masken im Weiß der Erinnerung. Und eine Stimme sprach zu ihnen:
Ihr seid allein. Es gibt weder andere Menschen noch Pflanzen, Tiere, Berge und Wasser. Ich aber werde einen Faden zu euch herabwerfen und an diesem Faden kommt ihr nacheinander hinauf und zurück in das Reich des Himmels. Aber bevor ihr hinaufkommt, müßt ihr von all den Dingen träumen, die einmal sein werden. Erst dann können sie wirklich sein. Träumt also von den anderen Menschen, euren Frauen und Kindern, träumt von den Pflanzen und Tieren. Schaut auch die Berge und Flüsse im Traum, bevor alles zu Wirklichkeit wird.
Und die Menschen fielen im Traum in einen weiteren Traum, der ihnen all das vorstellte, wovon die Stimme zu ihnen gesprochen hatte. Als alles so geschehen wie ihnen befohlen war, kam wirklich ein Spinnenfaden vom Himmel herab. Und sie gerieten in einen heftigen Streit darüber, wer ihn als erster ergreifen konnte. Weil sie sich aber deswegen so zerstritten und sich gegenseitig den Faden aus der Hand rissen, kam letztlich niemand zum Zuge und sie blieben allein, ohne jegliche Aussicht, einmal zurück zum Himmel zu gelangen.
Als sie endlich erwachten, war es noch immer Nacht. Sie tasteten sich voller Furcht durch die Dunkelheit. Pèro, dem Anführer der Gruppe, gelang es schließlich, in der Finsternis einen schlaftrunkenen Körper ausfindig zu machen, ein unaussprechliches Glück. Also traf sich seine Angst mit der Freude eines namenlosen Mädchens, und er genoß dieses Glück, das kaum eine halbe Stunde lang währte.
Dann kam der Morgen. Er kroch langsam herauf über die Hügel, und es zeigte sich alles in neuem Licht. Noch am selben Tag verließen Escobar und seine Männer die Insel, um in See zu stechen und andere Länder zu suchen. Sie kehrten niemals zurück. So erfuhr Escobar auch nie, daß jenes Mädchen, mit der er in jener Nacht seine Angst und seine Freude geteilt hatte, neun Monate später einen Jungen zur Welt gebracht hatte.
Ich bin es, Nemura, später dann auch Pèrito genannt, der kleine Entdecker, von dem anfangs niemand wußte, wer ihn gezeugt hatte. Ich selbst habe es erst spät erfahren, in Venedig nämlich, an einem Aprilmorgen im Jahre 1505. Es war noch kalt an jenem Morgen, und ich begegnete auf dem zugigen Platz vor der Markuskirche einem seltsamen Mann, dessen langes gelocktes Haar mir sogleich in die Augen stach. Und auch er verfolgte mich mit seinen Blicken. Er trug einen länglichen Holzkasten unter seinen linken Arm geklemmt, und er schaute mich so an, als wolle er jede meiner Bewegungen nachzeichnen.
Zu dieser Zeit hatte ich bereits die halbe Welt gesehen, und auch das Elend erlebt, das sie uns zumutet: Am Anfang, in meinen ersten Lebensjahren, glich ich nämlich rein äußerlich meinem weltreisenden Vater und war deutlich heller als die anderen Kinder, beinahe weiß. Doch als meine Haut sich mit der Zeit immer dunkler tönte, gab meine stets traurige Mutter mich im Alter von drei Jahren in die Hände meiner Großmutter, die mich zehn Jahre lang wechselweise küßte und schlug. Vor allem die Schläge blieben mir in Erinnerung.
Weil ich die Menschen liebte, die aus der Ferne kamen, folgte ich den weißen Männern, die über das Meer zu uns gefunden hatten. Sie lehrten mich ihre Sprache, und ebenso Lesen und Schreiben. Zehn Jahre lang fuhr ich mit ihnen auf See, entlang der afrikanischen Küste, dann nordwärts bis nach Portugal, wo ich sieben Jahre lang blieb, um in Lissabon die Manuskripte zu studieren, die von den Reisen des Alvise Cadamosto, Alvaro Fernandes´ und Pèro Escobars nach Afrika und in andere Weltgegenden handelten.
So lernte ich vieles über das Leben jener Fremden, das doch insgeheim ein Teil meiner selbst war. Damals wußte ich nicht, wer mein Vater war. Aber der Drang, es in Erfahrung zu bringen, war so unbändig in mir, daß ich alles dafür auf mich nahm. Ich lebte dahin, ohne zu wissen, wofür ich lebte. Da träumte ich eines Tages, ich fände die Antwort auf all meine Fragen in einer mitten im Wasser erbauten Stadt voller schmerbäuchiger Kuppeln, durchzogen von Kanälen, die nach wunderbarer Fäulnis rochen.
Also schloß ich mich also einer Reise von Gelehrten an, die im Frühjahr 1505 von Lissabon in See stachen, um über das Mittelmeer bis nach Venedig zu gelangen. Dort sollten wir eine Gruppe von alt und zahnlos gewordenen Übersetzern aus Konstantinopel treffen, die vor über fünfzig Jahren zahlreiche Manuskripte der Byzantiner während der Eroberung ihrer Stadt vor den Flammen und dem eifernden Zorn der Osmanen gerettet hatten.
Das Meer war nicht schweigsam, während wir segelten. Es geriet außer sich und stürmte gewaltig, und ich fühlte mich manchmal wie jener Prophet, den der Zorn Gottes über Bord warf, so daß er beinahe untergegangen wäre, wenn er nicht Unterschlupf gefunden hätte im Bauch eines Wals.
Als wir Venedig erreichten, erfuhren wir, daß das Schiff der Byzantiner vor der Küste von Split in die Hände von Seeräubern geraten, vollständig ausgeplündert und im Meer versenkt worden war. Das einzige, was von den räuberischen Piratenhorden einigermaßen unversehrt zurückgelassen wurde, war ein hinkender Schiffsjunge, der zwei Manuskripte gerettet hatte, indem er sich diese wie ein Korsett um die Taille gewickelt hatte.
Es waren zwei Handschriften auf Pergament, die erste eine arabische Abschrift eines verlorenen aristotelischen Traktates über die Melancholie. Die zweite war eine aus dem vierzehnten Jahrhundert stammende Beschreibung des Reichs der Akan, das an der Goldküste von Westafrika liegt. Als ich dieses Manuskript las, gingen mir die Augen auf. Da hieß es, daß die Akan Wilde seien, die weder Schrift noch Religion besäßen. Sie liebten die Gewalt und versklavten alle, die nicht aus ihrem Stamme seien. Ihre Herrscher wären wahre Meister der Grausamkeit und sie vergötzten die Farbenspiele der Hölle. Um eines billigen Vorteils willen opferten sie selbst ihre eigenen Kinder und bestrichen mit deren Blut die Gesichter ihrer wagemutigsten Krieger.
Es gab auch farbig gefaßte Bilder zu diesen Beschreibungen: Seltsamkeiten und Schreckensszenen. Eine nackte Schwarze auf einem Dromedar, vor ihr ein Kniender, der in seiner Linken ein Weihrauchfaß und in seiner Rechten einen aufgespannten Sonnenschirm hält. Auf einem anderen Bild war eine verschleierte weiße Frau zu sehen, die von einem jungen schwarzen Krieger umarmt wird. Ihr Blick verschwamm in Tränen, als hätte sie in einen Abgrund geschaut. Ein weiteres zeigte ein gewaltiges Krokodil, aus dessen klaffendem Maul ein halber Mensch mit vor Schreck geweiteten Augen hervorschaut. Über dem Krokodil die unbewegte Gestalt eines Mannes, in dem ich mich selbst wieder wahrnahm, jedoch als ein Weißer.
Da wußte ich auf einmal, daß dieser und niemand anderer mein Vater sein müsse. Ein Wolkenfarbiger aus einem fernen Land. Doch er blieb gefangen in einem Bild. In den Augen jenes Weißen wie des Halbverschlungenen geriet ich in einen Zeitspalt. Meine Furcht und mein Zittern wurden zu Nichts. Ich fühlte mich auf einmal in einen Himmel der Gewißheit geschleudert.
Und so erkannte ich mit einem Mal, daß mein einziger Ausweg es sei, in ein Bild zu gelangen und dieses niemals wieder zu verlassen. Ein echtes Bild, kein täuschendes. Ich suchte die Wahrheit, nicht den Traum. Keine halbherzigen Versuche im Blau. Meine Farbe war das Weiß, von dem alles ausgeht.
Und jemand sprach zu mir, der mir erklärte, daß das Weiß in Wirklichkeit gar keine Farbe sei, sondern die Summe aller erdenklichen Farben, also ein herrliches Nichts. Was wäre dann das Schwarze, fragte ich diesen Jemand. Und jener erwiderte, daß Schwarz wiederum die Verleugnung aller Farben sei, deren reines Gegenteil.
Es ist schwierig, in ein Bild zu gelangen, welches das Bild eines Meisters ist. Zuerst ist es notwendig, sich in die Gedanken des Meisters einzuschleichen, um darin zu dessen verborgenem Eigentum zu werden. Mit den Gedanken hat es seine eigene Bewandtnis. Sie sind irgendwo und nirgendwo in den Köpfen zuhause, im Gedächtnispalast, der jeden Winkel eines Kopfes mit seinen Zimmern und Fluren bewohnbar macht. In jenen Räumen ist alles sorgsam verborgen und zugleich auch offenbar.
Der Mann mit dem Holzkasten und dem welligen Haar durchkreuzte meinen Sinn wie ein Tier, das es nicht gibt. Vielleicht ist er ja meine Erfindung, dachte ich mir, aber wenn er meine Erfindung ist, dann wird er zu mir sprechen, wenn ich ihn darum bitte.
Und so kehrte ich meinen Gedanken den Rücken und gelangte wieder zurück zum Markusplatz, zog jenen Mann aus meinem Gedächtnis hervor und befestigte ihn an der Leine meiner Einbildung. Da zappelte er für eine Weile, schlug mit Federn und Fäusten um sich, flehte um die Gnade, fliehen zu dürfen. Doch ich ließ nicht mehr von ihm ab. Ich verkroch mich also in seine Gedanken, stieg bis unter seine Lider, wo sich zarte und wilde Gestalten tummelten: Ein Blaurackenflügel, drei wildgewordene Reiter auf ihrem Galopp ins Nirgendwo, das Rasenstück eines verwunschenen Gartens, eine Meerkatze mit fragenden Augen, betende Hände, ein Knabe mit zierlichen Fingern, das Bildnis der Mutter mit knotigem Hals, ein Schreiberling im Gehäuse, das Antlitz des Schmerzensmanns, und letztlich auch ein Gesicht, welches das meine sein könnte.
Ich sah es an, und fand meinen Blick, den ich niemals sehen würde: in einer Ferne verloren, die es nimmermehr geben wird. So werde ich sein, wenn ich mit schwarzer Kreide gezeichnet bin. Gekräuseltes Haar, eine fliehende Stirn, der verlorene Blick über der gedrungenen Nase, unterhalb derer sich der Bart und ein Paar fleischige Lippen zuhause fühlen.
Das sei mein Gesicht, befand jener Meister. Und ich betrachtete es lange, suchte in seinen Einzelheiten nach den Spuren meiner Herkunft. Sie ist jedoch niemals zu finden. Wer sie aufzuspüren oder nachzuzeichnen versucht, muß sich verlieren. In jedem Gesicht ist etwas anderes eingeschrieben, ein zweites Gesicht, das wie ein Phantom aus unsichtbarem Stoff darüber gewoben ist. Ein Netz von Linien, deren Sinn sich erst dann ergibt, wenn der Ursprung enträtselt wird.“
Also sprach Pèrito Escobar, Sohn einer Namenlosen und des Pèro Escobar, des Sendboten von Heinrich dem Seefahrer, des Entdeckers der westafrikanischen Küste. Und er klopft mit Bedacht an die Schädeldecke, um sich aus dem Verlies der Gedanken herauszuheben. Sein Klopfen wird lauter, es ist kaum noch zu überhören. Will er doch endlich fortkommen von der Insel seiner Einbildung. Aber der Schädel lüftet sich nicht. Die Insel bleibt eine Insel im Nirgends. Eine Schädelstätte des Geistes.
Es bleibt ein Gefängnis für alles, was sich in ihm verbirgt. Also muß dieser Schädel geöffnet werden wie eine Nuß, die man aufschlägt, um die verborgene Milch zu genießen.