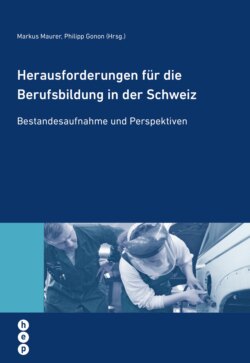Читать книгу Herausforderungen für die Berufsbildung in der Schweiz - Markus Mäurer - Страница 4
ОглавлениеPhilipp Gonon
Herausforderungen für die Berufsbildung in der Schweiz – eine Einleitung
Die Berufsbildung in der Schweiz geniesst einen guten Ruf. Im Unterschied zum Gymnasium, aber auch zur Volksschule, zu den pädagogischen Hochschulen und Universitäten und selbst zu den Fachhochschulen wird dieser Teil des Bildungssystems in der Öffentlichkeit beinahe ohne jegliche Vorbehalte gelobt. Das war nicht immer so. In den 1970er- und 1980er-Jahren stand die Berufslehre, wie sie damals genannt wurde, in der Kritik. Man sprach von der Misere der betrieblichen Ausbildung; Lehrlinge würden vor allem als billige Arbeitskräfte missbraucht, es würden zu wenig attraktive Lehrstellen angeboten, und in einigen gewerblichen Berufen bestehe gar eine Überproduktion an Lehrlingen und gelernten Berufsleuten, denen es dann an Zukunftsaussichten fehle. Mehr Schule – oder auch berufliche Vollzeitschulen – schien die Alternative zur Lehre beim Meister zu sein. Diese Tonlage ist heute beinahe vollständig verschwunden. Die berufliche Grundbildung und im Besonderen die «duale Berufsbildung» gelten als idealer Weg für Jugendliche, die sich berufs- und praxisnah für den Arbeitsmarkt qualifizieren möchten. Das schweizerische Berufsbildungssystem biete nicht nur eine Vielzahl beruflicher Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten, es sei auch verantwortlich für tiefe Jugendarbeitslosigkeit, ja sogar für wirtschaftliche Prosperität und Wettbewerbsfähigkeit. Schliesslich sei die Berufsbildung keineswegs eine Sackgasse für diejenigen, die weitere Bildung anstrebten, sie eröffne im Gegenteil den Zugang zur höheren Bildung. Sie sei daher zu pflegen und auszubauen. – Dies der allgemeine Tenor, der nur durch wenige dissonante Stimmen irritiert wird (vgl. Sarasin, 2012).
Gleichzeitig wird jedoch auch beklagt, dass die Berufsbildung im Lande selbst und jenseits der Landesgrenzen nicht in ihrer Bedeutung gewürdigt, dass sie unter Wert gehandelt werde. In internationalen Vergleichen werde der Berufsbildung der Schweiz zwar eine hohe Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit zugesprochen, dennoch sei die Schweiz unter Druck, um im Zuge der Globalisierung ihre Stellung zu behaupten. In einer amerikanischen Studie wird die Schweiz, was die Berufsbildung angeht, zu den besten sechs Ländern gezählt, neben Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Norwegen und Australien (Hoffman, 2011). Viele in der Schweiz würden dieses Ranking noch einmal differenzieren und das eigene Land an die Spitze stellen.
Wie dem auch sei, diejenigen Länder, in denen die duale Berufsbildung dominiert, vor allem auch Deutschland und Österreich, sehen sich in einer widersprüchlichen Ausgangslage: Ihr duales Berufsbildungsmodell wird international nachgefragt, zuweilen gar als «Exportschlager» bezeichnet, umgekehrt werden hinsichtlich Vergleichbarkeit und Anerkennung von Abschlüssen Anpassungen an international vergleichbare Standards verlangt. Die stärkere Einbindung in die internationale Zusammenarbeit erhöhe auch den Druck Richtung Harmonisierung. Damit seien – so ein häufig genanntes Argument – schulische Systeme naturgemäss im Vorteil. Gerade die herausragende Stellung und Einzigartigkeit der schweizerischen Berufsbildung erschwere eine Verstetigung und Ausweitung des schweizerischen Erfolgsmodells.
Spätestens seit der Jahrtausendwende ist also die vormals kritisierte duale Berufsbildung zum international vorzeigbaren Erfolgsmodell und zum wirtschafts- und sozialpolitischen Standortfaktor avanciert. Auch wenn der direkte Zusammenhang von Jugendarbeitslosigkeit und Berufsbildungssystem nicht so einfach nachweisbar ist, hat inzwischen auch die Europäische Union – wie schon seit längerer Zeit Frankreich und England, Länder, die eine ganz andere Tradition beruflicher Bildung aufweisen – die duale Berufsbildung als Potenzial entdeckt. Im Vordergrund steht die Integration von Jugendlichen, die sonst keinen Anschluss im Bildungssystem gefunden hätten, in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt.
Tatsächlich wird seit Längerem auch in der Schweiz primär die duale Berufsbildung ausgebaut (vgl. Gonon, 2012). War früher in den 1980er-Jahren vom «trialen System» die Rede – eigentlich treffender, denn das schweizerische Berufsbildungssystem umfasst neben den beiden Lernorten Betrieb und Schule auch einen «dritten Lernort» (heute meist «überbetriebliche Kurse» oder ÜK genannt) –, so hat sich nun bemerkenswerterweise der Begriff «duale Berufsbildung» durchgesetzt, der für alle Formen beruflicher Ausbildungen verwendet wird, die betriebliche wie auch schulische Anteile aufweisen.
Im Jahre 2010 erschien als Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Bericht «Sechs Jahre neues Berufsbildungsgesetz – Eine Bilanz» (Schweizerischer Bundesrat, 2010), in dem explizit von der Förderung der «dualen Berufsbildung» die Rede ist – wie übrigens bereits im Bericht des Bundesrates anlässlich der Gesetzesrevision im Jahre 2000. In der «Bilanz» werden mehrere Herausforderungen benannt, auf die auch im Folgenden noch eingegangen wird.
Trotz der allseits bescheinigten Erfolge gebe es für die Berufsbildung im Besonderen mit Blick auf die Zukunft einige Problemlagen, die Antworten verlangten, so auch die Meinung anderer Akteure. In einer Expertise zur Zukunft der Bildung in der Schweiz wurde auch die Rolle der Berufsbildung in einer wissensbasierten Gesellschaft thematisiert (Akademien der Wissenschaften Schweiz, 2009). Ein Mitautor bezeichnete an anderer Stelle die duale Berufsbildung in der Wissensgesellschaft als «Auslaufmodell», was heftigen Widerspruch hervorrief. Eine weitere Debatte entfachte die vonseiten der Arbeitsmarktforschung in der letzten Dekade festgestellte starke und überproportionale Zuwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte. Die Feststellung, dass es im Gesundheitsbereich und in der Informatik an Fachkräften mangle, warf u. a. die Frage auf, ob das Bildungssystem zu selektiv und zu wenig chancengerecht sei, aber auch die, ob in der Schweiz zu wenig Akademiker ausgebildet würden. Damit stand zur Diskussion, ob die Schweiz nicht vielleicht ein Zuviel an Berufsbildung gewähre (Meyer, 2009).
Der wirtschaftsnahe Thinktank Avenir Suisse empfahl angesichts ähnlicher Problemwahrnehmung ein duales Modell nicht für die berufliche Bildung, sondern teilweise auch für den Hochschulbereich (Schellenbauer et al., 2010).
Bisher war im Zusammenhang mit der Berufsbildung vorwiegend von der beruflichen Grundbildung auf der Ebene der Sekundarstufe II die Rede. Immerhin umfasst die Ausbildung von Jugendlichen, die am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit eine berufliche Grundbildung anstreben, zwei Drittel eines Jahrganges. Es gilt allerdings zu beachten, dass schon vor der beruflichen Grundbildung berufsbildungsrelevante Dinge geschehen, so die Berufswahl und der gelingende Einstieg und Übergang in das System der beruflichen Bildung. Und nach Abschluss der Grundbildung ist der Übergang in die Arbeitswelt oder die weitere Bildungsaktivität von zunehmender Bedeutung.
Von Interesse ist also, dass die Berufsbildung alles andere als ein monolithisches Gebilde darstellt. Gerhard Bosch und Mitautor/innen weisen in ihrer Darstellung des beruflichen Bildungssystems in Deutschland darauf hin, dass die Zukunftsfähigkeit der dualen Berufsbildung nicht von einem, sondern von einer Vielzahl einzelner Bereiche, die in sich funktionsfähig bleiben müssten, abhängig ist. Zu den aktuellen Problemfeldern zählen sie die mangelnde Versorgung mit Ausbildungsplätzen, das Übergangssystem, den Fachkräftemangel, die Durchlässigkeit der Bildungssysteme und die Europäisierung der Berufsbildung (Bosch, Krone & Langer, 2010).
Gleiches gilt auch für die Schweiz. Die Berufsbildung ist darüber hinaus sowohl in geografischer Hinsicht als auch je nach sprachregional-kulturellem Umfeld vielgestaltig. Die vorherrschende Meinung ist, dass man diese Vielfalt, wie sie sich über einen längeren historischen Zeitraum ergeben hatte, erhalten sollte. Erst in jüngster Zeit wurden im Besonderen dem dualen System bundesrätliche und bildungsverwalterische Fürsorge und aktive Förderung zuteil. Gleichzeitig wurde eine stärkere Verknüpfung mit dem Bildungssystem insgesamt angestrebt. Nach einem Ausbau der Berufsmaturität in den 1990er-Jahren, die mit den Fachhochschulen die Schweizer Bildungslandschaft massiv veränderte und die Durchlässigkeit zwischen der Allgemein- und der Berufsbildung ermöglichte, ist nun vor allem die höhere Berufsbildung ein Feld, das einerseits zur Festigung des dualen Systems, anderseits aber auch zur Stärkung der berufs- und betriebspraktischen Seite und zur Stabilisierung des Karriereweges über berufliche Erfahrung in Stellung zu bringen ist. Gerade auch in der höheren Berufsbildung laboriert die Bildungspolitik an einigen gewichtigen Problemen: Nach einem politisch forcierten «Upgrading» der ehemaligen beruflichen Weiterbildung zu einem Tertiärabschluss muss zurzeit die Positionierung innerhalb des Bildungssystems geklärt werden.
Duale Berufsbildung gilt es zu fördern, gleichzeitig steht die Berufsbildung vor einigen Herausforderungen, die der besonderen Aufmerksamkeit der Bildungspolitik bedürfen, so lässt sich der weitherum herrschende Konsens zusammenfassen.
Als Hintergrund wahrgenommener Herausforderungen spielt wohl auch die demografische Entwicklung eine entscheidende Rolle. Die Berufsbildung soll in ihrer Bedeutung erhalten bleiben. Im Kampf um Talente bzw. «begabte» Jugendliche baute man in der Schweiz – ausgesprochen oder nicht – auf ein System, das selektiv den Zugang zum Gymnasium einer Elite vorbehalten und die Berufsbildung als Norm und regulären Weg aufrechterhalten sollte. Diese Tradition ist auch angesichts demografischer Trends national wie international unter Druck. Im Zusammenspiel mit technologischen und fachlichen Entwicklungen sowie stärkerer internationaler Zirkulation wurde daher in den letzten Jahren die Berufsbildung stärker verschult, gleichzeitig aber auch die Durchlässigkeit im Hinblick auf das gesamte Bildungssystem erhöht.
In diesem Buch wird nicht grundsätzlich am helvetischen Konsens gerüttelt, wonach die Berufsbildung eine positive Bilanz aufweist. Dennoch ist es auch Aufgabe einer wissenschaftlichen Haltung, Bestehendes skeptisch zu hinterfragen. Wir haben uns deshalb zur Aufgabe gestellt, einige öffentlich thematisierte und teilweise strittige Gesichtspunkte der Berufsbildung darzustellen, kritisch zu prüfen und wenn möglich auch wenig beachtete Facetten zu beleuchten.
Gemäss der Theorie koordinierter Marktökonomien beruht auch die Berufsbildung auf strategischen Allianzen von Akteuren, die Vereinbarungen treffen und oft selbstverwaltet Regeln erstellen, die dann auch von öffentlicher Seite gebilligt werden (vgl. Busemeyer & Trampusch, 2012). Nicht untypisch gibt es dabei auch Bereiche, die nicht explizit thematisiert, ja eher beschwiegen werden und deshalb für Dritte kaum visibel und auch nicht leicht zu verstehen sind.
Der vorliegende Band thematisiert einige der bereits genannten, aber auch weitere Problemfelder, wie sie interessierte Fachkreise und politische Akteure beschäftigen. Die Analysen zentrieren sich auf einige unseres Erachtens bedeutsame Herausforderungen. Dabei lassen sich zwei Positionen ausmachen: Die einen sehen die Lösungen der jeweiligen Herausforderungen als existenziell an – wenn etwa die Neupositionierung der höheren Berufsbildung kein befriedigendes Ergebnis mit sich bringe, dann seien die duale Berufsbildung und ihre Zukunft gefährdet. Anderen geht es eher darum, Ungleichgewichte auszutarieren, um die Bedeutsamkeit der Berufsbildung weiterhin zu gewährleisten und sie gegenüber der Allgemeinbildung in Stellung zu bringen.
Entsprechend schrill kann sich die Rhetorik zur Zukunft der Berufsbildung oder aber zur Gefährdung des dualen Systems entfalten. Insgesamt jedoch herrscht eher nüchternes Abwägen vor, das auf Weiterentwicklung und Optimierung des Bestehenden setzt.
Von zentraler Bedeutung ist u. a. die Einschätzung der Innovationsfähigkeit des Systems. Auch in dieser Hinsicht leistet die Schweiz Erstaunliches, was wohl letztlich eng mit dem politischen System zusammenhängt.
Herausgehoben sei in diesem Zusammenhang etwa die Rolle der Lehrstellenkonferenz, die Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt einmal jährlich zusammenbringt. Entstanden zu Zeiten der Lehrstellenkrise, entwickelte sich dieses Gremium, in dem die Gewerkschaften, Gewerbe- und Arbeitgeberverband und die fünf im Bundesrat vertretenen Parteien präsent sind, zu einer informellen und meinungsbildenden Instanz, die über die Zukunft der beruflichen Bildung berät und entsprechende Weichen stellt. In der jüngsten Zusammenkunft am 23. November 2012 wurden unter anderem im Zusammenhang mit dem Strukturwandel und der «Deindustrialisierung» die Nachholbildung, die höhere Berufsbildung und Berufsmaturität für die nächsten Jahre als besonders zu bearbeitende Bereiche definiert (EVD & BBT 2012).
Für die Meinungsbildung und Legitimität der Berufsbildung und Berufsbildungsreform sollte man aber auch die Rolle von Organisationen wie der schon seit Längerem bestehenden Schweizerischen Gesellschaft für Angewandte Berufsbildungsforschung (SGAB) nicht unterschätzen. In jüngster Zeit haben sich vermehrt auch wissenschaftliche Akteure von Universitäten, Fachhochschulen (einschliesslich des Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung) sowie private Büros mit Expertisen und Thinktanks zu Wort gemeldet. Sie alle lassen die Berufsbildung heute vielstimmiger erscheinen.
In diesem Buch geht es um eine «dichte Beschreibung» einzelner Teile oder Aspekte des Systems, aus der sich Schlüsse ziehen lassen für das Gesamt. Ausserdem sollte auch ein Entwicklungspotenzial sichtbar werden. Das vorfindbare Wissen wird in einen Deutungskontext eingebunden und durchaus bewertet. Insofern dominiert stark die Deskription, die sich im Wesentlichen auf vorhandene Daten und Dokumente stützt.
Inhaltlich ist das Buch entlang je spezifischer Fragen (und der damit verbundenen Herausforderungen) aufgebaut.
Markus Maurer beleuchtet für die Berufsbildung die Arbeitsmarktperspektive, die wiederum durch den Fachkräftemangel jüngst in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt ist.
Esther Berner geht dem immer wieder von allen Seiten beschworenen Aspekt der «Verbundpartnerschaft» in der Berufsbildung nach.
Der oft in vielerlei Facetten stattfindenden Diskussion um die Finanzierung der Berufsbildung ist ein Kapitel von Markus Maurer gewidmet.
Markus Maurer beleuchtet in Zusammenarbeit mit Silke Pieneck auch die Frage der Reform von Berufsbildern in der beruflichen Grundbildung.
Claudio Caduff und Daniela Plüss ziehen eine kritische Bilanz im Bezug auf die Reformen im Unterricht an Berufsfachschulen in der Allgemeinbildung.
Philipp Gonon zeichnet die Entstehung und heutige Stellung der Berufsmaturität als eine wichtige Reform der 1990er-Jahre bis heute nach.
Zusammen mit Evi Schmid stellt Philipp Gonon auch die heute brennenden Fragen der Positionierung und Finanzierung der höheren Berufsbildung dar und würdigt sie in ihrer Bedeutung.
Stefanie Stolz beleuchtet die Frage, inwiefern die Übergänge in die Berufsbildung mit oder ohne Reibungsverlusten verlaufen.
Evi Schmid untersucht in ihrem Beitrag, wie die berufliche Integration von jungen Erwachsenen erfolgt.
Désirée Anja Jäger widmet ihre Darstellung und Überlegungen den Herausforderungen durch die Europäisierung der Berufsbildung.
Gerahmt werden diese Beiträge durch die Einleitung und Synthese der beiden Herausgeber.
Das Buch ist entstanden als gemeinsames Projekt des Lehrstuhls für Berufsbildung an der Universität Zürich. Wir haben von vielen Expertinnen und Experten im Bereich der Berufsbildung Rückmeldungen zu den einzelnen Kapiteln erhalten. Ihnen sei an dieser Stelle gedankt. Für verbliebene Fehler, irrtümliche Deutungen und Missverständlichkeiten sind die jeweiligen Autorinnen und Autoren bzw. die Herausgeber verantwortlich.
Wir hoffen, dass diese Veröffentlichung einen Beitrag leistet, die Diskussion um die Berufsbildung zu bereichern, aber auch hinsichtlich der Herausforderungen klärend zu wirken.
Zürich, im Dezember 2012
Literatur
Akademien der Wissenschaften Schweiz (2009). Zukunft Bildung Schweiz. Anforderungen an das schweizerische Bildungssystem 2030. Bern: Akademien der Wissenschaften Schweiz.
Bosch, G., Krone, S., & Langer, D. (Hrsg.) (2010). Das Berufsbildungssystem in Deutschland. Aktuelle Entwicklungen und Standpunkte. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Busemeyer, M., & Trampusch, C. (Hrsg.) (2012). The Political Economy of Collective Skill Formation. Oxford: Oxford University Press.
EVD & BBT (2012). Lehrstellenkonferenz 2012 – Massnahmenpapier «Deindustrialisierung/ Strukturwandel». Bern: Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement/Bundesamt für Berufsbildung und Technologie.
Gonon, P. (2012). Entstehung und Dominanz der dualen Berufsbildung in der Schweiz. In M. Bergman, S. Hupka-Brunner, T. Meyer & R. Samuel (Hrsg.), Bildung – Arbeit – Erwachsenwerden. Ein interdisziplinärer Blick auf die Transition im Jugend- und jungen Erwachsenenalter (S. 221–242). Wiesbaden: Springer VS.
Hoffman, N. (2011). Schooling in the Workplace. How Six of the World’s Best Vocational Education Systems Prepare Young People for Jobs and Life. Cambridge: Harvard Education Press.
Meyer, T. (2009): Can «Vocationalisation» of Education Go too Far? The Case of Switzerland. European Journal of Vocational Training, 46(1), 28–40.
Sarasin, P. (2012). Mehr Maturanden bitte! Magazin – Die Zeitschrift der Universität Zürich, 21(4), 44–45.
Schellenbauer, S., Walser, R., Lepori, D., Hotz-Hart, B., & Gonon, S. (2010). Die Zukunft der Lehre: Die Berufsbildung in einer neuen Wirklichkeit. Zürich: Avenir Suisse.
Schweizerischer Bundesrat (Hrsg.) (2010): Sechs Jahre neues Berufsbildungsgesetz – Eine Bilanz. Bericht des Bundesrates über die Unterstützung der dualen Berufsbildung (in Erfüllung des Postulats Favre 08.3778). Bern.