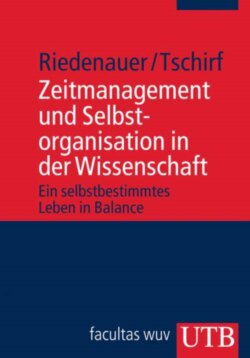Читать книгу Zeitmanagement und Selbstorganisation in der Wissenschaft - Markus Riedenauer - Страница 7
Оглавление| [11]I. | Spezifische Herausforderungen in der Wissenschaft – Institutionelle Faktoren |
Worum es geht:
Jeder Beruf bringt typische Herausforderungen mit sich. Sie müssen berücksichtigt werden, um die allgemeinen Methoden des Zeitmanagements dann anzupassen. Zugleich bietet die Arbeit in der Wissenschaft oft größere Freiheiten und Chancen, die teilweise den realen Zwängen gegenüber stehen, teilweise selbst neue Herausforderungen zur Folge haben. Mithilfe dieses Kapitels können Sie sich größere Klarheit darüber verschaffen, welche äußeren Faktoren Ihre Arbeit positiv und negativ, fördernd und fordernd bedingen. Schließlich werden erste Konsequenzen für das Zeitmanagement daraus gezogen, wie Wissenschaft normalerweise unter den typischen institutionellen Rahmenbedingungen funktioniert.
„Zerren dich die von außen kommenden Ereignisse hin und her? Nimm dir doch einmal Zeit, etwas wirklich Gutes hinzuzulernen und hör auf, im Kreis umherzuirren! Du mußt dich aber auch vor dem anderen Irrweg hüten: Toren sind nämlich auch die, die durch ihr Tun müde geworden sind zum Leben und kein Ziel haben.“
Marc Aurel: Selbstbetrachtungen II, 7
Freiheiten
Wissenschaftliche Arbeit erlaubt zumeist überdurchschnittlich große Freiheiten und mehr persönliche Gestaltungsspielräume – sowohl inhaltlich als auch von der Zeiteinteilung her. Das gilt für die Forschung und teilweise noch immer für die Lehre.
Für manche war die Freiheit ein Motiv, um in die Wissenschaft zu gehen, und für manche ist sie ein Motiv, zu bleiben, obwohl sich ein Wechsel in ein Unternehmen oder in eine andere Karriere im öffentlichen Dienst (wie z.B. in einem Ministerium) anbieten würde.
Viele sind seit ihrer Studienzeit daran gewöhnt, ihren Tagesablauf weitgehend selbst zu bestimmen, viel daheim arbeiten zu können, auch unter der Woche Besorgungen, Arztbesuche oder anderes zu erledigen und dafür am Abend oder am Wochenende zu arbeiten sowie in den vorlesungsfreien Monaten wenige Termine zu haben. Sie würden sich wohl häufig schwer tun mit einer Kernarbeitszeit von 9 bis 17 Uhr, mit Präsenzpflicht im Büro, den täglichen Arbeitswegen zu Stoßzeiten und dem Zählen eines jeden frei[12]en Tages.1 Da diese Freiheit in zeitlicher Hinsicht bedeutet, dass Tage, Wochen und Monate kaum von außen strukturiert sind, dass wenig Kontrolle und Rückmeldungen über effektive Zeitnutzung erfolgen, erweist sie sich besonders für junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oft als eine Falle. Wir kommen gleich auf die sehr hohen Ansprüche an die Selbstorganisation und Selbstverantwortung zu sprechen.
Im Bereich der Forschung ist teilweise noch eine große Freiheit bei der Themenwahl gegeben. In manchen Geisteswissenschaften oder der Kunst etwa geben die Betreuenden einer Dissertation o.Ä. auch wenig Hilfestellung beim Finden und Formulieren eines machbaren Forschungsthemas. Trotz der Bemühungen mancher Universitäten, das Doktoratsstudium besser zu strukturieren, wird bereits in dieser Phase oft viel Zeit verloren. In naturwissenschaftlichen, wirtschaftlichen, technischen und medizinischen Fächern hingegen werden häufig mögliche und gewünschte Themen für Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten sowie Dissertationen vorgegeben, besonders dann, wenn damit eine Finanzierung etwa durch Drittmittel verbunden ist. Professoren und Lehrstuhlinhaberinnen genießen dann wieder größere Freiheiten und bestimmen ihrerseits den Freiheitsspielraum für den wissenschaftlichen Nachwuchs mit.
Größere Forschungsprojekte, wozu selbstverständlich auch schon Dissertationen zählen, haben außerdem meist wenig an zeitlicher Binnenstruktur vorgegeben. Wo nicht in gut organisierten Teams gearbeitet wird, sondern überwiegend alleine, wo nicht begrenzte und fixe Zeiten im Labor vorgegeben sind, muss man sich den langen Zeitraum von mehreren Semestern oder Jahren selbst sinnvoll gliedern, sein Projekt in entsprechende Teilschritte zerlegen und sich Teilziele mit Zieldaten festlegen sowie seine Wochenarbeitszeit einteilen. Termine für regelmäßige Rückmeldungen an Betreuende oder Kollegen kann man sich oft selbst vereinbaren und entsprechend auch leicht verschieben, da diese selten verärgert sind über das Ausfallen einer Besprechung.
Im Bereich der Hochschullehre waltete früher eine große Freiheit schon bei den Inhalten von Vorlesungen und Seminaren, welche der Ordinarius (oder seltener die Ordinaria) souverän „ankündigte“. Das hat sich sehr geändert; besonders durch die Modularisierung und Vereinheitlichung von Studiengängen im Rahmen des Bologna-Prozesses sind die notwendigen Lehrinhalte in allen Semestern weitgehend vorgegeben. Selbst wenn durch die Ausweitung der Pflicht-Lehrveranstaltungen kein Spielraum mehr für Spezialvorlesungen, neue oder alternative Seminare oder Übungen gegeben[13] ist, kann man oft innerhalb des Instituts mit anderen Lehrenden tauschen oder aber schon gehaltene Lehrveranstaltungen wiederholen – möglicherweise mit anderen Schwerpunktsetzungen.
Aber immer noch bleibt eine große Gestaltungsfreiheit in Bezug auf die Methoden und Didaktik: Wie wird der Stoff gegliedert und auf das Semester verteilt, an welchen Punkten wird in die Tiefe gegangen, und wo begnügt man sich mit einem Überblick, welche Beispiele, welche Literatur oder andere Lehrmittel werden ausgewählt, inwieweit werden Methoden des E-Learning, der Partner- oder Gruppenarbeit einbezogen, welchen Raum sollen Diskussionen einnehmen usw.
Diese ein hohes Maß an Selbstdisziplin erfordernden Freiheiten können inspirieren und motivieren, aber auch verunsichern. Teilweise werden sie von anderen Einflussfaktoren beeinträchtigt.
Wie frei bin ich derzeit in Bezug auf Forschung, Lehre und meine Zeiteinteilung?
In welchen Bereichen fühle ich mich eher unfrei?
Wie wichtig sind mir meine Freiheiten, welchen Preis sind sie mir wert?
Herausforderungen
Spezifische Herausforderungen an wissenschaftlich Tätige folgen direkt aus den skizzierten Freiheiten. Eine erste Konsequenz ist, dass der Ertrag von Investitionen an Zeit und Energie im Einzelnen schwer abschätzbar ist und sich Fragen dieser Art stellen:
Welchen Unterschied wird es für den Lernerfolg der Studierenden machen, wenn ich diese Lehrveranstaltung gründlich überarbeite?
Wie wichtig ist es, einen Aufsatz zu einem für mich neuen Themengebiet zu veröffentlichen und somit breitere Kompetenz zu zeigen? Hat es einen Sinn, einen weiteren Beitrag zu verfassen zu einem Thema, über das ich bereits publizierte?
Lohnt es sich, mich in ein Nebenthema meiner Dissertation einzuarbeiten, oder lenkt es mich eher vom Wesentlichen ab?
Kann ich z.B. als Vertreterin des Mittelbaus an meiner Fakultät etwas bewirken, was in sinnvoller Proportion zum Zeitaufwand steht?
[14]Der Erfolg von einzelnen Tätigkeiten sowohl in der Forschung als auch in der Lehre zeigt sich oft erst spät, vielleicht nach Jahren – während allgemein bekannt ist, dass die Zeitinvestition der wesentliche Erfolgsfaktor auch in der Wissenschaft ist. Daraus folgt, wie wichtig es ist, Kriterien für Prioritätsentscheidungen zu haben und sich nicht durch das lange Warten auf Zeichen des Erfolgs demotivieren zu lassen. Je weniger positive Rückmeldungen von außen kommen, je weniger wissenschaftliche Arbeit extern motiviert wird (wie durch überdurchschnittliche Gehälter), umso wichtiger wird es, einerseits seine intrinsische Motivation zu pflegen und andererseits dafür zu sorgen, dass regelmäßig Anreize von außen kommen.
Was bedeutet für mich „Erfolg“ in Forschung, Lehre und administrativer Mitarbeit?
Woran kann ich ihn jeweils messen?
Wann bekomme ich auch „unterwegs“ Rückmeldungen, dass ich auf einem guten Weg bin und Fortschritte mache?
Wo kann ich mir zusätzlich solche ermutigenden Stationen einbauen?
Definieren Sie bei großen Projekten und Aufgaben Teilziele, die Sie zu vorbestimmten Terminen überprüfen, um auch Teilerfolge bewusstzumachen und zu feiern (siehe genauer Kapitel IV, besonders unter „Ziele“ und „Evaluation“)!
Ein Hindernis ist oft, dass die Erwartungen und Qualitätsanforderungen anderer nicht recht klar sind, sodass Sie nicht wissen, wann Ihre Forschung oder Ihre Lehre als erfolgreich gelten kann. Viele, die an einer „master thesis“ oder Diplomarbeit schreiben, und so manche Dissertanten sind sich im Grunde unsicher, was die Kriterien für einen guten Text in ihrem Fall sind. Wo es keine Doktorandengruppe o.ä. gibt, sind kollegiale Rückmeldungen rar, oder man traut sich nicht, immer wieder darum zu bitten.
Was eine gute Vorlesung oder ein erfolgreiches Seminar ausmacht, ist etwas klarer, und neuerdings wird den regelmäßigen Lehrevaluationen größeres Gewicht beigemessen. Das gibt eine Richtschnur. Dennoch bleibt die Frage, was jenseits von Idealvorstellungen Studierender oder jenseits Ihres eigenen Idealbildes als Hochschullehrer bzw. Dozentin die realistischen Zielmarken sind, die zum nötigen und möglichen Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durchführung in solch einer vernünftigen Proportion stehen, dass Sie für Ihre anderen Aufgaben auch genügend Zeit und Energie haben.
[15]Diese Fragen müssen Sie selbst beantworten – auch und gerade in dem Fall, dass Sie zu viele oder gar widersprüchliche Erwartungen vermittelt bekommen. Soweit Sie sich durch mangelnde Rückmeldungen und Einschätzungen Ihrer Arbeit durch andere alleinegelassen fühlen, sollten Sie gezielt darum bitten und nicht voller Selbstzweifel im Dunkeln tappen.
Ein gewisses Maß an „trial and error“ scheint zur akademischen Freiheit zu gehören, und Neues auszuprobieren hat einen Wert: subjektiv, insoweit es Freude macht, und objektiv, da so Innovationen entstehen. Sehen Sie aber auch die Grenzen: Routineaufgaben können nach bewährten Mustern und Kriterien erledigt werden. Strapazieren Sie nicht Ihre Kreativität und Zeit in Bereichen, wo andere mit ihrer Erfahrung helfen können.
Viele wissenschaftlich Tätige sehen in ihrem Beruf auch eine Berufung, insofern ihre Arbeit dem entspricht, was sie an Interessen und Begabungen mitbringen und was sie im Leben verwirklichen wollen. Dazu passt die relativ große Selbstbestimmung, deshalb wird auch gerne akzeptiert, dass daheim, an Abenden und Wochenenden gearbeitet werden muss. Die Falle besteht aber darin, dass Beruf und Privatleben zu sehr ineinander übergreifen, dass kein lebensförderlicher Zeitrhythmus mehr aufrechterhalten wird und dass im „home office“ keine Trennung von beidem mehr spürbar ist (nur mehr „office“, kein „home“ mehr). Wissenschaftlerinnen mit Kindern stehen hier unter besonderem Druck, aber auch Paare, wo beide an einer Hochschule tätig sind. Darunter leiden Lebensbeziehungen und Kinder sowie Freundschaften, Gesundheit und Rekreation.
Wie setze ich die Grenzen zwischen Arbeit und Privatem?
Spüre ich einen Unterschied zwischen meinen verschiedenen Rollen?
Welche Rhythmen – vor allem täglich und wöchentlich – pflege ich?
Bisher haben wir über Herausforderungen nachgedacht, die sich aus akademischen Freiheiten ergeben. Es gibt aber auch spezifische, mit diesem Beruf verbundene Schwierigkeiten und Zwänge, die den Freiheiten direkt entgegengesetzt sind:
Theoretisch arbeiten Sie selbstbestimmt und selbstverantwortlich, aber praktisch sind Sie in ein Forschungsteam eingebunden, dessen Leitung Sie sich unterordnen müssen. Oder aber externe Faktoren diktieren Ihre Zeitplanung, wie z.B. Vegetationszyklen in der Biologie.
Sie haben etwa das Verfassen Ihrer Dissertation als eine Hauptaufgabe,[16] wenn Sie eine Qualifizierungsstelle innehaben, aber Ihr Betreuer und Erstgutachter ist gleichzeitig Ihr Vorgesetzter am Institut und beansprucht Ihr Zeitbudget zu stark durch seine Forderungen nach Mit- und Zuarbeit bei vielen anderen Aufgaben (genannt „Assistenten verheizen“). Solche Doppelbindungen können fatal sein, wenn Sie befürchten, durch „Nein“-Sagen in Ungnade zu fallen und schlechter bewertet zu werden. Die Unfreiheit drückt sich auch in der Sprache aus: Man kann streng genommen weder promovieren noch sich selbst promovieren, sondern nur promoviert werden. Überhaupt wird durch Hierarchien, offizielle und inoffizielle, viel an Freiheit in Frage gestellt.
Damit hängt eine Spannung zwischen verschiedenen Rollen zusammen: Gegenüber Studierenden und als Mitglied der internationalen „scientific community“ ist es nötig, selbständig, sicher und selbstbewusst aufzutreten – aber strukturell und rechtlich wird man häufig als abhängig und unselbständig behandelt, muss sich mitunter ständig beweisen.2 Auch wer diese Phase hinter sich hat, braucht zusätzliche Kompetenzen und rechtliches Wissen vor allem für Verhandlungen. Das zu erwerben kostet Zeit, und die Notwendigkeit dieses Kampfes kann belasten.
Jüngere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Qualifizierungsphase haben oft schon darum weniger Freiheit, weil sie zum Broterwerb anderen Tätigkeiten nachgehen müssen. Vor allem Mediziner haben innerhalb ihres Aufgabenfeldes mehrere „Jobs“ in Forschung und Lehre, Klinik und Mitarbeit oder Vertretung in einer Praxis.
In einem sehr kompetitiven Umfeld, wo die eigenen Projekte und Ergebnisse ständigen Evaluationen und Gutachten unterzogen werden müssen, kann die Karriere als eine Einbahnstraße mit lauter Stoppschildern empfunden werden. Wenden kann man nicht mehr, aber an jeder Kreuzung besteht die Gefahr, einen befristeten Vertrag nicht verlängert zu bekommen und letztendlich die Laufbahn verlassen zu müssen. Die vielen Zeitverträge ohne Aussicht auf Verbeamtung oder Pragmatisierung (was in Österreich generell abgeschafft wurde) haben zu einem wissenschaftlichen „Prekariat“ geführt.3 Die Freiheit besteht dann darin, vielleicht nach wenigen Jahren [17]Laufzeit ganz „freigesetzt“ zu werden. Diejenigen, die es schießlich auf eine Professur schaffen, erreichen das im Durchschnitt mit 41,1 Jahren – die Etablierungsphase ist also extrem lang. Wo sich Unsicherheit über die berufliche Zukunft breitmacht, kommt der Motivationsmotor schnell ins Stottern.
Schließlich steht der grundsätzlichen Selbstbestimmung, was wann geschrieben und publiziert wird, ein weicher, aber ständiger Zeitdruck entgegen: das Motto „publish or perish“, dem sich de facto niemand entziehen kann. Termine für die Abgabe von schriftlichen Ausarbeitungen von Vorträgen oder von Beiträgen zu Sammelbänden und Zeitschriften sowie von Rezensionen liegen oft mehr als ein Jahr in der Zukunft. Das verführt dazu, leichtfertig und ohne genaue Planung Zusagen zu machen, die dann, wenn der Termin naht, Stress verursachen.
Listen Sie auf, welche institutionellen und äußeren Faktoren Ihre Freiheit einschränken, etwa Fremdbestimmung durch Teamarbeit, Doppelbindungen, Gleichzeitigkeit mehrerer Jobs, Druck durch ständige Evaluationen, Zeitverträge, gefühlter Publikationszwang, ...
Konsequenzen
Die akademischen Freiheiten, ihre inneren Problematiken sowie die skizzierten typischen Zwänge haben alle zur Folge, dass Ihre Selbstverantwortung enorm gefordert ist – vielleicht mehr als in jedem anderen Beruf. Sie können und müssen Projekte auswählen, entwickeln und strukturieren, Qualitätsmaßstäbe definieren, Prioritäten setzen und all das mit sehr viel Ausdauer und Disziplin sowie oft mit wenig Unterstützung umsetzen. Der Planungshorizont umfasst mehrere Jahre, während derer Sie Ihre intrinsische Antriebskraft nicht verlieren dürfen.
In der Motivation werden drei Ebenen unterschieden: Die Notwendigkeit, zu überleben und die dazu nötigen Mittel zu beschaffen, bildet die basale Ebene. Wo diese Grundlage brüchig ist, kann Verzweiflung aufkommen.
Die zweite Ebene, nämlich äußere Motivation durch Bestrafungen und Belohnungen, oder in milderer Form durch Kritik und Lob oder Anerkennung, ist alleine und auf Dauer auch nicht ausreichend für das Durchstehen der langen Qualifizierungsphase. Schließlich ist man hierbei von anderen abhängig, von ihrem Wohlwollen, ihrer Akzeptanz und Fairness.
[18]Die höchste Stufe ist die Selbstmotivation durch das Erfahren von Kompetenz, Können und Wissen, von Autonomie und von Sinn im eigenen Tun.4 Bei diesen drei Faktoren schneidet wissenschaftliche Tätigkeit an sich recht gut ab: Sie basiert ja auf Wissen und dessen Anwendung; zudem erlaubt sie trotz aller institutionellen und weichen Zwänge ein überdurchschnittliches Maß an Selbstbestimmung. Allerdings garantiert der Motivationsfaktor Autonomie noch nicht, dass ein angemessener, stabiler und entwicklungsfähiger Platz im System erreicht wird. Was den dritten, intrinsischen Faktor angeht, wird Wissenschaft jenseits von Master, Diplom oder Magister ohnehin von den Menschen als Beruf erwählt, die darin einen Sinn erkennen, der über unmittelbare Nützlichkeit hinausgeht – sei es klassisch gesprochen das Finden von Wahrheit, das Aufzeigen von Schönheit oder das Befördern von Gutem.
Was hat mich ursprünglich motiviert, eine wissenschaftliche Tätigkeit zu wählen?
Was motiviert mich heute, dabei zu bleiben?
Was kann ich tun, um meine intrinsische Motivation zu stärken?
Sicherlich sind Ihnen beim Nachdenken darüber, welche Faktoren Ihre persönliche Situation mit konditionieren, Ideen oder Forderungen zur Verbesserung der äußeren Bedingungen in den Sinn gekommen. Diese sind wichtig, und Sie sollten mit anderen zusammen dafür kämpfen. Allerdings werden Sie das nur dann tun können, wenn Sie Ihre eigenen wissenschaftlichen Projekte und Aufgaben mit gutem Zeitmanagement bewältigen. Da es in deutschsprachigen Universitäten nur wenige akademische Administratoren gibt, die grundsätzlich keine Forschungs- und Lehrpflichten hätten, hängt die Möglichkeit, das System zu verbessern, davon ab, durch eigene Forschung und Lehre im System zu bleiben und sich auch fachlich Reputation zu erwerben.
Nur wenn Sie selbst unter den gegebenen Bedingungen einigermaßen erfolgreich sind, ohne dabei zu zynisch zu werden, also in einer psychisch gesunden und lebenswerten Weise fortkommen, können Sie längerfristig an deren Verbesserung mitarbeiten.
Darum setzt unser Buch bei Ihnen als Individuum an, um zunächst Ihre Selbstorganisation in der Wissenschaft zu optimieren. Dabei nehmen wir [19]Ihr ganzes Leben in den Blick, um nachhaltig lebbare Methoden, Gewohnheiten und Rhythmen zu entwickeln, die zu Ihrer persönlichen Situation passen. Sich auf Kosten anderer wichtiger Lebensbereiche und -ziele im Beruf zu Höchstleistungen zu motivieren, funktioniert nur punktuell und selten auf Dauer – in der Wissenschaft noch weniger als in der Industrie, wo monetäre und andere Anreize stärker und häufiger wirksam sind.
Das hat Konsequenzen im Großen, im Kleinen und speziell im Bereich der Forschung.
1. Im Blick auf Ihr ganzes Leben auch in seiner zeitlichen Erstreckung sind Sie selbst verantwortlich für Ihre Karriere- und Lebensplanung. Es ist bekanntlich längst nicht mehr so, dass spätestens nach einer guten Promotion eine Assistentenstelle zu erwarten ist, auf der man bis zu Habilitation und/oder Verbeamtung bleiben kann, während der Ordinarius die moralische Verpflichtung spürt, seine „Schüler“ irgendwo „unterzubringen“. Es ist natürlich auch nicht mehr so wie für Immanuel Kant Ende des 18. Jahrhunderts, dass zehn Jahre ohne Publikationen akzeptabel erschienen, während derer ein „Opus magnum“ wie die „Kritik der reinen Vernunft“ erarbeitet werden konnte. Sie müssen wissen, bis wann Sie welche Karriereschritte gehen und was Sie tun wollen, wenn sich die Laufbahn an einem bestimmten Punkt als eine Sackgasse erweist. Das heißt, Sie sollten sich frühzeitig über berufliche Alternativen und deren Vorbereitung Gedanken machen. Sie müssen sich bewusst sein, welchen Preis Sie für die prekäre Freiheit eines Lebens für die Wissenschaft zu bezahlen bereit sind. (Siehe zu diesen großen Fragen besonders das Kapitel II.3.)
Vor allem in der Promotionsphase verfolgen viele knapp Dreißigjährige die Strategie, erst einmal ihr Doktorat zu erwerben, und dann weiterzusehen, ob sich irgendwelche Türen öffnen. Das hat einen hohen Preis: Das Risiko, sich im vierten Lebensjahrzehnt oder zur Lebensmitte ganz neu orientieren zu müssen, während man auf dem Arbeitsmarkt schon als überqualifiziert, zu spezialisiert oder schlicht als zu alt gilt.
Solange Sie nicht hinreichend sicher sind, dass Ihre wissenschaftliche Karriere klappen wird: Entwickeln Sie mindestens einen alternativen Lebensentwurf, am besten auch im Gespräch mit einer Vertrauensperson oder einem Coach. Das ermöglicht Ihnen, frühzeitig Vorsorge zu treffen durch zusätzliche andere Qualifikationen und Netzwerke, und verhindert, dass Sie später das Gefühl bekommen, Ihr Leben in eine Sackgasse gefahren zu haben.
[20]2. Diese Lebens- und Karriereplanung gehört nicht nur zum Zeitmanagement im großen Horizont, sondern hat über die Motivation Einfluss auf die Zeitgestaltung und -nutzung auch im Kleinen und Alltäglichen.
In den Planungshorizonten von Monat, Woche und Tag dürfen Sie Ihre langfristigen Ziele und Alternativszenarien nicht aus dem Blick verlieren. Wer sich vom jeweils Andrängenden treiben läßt, agiert nicht mehr selbstbestimmt. Denken und planen Sie von oben nach unten: vom Wichtigen zum Dringlichen, von den Werten zu den Terminen, von den großen Projekten zu den kleinen Aufgaben. Schaffen Sie in Ihrem Zeitmanagement Raum und regelmäßige Zeitblöcke für das Reflektieren und Planen selbst sowie zuerst für die größeren und langfristigen Ziele. Ein gegebener Raum für Selbstbestimmung wird nur dadurch erweitert, dass er auch genutzt wird.
Soweit Sie selbst über Ihre Zeit verfügen können, passen Sie die Zeiteinteilung auch an Ihre individuellen Ziele und Werte, an Ihren persönlichen Verhaltensstil und an Ihre Lebenssituation an (siehe Kapitel II). Selbstverständlich ist dabei die spezifische Wissenschaftskultur in Ihrem Fach und an Ihrem Institut ebenfalls zu berücksichtigen.
Wie hohe Umsetzungschancen traue ich meiner eigenen Planung und Selbstbestimmung zu? Bin ich vielleicht bereits in einer Opfer-Mentalität gefangen und lasse mich vom „Wissenschaftsbetrieb“ treiben?
Kann ich die Frage beantworten, was ich tun würde, wenn der nächste Karriereschritt misslingen sollte? Und was tue ich heute schon für diese Eventualität?
Setze ich meine großen Ziele auch in den kleineren Planungshorizonten um?
3. Die Planung von Forschungsarbeiten erfordert, Grundregeln des Projektmanagements zu kennen und anzuwenden. Vor allem bei Teamwork, aber auch in der Alleinverantwortung für ein Forschungsprojekt gilt es, von der Sache her, also objektiv sich ergebende Phasen in ihrer logischen Abfolge zu identifizieren und zu planen. Wo kein Forschungsexposé und Zeitplan vorzulegen waren, um etwa eine Förderung zu erhalten, sollten Sie sich das dennoch in Tabellenform erarbeiten (siehe Kapitel VI.1). Wenn Sie die einzelnen Phasen und Teilziele mit Zieldaten versehen und das in die chronologische Planung in Kalenderform integrieren, berücksichtigen Sie auch die Erfordernisse Ihrer subjektiven Lebenslage und „private“ Lebensziele wie außerwissenschaftliche Qualifikationen, Partnerschaft und Familie, andere Interessen und Tätigkeiten, welche für Sie Sinn stiften, Rekreation und Motivation bereitstellen. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Buch vor allem ab Kapitel II.3.