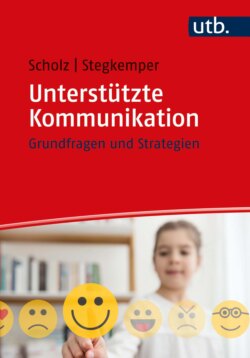Читать книгу Unterstützte Kommunikation - Markus Scholz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinleitung
In diesem Buch möchten wir die unseres Erachtens zentralen Fragen aus dem Feld Unterstützter Kommunikation (UK) stellen und darauf aufbauend Strategien herausarbeiten, mittels derer die kommunikative Partizipation von Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen substanziell unterstützt werden kann.
In Kapitel 1 adressieren wir die Frage „Was ist Kommunikation und wie entwickelt sie sich?“. Den ersten Teil bilden eine Begriffsklärung sowie die Vorstellung grundlegender Modelle des Kommunikationsprozesses und der Kommunikationsentwicklung. Im zweiten Teil wird der Zeichenbegriff aus der Linguistik eingeführt und erläutert sowie Kommunikation mit Blick auf Absicht, Form, Inhalt und Wirkung charakterisiert.
Kapitel 2 behandelt die Frage „Was ist Unterstützte Kommunikation?“. Dazu wird zunächst die heterogene Personengruppe „Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen“ genauer bestimmt. Daran schließt sich eine Einführung in Unterstützte Kommunikation und ihre Chancen, Herausforderungen und Modalitäten an.
Das Kapitel 3 soll PraktikerInnen helfen, Möglichkeiten und Grenzen unterschiedlicher Kommunikationshilfen empirisch begründet abzuwägen und informierte Entscheidungen über Modalitäten Unterstützter Kommunikation zu treffen. Dafür beleuchten wir fünf Teilfragen zum Einsatz von Kommunikationshilfen: (1) Welches Vokabular wird zur Verfügung gestellt?, (2) Wie wird Bedeutung repräsentiert?, (3) Wie wird das Vokabular optisch gestaltet, organisiert und dokumentiert?, (4) Wie wird eine Nachricht ausgedrückt und was wird auf Seiten des UK-Nutzers bzw. der UK-Nutzerin vorausgesetzt? und (5) Was wird auf Seiten des Empfängers bzw. der Empfängerin vorausgesetzt und wie wird eine Nachricht empfangen?
Die Grundfrage des Kapitels 4 lautet „Wie kann Kommunikation diagnostiziert werden?“. Hierzu stellen wir zunächst grundlegende, konstruktivistisch fundierte Gedanken zur Diagnostik voran und ergänzen diese anschließend um Ausführungen zur Kommunikationsdiagnostik im engeren Sinne. Dabei besprechen wir konkrete Methoden, Leitfragen und auch Verfahren. Einen wesentlichen Aspekt des Kapitels bilden zudem unterschiedliche Fokusse und darauf bezogene sensibilisierende Fragen, die es PraktikerInnen ermöglichen sollen, ihren diagnostischen Blick zu weiten und dabei auf die Person und ihr Umfeld zu blicken. Das Kapitel schließt mit einer Betrachtung des Partizipationsmodells von Beukelman und Mirenda (2013), das aus unserer Sicht eine hilfreiche Brücke zwischen Diagnostik und Kommunikationsunterstützung schlägt.
Im Kapitel 5 steht schließlich die Frage „Wie kann Kommunikation konkret unterstützt werden?“ im Mittelpunkt. Dieses Kapitel baut auf den vorgestellten Theorien und Überlegungen auf und versammelt entwicklungslogisch sinnvolle sowie theoretisch und empirisch fundierte Strategien, mithilfe derer Personen in ihrer kommunikativen Entwicklung unterstützt werden können. Dabei denken wir unterschiedlichste Modalitäten Unterstützter Kommunikation mit und diskutieren Strategien mit Blick auf Personen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen sowie auf ihr Umfeld. Außerdem arbeiten wir heraus, wie Unterstützung im Kontext Unterstützter Kommunikation sinnvoll begleitet und dokumentiert und damit die Ergebnis- und Prozessqualität gesteigert werden kann.
Am Ende des Buches befindet sich ein Glossar, in dem wir alle zentralen Begriffe und Konzepte aus dem gesamten Buch noch einmal pointiert erläutern.
Bei der Beantwortung der Grundfragen Unterstützter Kommunikation über die folgenden Kapitel hinweg ist es uns besonders wichtig, aus theoretischen Überlegungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen praktische Konsequenzen abzuleiten. Dazu ergänzen wir den Text an geeigneten Stellen durch Forschungsschlaglichter und Praxistipps.
Mittels der Forschungsschlaglichter werden wichtige, z. T. auch sehr spezifische Fragen auf Basis aussagekräftiger wissenschaftlicher Studien beleuchtet. Wir weiten dabei bewusst den Blick über den deutschsprachigen Raum hinaus, auch auf internationale Forschung, um dort publizierte Erkenntnisse auch für LeserInnen eines einführenden Werkes zugänglich zu machen.
Bei den Praxistipps handelt es sich um konkrete Empfehlungen für die tägliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen. Sie leiten sich aus den besprochenen Theorien, Forschungsergebnissen und unseren eigenen Erfahrungen ab.