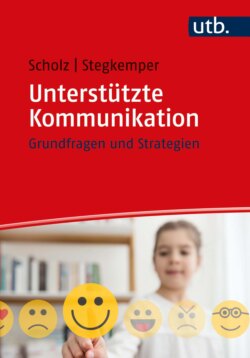Читать книгу Unterstützte Kommunikation - Markus Scholz - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 Was ist Kommunikation und wie entwickelt sie sich?
Im Folgenden stellen wir Kommunikation grundlegend dar und beschreiben unter Berücksichtigung zentraler kommunikations- und entwicklungstheoretischer sowie linguistischer Überlegungen, wie sie sich bei Menschen zeigt und entwickelt.
1.1 Begriffsbestimmung und Kommunikationstheorien
Der Begriff „Kommunikation“ leitet sich vom lat. communicatio (Mitteilung) bzw. communicare (mitteilen, gemeinschaftlich machen) ab (Kluge / Seebold 2012). Er beschreibt also nicht nur eine Informationsweitergabe, sondern schlichtweg „alle Verhaltensweisen und Ausdrucksformen, mit denen wir mit anderen Menschen bewusst oder unbewusst in Beziehung treten“ (Wilken 2018a, 11).
Übliche Kommunikationstheorien beziehen ähnliche Akteure und Elemente ein. So ist meist von einem / einer SenderIn, einer übermittelten Nachricht, Information oder auch einem Kommunikationsinhalt die Rede. Weiter wird davon ausgegangen, dass diese / r eine / n EmpfängerIn bzw. RezipientIn erreicht.
Das Verständnis von Shannon und Weaver
All diese Elemente finden sich bereits im klassischen Sender-Empfänger-Modell von Claude E. Shannon und Warren Weaver (1976), das eine lineare Vorstellung von Kommunikation widerspiegelt: Ein / e SenderIn möchte eine Information übermitteln. Dazu encodiert (verschlüsselt) er / sie diese Information und schickt sie durch einen Kommunikationskanal zu einem / einer EmpfängerIn. Von diesem / dieser wird die empfangene Nachricht dann decodiert (entschlüsselt) und weiterverarbeitet.
Diese Vorstellung erinnert an das Verschicken einer Nachricht per Rohrpost: Eine Botschaft wird von dem / der SenderIn eingepackt, durch einen Kanal geschickt und von dem / der EmpfängerIn wieder ausgepackt. Dies hängt damit zusammen, dass die Autoren ihr Kommunikationsmodell mit Blick auf technisch vermittelte Kommunikation entwickelt haben. Dadurch ist das Modell weniger geeignet, zu erklären, warum Menschen in einer Kommunikationssituation auch ganz unterschiedliche Vorstellungen kommunizierter Sachverhalte haben können und sich missverstehen. Es wird von den Autoren zwar zugestanden, dass es nicht nur die Möglichkeit einer „technischen“, sondern auch einer „semantischen Störung“ gebe – wie genau es zu einer solchen kommt, bleibt aber eher diffus.
Das Verständnis von Watzlawick et al.
Hier helfen die Überlegungen der KommunikationswissenschaftlerInnen und -psychologInnen Paul Watzlawick, Janet H. Beavin und Don D. Jackson weiter. Sie untersuchen die Entstehung kommunikativer Störungen und formulieren in diesem Zusammenhang fünf Axiome zur Kommunikation.
Ein Axiom bezeichnet dabei einen als absolut richtig erkannten Grundsatz. Aus einer solchen Aussage, die logisch nicht mehr hinterfragt werden kann, können weiterführende Aussagen abgeleitet werden. Um die Entwicklung der Axiome besser einordnen zu können, hilft es, zu berücksichtigen, dass die genannten AutorInnen sie aus der erkenntnistheoretischen Perspektive des Konstruktivismus formulieren. Sie gehen also davon aus, dass Wahrnehmung ein subjektiver Konstruktionsprozess ist, der sich nicht einfach auf eine ontische, also unabhängig vom Bewusstsein existierende, Realität stützen kann.
Axiom 1: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick et al. 2011, 60; Hervorhebung M. S. / J. S.).
Das erste Axiom der AutorInnen ist wohl auch das bekannteste. Die Annahme, dass Menschen nicht nicht kommunizieren können, wirkt argumentativ aber schnell angreifbar, wenn man nicht die ihr zugrunde liegende Setzung versteht. Dies kann an folgendem Beispiel gezeigt werden:
Eine junge Frau betritt ihre WG und ruft beim Betreten der Wohnung „Hallo!“ – es kommt keine Antwort ihres Mitbewohners zurück, da dieser gerade in seinem Zimmer schläft.
Hat der Mitbewohner nun etwas kommuniziert? Hat die junge Frau das Recht, deswegen enttäuscht von ihm zu sein? Um die Situation aufzulösen, gilt es zu beachten, dass Watzlawick et al. (2011) in zwei Schritten argumentieren. Sie legen zunächst fest, dass sich ein Mensch nicht nicht verhalten kann. Auch der Mitbewohner verhält sich: Er schläft. In einem zweiten Schritt gehen sie davon aus, dass jedes Verhalten kommunikativ interpretiert werden kann. Der Mitbewohner kann sich also nicht dagegen wehren, dass sein Schlafen von der jungen Frau als unhöfliches Nicht-Antworten interpretiert wird. Dass Menschen nicht nicht kommunizieren können, liegt also darin begründet, dass jedes Verhalten kommunikativ interpretierbar ist.
Praxistipp 1 – Kommunikatives Interpretieren
Wenn jedes Verhalten kommunikativ interpretiert werden kann, nimmt dies das Umfeld von Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen in die Verantwortung. Häufig liegt es in der Hand dieses Umfelds, ob dem Verhalten einer Person Sinnhaftigkeit und ein kommunikativer Charakter zugesprochen werden. Wie im Weiteren gezeigt wird, ist es für die Entwicklung von Kommunikation hoch bedeutsam, dass dem Verhalten von Personen auch eine kommunikative Absicht unterstellt wird. Zugleich kann es aber auch zu einer Zumutung für Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen werden, wenn ausnahmslos jedes Verhalten von ihnen kommunikativ interpretiert wird. Es gilt, diese beiden Aspekte also genau im Blick zu behalten und abzuwägen.
Axiom 2: „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakognition ist“ (Watzlawick et al. 2011, 64).
Die AutorInnen gehen davon aus, dass alle Kommunikationssituationen eine inhaltliche und eine zwischenmenschliche Komponente besitzen. Letztere bestimmt darüber, wie der Inhalt verstanden wird.
Wenn z. B. während einer Konferenz eine Kollegin, die Sie nicht leiden können, einen inhaltlichen Vorschlag macht, ist davon auszugehen, dass Sie eher geneigt sind, diesen inhaltlich abzuwerten.
Das bekannte Kommunikationsmodell Schulz von Thuns (2011) baut auf dieser Beobachtung von Watzlawick et al. (2011) auf. Er beschreibt darin, dass jede Nachricht vier Seiten umfasst: einen Sachinhalt, einen Beziehungsaspekt, eine Selbstoffenbarung mit Blick auf den / die SenderIn und eine Appellfunktion mit Blick auf den / die EmpfängerIn. I.d.R. will der / die SenderIn eine Nachricht in einer bestimmten Weise verstanden wissen. Aufgrund der immer präsenten vier Seiten einer Nachricht, kann der / die EmpfängerIn eine Nachricht aber in unterschiedlicher Weise verstehen. Hierin liegen also kommunikative Missverständnisse und Verblüffungserfahrungen begründet, auf die wir später in diesem Kapitel noch weiter eingehen werden.
Praxistipp 2 – Kommunikation ist mehr als Informationsweitergabe
Kommunikation ist deutlich mehr als reine Informationsweitergabe – dies gilt auch mit Blick auf Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen. Entsprechend sollte hinterfragt werden, ob auch sie Vokabular zur Verfügung haben, das es ihnen ermöglicht, Zwischenmenschliches zu kommunizieren. Für Menschen, die sich verbalsprachlich ausdrücken, ist es selbstverständlich, bestimmte Seiten einer Nachricht akzentuieren zu können – bei Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen wird hingegen in der Praxis häufig zu einseitig an die Übermittlung von Grundbedürfnissen und Sachinformationen gedacht.
Axiom 3: „Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt“ (Watzlawick et al. 2011, 69 f.).
Durch eine Interpunktion wird ein Sinnabschnitt markiert. Watzlawick et al. (2011) gehen davon aus, dass jede / r KommunikationsteilnehmerIn eine Kommunikationssituation in Sinnabschnitte unterteilt.
Als beispielhafte Situation skizzieren sie folgenden Fall: Person A nörgelt – Person B zieht sich zurück – Person A nörgelt – Person B zieht sich zurück – Person A nörgelt – … (Watzlawick et al. 2011, 67).
Person A könnte hier den Sinnabschnitt setzen, dass sie Grund zum Nörgeln hat, weil Person B sich zurückzieht. Person B hingegen wird eher feststellen, dass sie sich zurückzuzieht, weil Person A an ihr herumnörgelt. Mitunter verfestigen sich solche, von den KommunikationsteilnehmerInnen zugeschriebenen Ursache-Wirkungs-Mechanismen. Menschen können dann über die Zeit höchst divergierende Sichtweisen auf ihre gemeinsame Kommunikationsgeschichte entwickeln (Watzlawick et al. 2011, 65 ff.).
Axiom 4: „Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten. Digitale Kommunikationen haben eine komplexe und vielseitige logische Syntax, aber eine auf dem Gebiet der Beziehungen unzulängliche Semantik. Analoge Kommunikationen dagegen besitzen dieses semantische Potenzial, ermangeln aber der für eindeutige Kommunikation erforderlichen logischen Syntax“ (Watzlawick et al. 2011, 78).
Digitale Kommunikation bezeichnet in diesem Zusammenhang die (Verbal-)Sprache, analoge Kommunikation das Nonverbale. Ein Wort verweist i. d. R. präzise auf eine bestimmte Wortbedeutung, ist also in diesem Verständnis digital. Dies ermöglicht es, Informationen unabhängig von Zeit und Ort zu vermitteln. Nonverbales, wie z. B. Gestik und Mimik, kann hingegen besser verdeutlichen, wie es um den Beziehungsaspekt bestellt ist, also wie Personen zueinander stehen und wie eine geäußerte Nachricht verstanden werden soll.
Beide Formen haben demnach Stärken und Schwächen und können einander gewinnbringend ergänzen (Watzlawick et al. 2011, 71 ff.). Im Umkehrschluss gilt: Wird ein Aspekt (digital oder analog) weggelassen bzw. steht dieser generell nicht zur Verfügung, kann dies die Kommunikation merklich erschweren.
Axiom 5: „Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht“ (Watzlawick et al. 2011, 81).
Auch Machtverhältnisse nehmen Einfluss darauf, wie Kommunikation funktioniert: In einer symmetrischen Kommunikationssituation stehen PartnerInnen auf derselben hierarchischen Ebene (z. B. Studentin und Student). Die Kommunikation verläuft dann eher spiegelbildlich und die PartnerInnen streben danach, eventuelle Unterschiede zu vermindern. In einer komplementären Kommunikationssituation hingegen existiert eine (hierarchisch bedingte) Ungleichheit der PartnerInnen (z. B. Dozentin und Student in einer Sprechstunde). In der Kommunikation werden sich beide dann eher ergänzen, die Ungleichheit wird dabei i. d. R. beibehalten, z. B. stellt der Student eher Fragen und die Dozentin gibt eher Antworten (Watzlawick et al. 2011, 79 f.).
Praxistipp 3 – Kommunikation auf unterschiedlichen Hierarchieebenen
Aus diesem Axiom lassen sich zwei Überlegungen folgern: Zum einen wird abhängig vom Verhältnis der KommunikationspartnerInnen unterschiedlich formelles Vokabular benötigt. Es ist also sinnvoll, zu hinterfragen, ob auch einer Person mit komplexem Kommunikationsbedürfnis eine Auswahl an Vokabular zur Verfügung steht, die es ihr erlaubt, situativ angemessen zu kommunizieren. Zum anderen kann eine dem Verhältnis angemessene Kommunikation gar nicht erst erlernt werden, wenn eine Kommunikationsunterstützung nicht auch für unterschiedliche Kommunikationssituationen sensibilisiert. Zu oft wird in der Praxis vergessen, einer Person auch Gelegenheit zu geben, sich mit Personen derselben „Hierarchieebene“ auszutauschen und sich auch in solchen Situationen als kommunikativ wirksam zu erfahren (Peer-Modeling Kap. 5.3).
1.2 Verbale und nonverbale Kommunikation
Ausgehend vom vierten Axiom von Watzlawick et al. (2011) wurde bereits besprochen, dass Menschen i. d. R. verbal und nonverbal kommunizieren; häufig auch in Kombination miteinander. Im Folgenden gehen wir dieser Beobachtung weiter nach und ergründen, wie Menschen (non-)verbal kommunizieren.
Verbale Kommunikation
Verbale Kommunikation beinhaltet „alles […], was dem konventionell etablierten System der Sprache zuzurechnen ist“ (Helfrich / Walbott 1980, 267).
Sie nutzt also Wörter als Zeichen und verbindet diese nach syntaktischen Regeln. Sie hat einen semantischen Gehalt (Inhalt und Bedeutung der Wörter bzw. der Sätze), nutzt Begriffe, die der Lexik, d. h. dem Wortschatz einer Sprache entstammen. Die Wörter werden von Menschen pragmatisch verwendet, d. h. in konkreten Situationen genutzt, um kommunikative Handlungen zu vollziehen.
Nonverbale Kommunikation
Nonverbale Kommunikation bezeichnet zunächst – in Abgrenzung zu verbaler Kommunikation – all jene Äußerungsformen, die ohne Wörter auskommen. Nonverbale Äußerungen lassen sich aber noch differenzierter betrachten. So unterscheiden Helfrich und Wallbott (1980) zwischen vokaler und nonvokaler Kommunikation (Tab. 1).
| Nonverbale Kommunikation | |||||
| Vokal (von Stimm- und Sprechwerkzeugen hervorgebracht / abhängig) | Nonvokal (von Stimm- und Sprechwerkzeugen unabhängig) | ||||
| Zeitabhängige Aspekte | Stimmabhängige Aspekte | Kontinuitätsabhängige Aspekte | Motorische Kanäle | Physio-chemische Kanäle | Ökologische Kanäle |
Unter dem Vokalen versteht man dabei jene (Aspekte von) Äußerungen, die mittels der Stimm- und Sprechwerkzeuge hervorgebracht werden bzw. von diesen abhängig sind.
Hierzu zählen zeitabhängige Aspekte wie Sprechdauer, stimmabhängige Aspekte wie Stimmqualität und kontinuitätsabhängige Aspekte wie Versprecher.
Nonvokales ist „von den Stimm- und Sprechwerkzeugen unabhängig“ (Helfrich / Wallbott 1980, 268).
Es kann mittels motorischer (Mimik, Gestik, Blickkontakt, Körperhaltung), physiochemischer (taktile Aspekte, thermale Aspekte z. B. kalte Hände) sowie ökologischer Formen übermittelt werden (interpersonale Distanz, persönliches Auftreten, Territorialverhalten). Interkulturelle Untersuchungen zeigen, dass nonvokale Äußerungen mitunter sogar kulturunabhängig angelegt sind und universal mit den gleichen mimischen Äußerungsformen ausgedrückt und verstanden werden. Dies betrifft insbesondere grundlegende Emotionen wie Wut, Ärger, Trauer, Freude, Überraschung, Ekel und Scham (Eibl-Eibesfeldt 1999, 684).
Tab. 1: Vokale und nonvokale Aspekte nonverbaler Kommunikation (Helfrich / Wallbott 1980, 268).
1.3 Kommunikationsentwicklung
Nachdem wir Kommunikation grundlegend systematisiert und betrachtet haben, werfen wir nun einen Blick auf die Entwicklung von Kommunikation. Wir besprechen, wie sich die kommunikativen Möglichkeiten von Kindern von Geburt an entwickeln.
Betrachten wir vorliegende Modelle und Vorstellungen der vorsprachlichen Kommunikationsentwicklung (u. a. Aktas 2012; Coupe-O‘Kane / Goldbart 1998; Rowland 2011; Rowland / Stremel-Campbell 1987) zeigt sich, dass diese i. d. R. von drei aufeinanderfolgenden Phasen ausgehen: (1) Eine vorintentionale bzw. vorkommunikative Phase. Hier erkennen Kinder noch nicht, dass sie mithilfe von Signalen in ihrer Umwelt etwas bewirken können – sie sind hauptsächlich auf sich oder ein einzelnes Ziel bezogen. (2) Eine Phase intentional-vorsymbolischer bzw. informeller Kommunikation. Hier kommunizieren Kinder bereits zielgerichtet mit KommunikationspartnerInnen, aber noch ohne die Nutzung von Symbolen, welche Bedeutungen allgemein verständlich repräsentieren. (3) Eine Phase intentional-symbolischer bzw. formaler Kommunikation. In dieser kommunizieren sie schließlich mittels konkreter oder abstrakter Symbole (Sprache, abstrakte Piktogramme, Gebärden etc.).
Modell zur Kommunikationsentwicklung
Nachfolgend wird diese Abfolge anhand des Entwicklungsmodells von Rowland (2011) bzw. Rowland und Stremel-Campbell (1987) detaillierter ausgeführt. Das Modell orientiert sich an den Phasen, die von Säuglingen bzw. Kleinkindern in den ersten 24 Monaten durchlaufen werden. Durch Publikationen von Kane wurde das Modell auch im deutschsprachigen Raum verbreitet (Kane 1992; 1996; 2018). Es erweist sich als hilfreich, weil es auf die kommunikative Entwicklung fokussiert und dabei unterschiedlichste Ausdrucksformen berücksichtigt. Es bezieht lautliche und lautsprachliche Äußerungen ebenso ein wie Gesten, Gebärden oder piktografische Zeichen.
Obwohl die beiden Autorinnen von aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen sprechen, sollte nicht der Eindruck einer restriktiven Abfolge entstehen. Sie betonen, dass sich Kinder je nach kommunikativer Absicht bzw. Intention durchaus auch auf mehreren Stufen gleichzeitig befinden können (Rowland / Stremel-Campbell 1987). Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass die Entwicklung kommunikativer Ausdrucksmöglichkeiten stark von der Umwelt abhängig ist und daher nicht als ausschließlich in der Person festgelegt betrachtet werden darf. Insbesondere die Bezugspersonen und deren Verhalten spielen dabei eine wesentliche Rolle (Papousek / Papousek 1989).
1.3.1 Stufe 1: Vorintentionale Verhaltensweisen – vorintentionale Kommunikation
Die Entwicklungsvorstellung beginnt mit dem sog. vorintentionalen Verhalten. Verhaltensweisen des Kindes sind hier noch eher reaktiv oder reflexhaft (Rowland 2011). Das Kind hat also noch keine Vorstellung davon, was es ausdrücken möchte bzw. dass es sich überhaupt ausdrückt. Die frühen kindlichen Äußerungen werden aber dennoch von außen interpretiert: Für Eltern oder weitere Bezugspersonen scheint es so, als wären die kindlichen Verhaltensweisen (z. B. Veränderung der Körperhaltung, Lächeln etc.) mit einem bestimmten Empfinden oder Befinden verknüpft. Sie interpretieren diese Verhaltensweisen dann z. B. als Ausdruck von Wohlbefinden, Geborgenheit, Grundbedürfnissen wie Hunger und Durst oder als Signal für Schmerz oder Unwohlsein und reagieren entsprechend.
1.3.2 Stufe 2: Intentionale Verhaltensweisen – vorintentionale Kommunikation
Das Verhalten des Kindes ist nun intentional. Es verfolgt also ein Ziel und drückt z. B. etwas mit Blick auf innere Zustände (z. B. Müdigkeit) oder in Bezug auf ein Objekt (z. B. Spielzeug erhalten) aus. Dieses Verhalten ist allerdings noch nicht zielgerichtet kommunikativ. D. h., das Kind ist ausschließlich am jeweiligen Zustand oder Objekt orientiert. Dem Kind ist noch nicht klar, dass es sein Verhalten nutzen könnte, um andere Personen dazu zu bringen, etwas zu tun oder zu unterlassen. Es schreit z. B., weil es Hunger hat und nicht, weil es jemanden dazu bringen möchte, ihm Essen zu geben. Ausdrucksformen, die in dieser Stufe genutzt werden, umfassen Kopf- oder Armbewegungen, Laute, das Annähern an ein gewünschtes oder den Rückzug von einem unerwünschten Objekt etc. Bezugspersonen interpretieren die Handlungen des Kindes wiederum kommunikativ und reagieren entsprechend („Ah, du möchtest bestimmt deine Flasche!“). Aufgrund der konsequenten kommunikativen Interpretation durch die Bezugspersonen erlernt das Kind den Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der Reaktion der Umwelt. Dies bildet zugleich den Übergang zur nächsten Stufe.
1.3.3 Stufe 3: Unkonventionelle Kommunikation – intentionale vorsymbolische Kommunikation
Auf der Stufe der unkonventionellen Kommunikation hat das Kind den entscheidenden Schritt vollzogen: Seine Ausdrucksformen sind jetzt bewusst kommunikativ, es versucht, das Verhalten seiner KommunikationspartnerInnen gezielt zu beeinflussen. Zugleich läuft die Kommunikation aber noch unkonventionell ab. Das bedeutet, es verwendet Zeichen, die keiner Konvention (d. h. gesellschaftlich üblichen Form) folgen. Bei Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, die sich auf dieser Stufe der kommunikativen Entwicklung befinden, können das z. B. Körperbewegungen, Vokalisationen oder die Herstellung von Augenkontakt sein. Als Möglichkeiten, das Verhalten des Gegenübers zu beeinflussen, sind diese Ausdrucksformen zwar effektiv, in der weiteren Entwicklung werden sie aber durch sozial übliche konventionelle Verhaltensweisen ersetzt.
1.3.4 Stufe 4: Konventionelle Kommunikation – intentionale vorsymbolische Kommunikation
Das Kind nutzt nun konventionelle, sozial bekannte Zeichen zur Kommunikation. Dies können z. B. Laute oder auch Gesten sein. Eine besondere Bedeutung im Bereich der konventionellen Gesten hat dabei die Zeigegeste, welche in unterschiedlichen Kulturen verwendet wird und mit der sich ganz unterschiedliche Inhalte ausdrücken lassen (Aktas 2012, 36). Innerhalb dieser Stufe gelingt es dem Kind nun, gemeinsame Aufmerksamkeit mit Blick auf KommunikationspartnerInnen und einen Gegenstand herzustellen. Dies wird meistens durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Zeichen gewährleistet, indem das Kind Blickkontakt herstellt, während es auf einen Gegenstand zeigt. Intuitiv wird dieses Herstellen gemeinsamer Aufmerksamkeit von den Eltern sprachlich begleitet. Dinge, auf die das Kind zeigt, werden von ihnen benannt und erleichtern es dem Kind, die symbolische Ausdrucksform für den Gegenstand zu erlernen. Die konventionellen Zeichen werden in weiteren Stufen durch Symbole für Gegenstände, Personen oder Sachverhalte ersetzt.
1.3.5 Stufe 5: Konkrete Symbole – symbolische Kommunikation
Der Begriff des Symbols steht im Modell von Rowland (2011) bzw. Rowland und Stremel-Campbell (1987) für „Stellvertreter“, z. B. in Bezug auf reale Gegenstände oder Personen. Diese Stellvertreter gibt es in unterschiedlichen Modalitäten (Laute – ein Geräusch wird nachgeahmt, z. B. „Wauwau“ für Hund; Gesten / Gebärden – als Aufforderung, sich zu setzen, wird mit der flachen Hand der Stuhl berührt; piktografische Repräsentationen – die Zeichnung eines Gegenstandes steht für den realen Gegenstand). All diese Symbole sind auf dieser Stufe noch konkret. Das bedeutet, sie weisen eine hohe Ähnlichkeit mit der Beschaffenheit ihrer jeweiligen Bezugsobjekte auf (Aussehen, Klang, Haptik etc.).
1.3.6 Stufen 6 und 7: Abstrakte Symbole – symbolische Kommunikation und Sprache
In diesen Stufen verwendet das Kind schließlich abstrakte Symbole, zunächst einzeln (Stufe 6) und später dann in regelgeleiteter Kombination (Stufe 7). Im Gegensatz zu konkreten Symbolen weisen diese i. d. R. keine unmittelbare Ähnlichkeit zu den Gegenständen oder Sachverhalten auf, die sie repräsentieren. Der Bezug zwischen Symbol und Gegenstand oder Handlung ist also willkürlich. Ausnahmen im Bereich der Lautsprache sind hier insbesondere lautmalerische Wörter, sog. Onomatopoetika (1.4).
In der Regelentwicklung sind lautsprachliche Wörter die am häufigsten verwendeten abstrakten Symbole. Kinder, die über keine verbalsprachlichen Fähigkeiten verfügen, können aber z. B. auch Gebärden aus einer Gebärdensammlung oder Piktogramme einer Symbolsammlung nutzen, um sich auszudrücken. Die Verwendung der Symbole erfolgt dabei zu Beginn einzeln, es werden also noch keine Symbole kombiniert.
Syntaktische Strukturen zeigen sich erst in der siebten und letzten Stufe des Modells. Es beinhaltet die regelgeleitete Kombination mehrerer Symbole. Das Kind nutzt hier zunächst Zweier- oder Dreierkombinationen, wobei die Reihenfolge der Symbole eine wichtige Rolle für die Bedeutung spielt. Die Aussage „Ich Saft“ könnte z. B. ausdrücken, dass man Saft erhalten hat; die Frage „Saft ich?“, ob man Saft bekommt. Die syntaktischen und grammatikalischen Unterschiede zwischen Lautsprache und offiziellen Gebärdensprachsystemen, wie z. B. der Deutschen Gebärdensprache (Kap. 2.3), zeigen, dass diese Regeln modalitätsspezifisch sein können.
1.4 Kommunikation mit Blick auf Form, Inhalt, Absicht und Wirkung
Im Folgenden führen wir Kategorien ein, die es erlauben, Kommunikation tiefergehend zu betrachten. Dabei stehen, anknüpfend an sprachwissenschaftliche und kommunikationstheoretische Zugänge, die Form, die Bedeutung, die Absicht bzw. kommunikative Intention des Gesagten für den / die SenderIn sowie die kommunikative Wirkung der Äußerung auf den / die EmpfängerIn im Mittelpunkt.
Anhand des Modells von Rowland und Stremel-Campbell (1987) haben wir zuvor dargestellt, dass und wie sich die Kommunikationsformen im Laufe der Kommunikationsentwicklung verändern: Kinder gelangen i. d. R. von einer vorintentionalen Phase über eine Phase intentionaler, vorsymbolischer Kommunikation zur Nutzung unterschiedlich abstrakter Symbole. Unsere Verwendung des Symbolbegriffs orientierte sich am Sprachgebrauch der zitierten Entwicklungsmodelle. Im Weiteren werden wir nun eine sprachwissenschaftliche Perspektive auf Kommunikation einnehmen. Dabei passen wir unseren Sprachgebrauch an und benutzen, anstatt des Symbolbegriffs, den Zeichenbegriff, der im dortigen Diskurs gebräuchlicher ist.
Form und Inhalt
Der Schweizer Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure beschrieb im Jahre 1931 sprachliche Zeichen (franz. signe) als die Verbindung der Bezeichnung (franz. signifiant) und des Bezeichneten (franz. signifié). Wenn jemand die Bezeichnung „Baum“ äußert, taucht bei einem / einer ZuhörerIn i. d. R. eine Vorstellung eines Baumes auf (de Saussure 2001, 79; Abb. 1). Zeichen ermöglichen es also, durch das Äußern einer bestimmten Form die gedankliche Vorstellung eines bestimmten Inhalts anzuregen – auch wenn er abstrakt oder den KommunikationspartnerInnen nicht unmittelbar als Realgegenstand verfügbar ist.
Abb. 1: Zwei Seiten eines sprachlichen Zeichens (in enger Anlehnung an de Saussure 2001, 78)
De Saussure beschreibt, dass sprachliche Zeichen dabei i. d. R. arbiträr, d. h. willkürlich zugeordnet sind. Zwischen dem Laut- bzw. Schriftbild „Baum“ und der Vorstellung eines Baumes besteht also kein direkter inhaltlicher Zusammenhang. Ausnahmen stellen hier lautmalerische Wörter (Onomatopoetika) dar, die Sachverhalte lautlich abbilden (z. B. blinzeln, klappern, rascheln). Wenngleich die Zuordnung von Form und Bedeutung auf der Zeichenebene willkürlich ist, ist es der Gebrauch der Zeichen innerhalb einer Sprachgemeinschaft nicht – Form und Bedeutung werden in ihrem Zusammenspiel also konventionell gebraucht (de Saussure 2001, 81 ff.).
In diesem Unterkapitel haben wir bislang alleine von sprachlichen Zeichen gesprochen. Es kann aber nicht nur mittels eines Schrift- oder Lautbildes auf eine Bedeutung verwiesen werden. Wie im Rahmen der Kommunikationsentwicklung (Kap. 1.3) bereits angesprochen wurde, ist mit Blick auf Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen auch denkbar, nichtsprachliche Zeichen zu nutzen. So kann z. B. auch mittels einer Gebärde, einer Fotografie oder eines Piktogramms einer Symbolsammlung auf eine Bedeutung verwiesen werden.
Prinzipiell ist also immer dann von einem Zeichen zu sprechen, wenn eine bestimmte Form auf eine bestimmte Vorstellung bzw. Bedeutung verweist.
Denkt man den Zeichenbegriff weiter, so stellt sich mit Blick auf Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen zudem die Frage, ob auch motorische Zeichen (Körperhaltung, Mimik, Gestik) oder biophysische Zeichen (z. B. Berühren, Lachen oder Weinen) existieren. Damit verbunden ist die Frage, welche Informationen Bezugspersonen aus solchen Äußerungsformen zum Befinden oder den Bedürfnissen einer Person ableiten können. Da es sich vielfach um affektive, reflexhafte oder auch idiosynkratische Äußerungsformen handelt, sind sie oftmals nicht konventionell verständlich – anders als Laut- und Schriftbilder, Gebärden, Fotos oder Piktogramme.
Die Formen bedürfen also, um zu Zeichen zu werden, des Zusammenspiels mit einem / einer GesprächspartnerIn, die dem Verhalten einen Sinn attestiert und es als Äußerung und kommunikative Zeichen deutet. Dabei kommt bei solchen Äußerungsformen erschwerend hinzu, dass der / die SenderIn sich des kommunikativen Charakters einer z. B. biophysischen Äußerung womöglich nicht gewahr ist bzw. diese gar nicht kommunikativ verstanden wissen möchte. Wenn es aber zur Wahrnehmung einer Bedeutung durch eine Bezugsperson kommt, und Form und Bedeutung über einen längeren Zeitrahmen und mit einer gewissen Verlässlichkeit einander zugeordnet werden, ist es durchaus denkbar, auch in solchen Fällen von einer Nutzung kommunikativer Zeichen zu sprechen.
Absicht und Wirkung
Bislang wurde vornehmlich besprochen, dass bei der Nutzung eines Zeichens mittels einer Form auf eine Bedeutung verwiesen wird. Der Psychologe Karl Bühler machte aber schon in den 1930er-Jahren in seinem Organonmodell (griech. organon, Werkzeug) deutlich, dass Zeichen nicht nur einen Darstellungscharakter mit Blick auf Gegenstände und Sachverhalte besitzen. Sie haben immer auch eine Ausdrucksfunktion mit Blick auf den / die SenderIn (z. B. kann der Gebrauch eines bildungssprachlichen Wortes einen Bildungshintergrund offenbaren) und eine Appellfunktion mit Blick auf EmpfängerInnen (z. B. kann die Aussage, man friere, den Appell zum Schließen des Fensters enthalten) (Bühler 1965).
Was Sprache für menschliche Kommunikation und Interaktion bedeutet, ist also nie allein mit Blick auf die Aspekte Form und Bedeutung zu erklären, sondern erst mit Blick auf den gesamten Akt des Sprechens in seinem Kontext. Die Verwendung (sprachlicher) Zeichen erfüllt für SenderIn und EmpfängerIn nämlich auch eine kommunikative Funktion.
Besonders differenziert reflektiert wurde dies in den Sprachwissenschaften von John Austin. In seiner Vorlesung an der Harvard-Universität ging er der Frage nach, was Menschen tun, indem sie etwas sagen („How to do things with words“ (1962)). Dabei entwickelte er die sog. Sprechakttheorie. Sie besagt, dass sprachliche Äußerungen (er nannte sie Sprechakte) immer durch drei Elemente gekennzeichnet sind: Eine Lokution (die Form und Bedeutung der Äußerung), eine Illokution (eine kommunikative Handlung, die durch eine Äußerung vollzogen wird) und eine Perlokution (eine kommunikative Wirkung der Äußerung). Abbildung 2 visualisiert diese Vorstellung in Verknüpfung mit dem Kommunikationsmodell von Shannon und Weaver (1976).
Die Lokution (lat. locutio, das Sprechen) bezieht sich auf die klassischen sprachwissenschaftlichen Aspekte von Form und Bedeutung des Gesagten. Auch Austin beschreibt, dass eine Person Laute produziert und zu Wörtern zusammenschleift, wenn sie sich äußert. Diese Wörter verweisen dann als sprachliche Zeichen auf eine Bedeutung (Austin 1962).
Abb. 2: Kommunikationsmodell in Anlehnung an Austin (1962) und Shannon / Weaver (1976)
Neben der Lokution führt Austin zwei zusätzliche Aspekte ein, die eine neue Perspektive zur Betrachtung menschlicher Kommunikation eröffnen: Er verweist mittels des Begriffs der Illokution darauf, dass vom Sprechenden durch das Sprechen selbst auch eine Handlung vollzogen wird. Diese These formuliert er ausgehend von sog. performativen Verben – Wörtern, durch deren Äußerung eine Handlung vollzogen wird (z. B. „danken“ oder „entschuldigen“ (1962, 79)). Wenn eine Person zu einer anderen sagt „ich danke dir“, dann wird durch diese Äußerung der Person gedankt. Damit wird ein Sprechakt vollzogen, den Austin als illokutionären Akt bezeichnet (1962, 102). Illokutionen sind also die „Bausteine einer jeden Kommunikation; sie stellen die einzelnen Züge innerhalb der kommunikativen Interaktion dar“ (Hindelang 2004, 8).
Praxistipp 4 – Folgen der Sprechakttheorie für die Unterstützung von Kommunikation
Die Sprechakttheorie sensibilisiert dafür, dass es mit Blick auf kommunikatives Handeln zu kurz greift, bei der Unterstützung von Kommunikation vornehmlich auf lokutionäre Aspekte zu setzen (Wortschatz, Zeichen, syntaktische Strukturen). Damit es wirklich zum (nonverbalen) Sprechakt kommen kann und eine Person mit komplexem Kommunikationsbedürfnis zu einer kommunikativ handelnden wird, muss auch daran gearbeitet werden, dass sie sich eigener Intentionen gewahr wird und lernt, diese kommunikativ zu verfolgen. Die zur Verfügung stehenden Zeichen und Strukturen können dabei natürlich ermöglichend wirken – sie schaffen für sich genommen aber noch nicht mehr Partizipation.
Der dritte Aspekt einer kommunikativen Äußerung – Austin nennt diesen die Perlokution – bezieht sich auf die Wirkung des Gesagten mit Blick auf den / die EmpfängerIn. Dabei sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Einerseits hat der / die SenderIn i. d. R. eine Absicht bzw. Intention hinsichtlich der Wirkung, die er / sie durch ihre Äußerung bei dem / der EmpfängerIn auslösen will. Dies liegt aber nicht vollumfänglich in seiner / ihrer Hand: Letztendlich zeigt erst die Antwort bzw. Reaktion des Empfängers oder der Empfängerin, wie eine Nachricht bei ihm / ihr ankam und welche Perlokution realisiert wurde (Austin 1962, 107 f.).
Forschungsschlaglicht 1 – Verbale und nonverbale Sprachhandlungen
In vielen Studien werden allein die verbalen Anteile kommunikativer Handlungen untersucht. Daneben finden sich vereinzelt Studien, die auch nonverbale Äußerungen mitdenken bzw. Sprachhandlungen bewusst multimodal untersuchen. So erforschten Quek et al. (2002) anhand videografierter Konversationen das multimodale Zusammenspiel von Sprache und Gestik. Snow et al. (1996) videografierten Eltern-Kind-Interaktionen und kodierten diese hinsichtlich gezeigter (non-)verbaler Handlungen. Kelly et al. (1999) zeigten Personen videografierte Interaktion und blendeten verschiedene Modalitäten gezielt ein oder aus. Auch wenn diese Studien sehr unterschiedlich angelegt sind, kommen sie doch alle zu dem Ergebnis, dass nonverbale Äußerungen ein integraler Bestandteil von Sprechakten sein können. Dabei sind verbale und nonverbale Äußerungen i. d. R. nicht wechselseitig redundant oder additiv, sondern bilden die Äußerungen vielfach erst gemeinsam. Nonverbales ist also eine wichtige Informationsquelle, anhand derer teilweise überhaupt erst klar wird, welche interaktionale Handlung eine Person vollziehen möchte.
Intentionalität
Die Intentionalität des Senders bzw. der Senderin kann als eine Art Motor der Kommunikationsentwicklung begriffen werden: Dadurch dass er / sie sich im Vorhinein bewusst ist, welche Perlokution er / sie bei dem / der EmpfängerIn durch sein / ihre illokutionäre Handlung auslösen möchte, wird er / sie sein / ihr kommunikatives Ziel solange weiter verfolgen, bis es entweder klar erreicht oder verfehlt wurde (Wetherby / Prizant 1989).
1.5 Absicht und Wirkung in konkreten Situationen
Wenn ein Kind, eine jugendliche oder erwachsene Person in Interaktion mit einer anderen Person tritt, tut sie das ab der Entwicklungsstufe der unkonventionellen Kommunikation absichtsvoll, d. h. mit einer kommunikativen Intention (engl. communicative intent) (Wetherby / Prizant 1989).
In diesem Abschnitt gehen wir solchen kommunikativen Intentionen nach. Dabei bleiben wir nah an den Begrifflichkeiten Austins und unterscheiden die kommunikative Absicht bzw. Intention des Senders bzw. der Senderin, die beobachtbare kommunikative Handlung sowie die kommunikative Wirkung mit Blick auf den / die EmpfängerIn sowie den / die SenderIn. Mit diesen Begrifflichkeiten grenzen wir uns ein Stück weit von der englischsprachigen Begriffsverwendung ab. Dort wird die Wirkung einer kommunikativen Handlung vielfach unter den Begriff function gefasst und der Absicht als intention oder intent gegenübergestellt (u. a. Reichle / Brady 2012; Wetherby / Prizant 1989). Da der Funktionsbegriff im Deutschen aber deutlich breiter genutzt wird und semantisch umfänglicher ist, übernehmen wir dies nicht eins-zu-eins.
In der vorliegenden Literatur finden sich unterschiedliche Zusammenstellungen kommunikativer Intentionen, die auf frühe Phasen der Kommunikationsentwicklung angewendet werden (u. a. Coupe-O‘Kane / Goldbart 1998; Kane 2018). Im Folgenden stellen wir exemplarisch die Modelle von Rowland und von Wetherby et al. vor (Rowland 2011; 2015; Wetherby et al. 1988).
Rowland (2011; 2015) unterscheidet vier kommunikative Intentionen: (1) Handlungen und Dinge ablehnen (engl. refuse), (2) Bekommen, was man möchte (engl. obtain), (3) die Beteiligung an sozialer Interaktion (engl. social) sowie (4) Informationen weitergeben oder erhalten (engl. information). Wetherby et al. (1988) differenzieren hingegen, unter Bezugnahme auf weitere AutorInnen (u. a. Bruner 1981), zwischen einer Verhaltenssteuerung anderer (engl. behavior regulation), sozialer Interaktion (engl. social interaction) und gemeinsamer Aufmerksamkeit (engl. joint attention). Auch wenn die Vorstellungen nicht deckungsgleich sind, haben sie doch Gemeinsamkeiten. Tabelle 2 bietet eine detailliertere Gegenüberstellung beider Modelle.
Tab. 2: Kommunikative Intentionen (Übersetzung: M. S.)
| Rowland (2011; 2015) | Wetherby et al. (1988) | ||
| Handlungen oder Dinge ablehnen | ■Ablehnung von Objekten und Handlungen | Verhaltenssteuerung anderer | ■Protestieren (Gegenstand oder Handlung ablehnen) ■Ein Objekt fordern ■Eine Handlung fordern |
| Bekommen was man möchte | ■Eine Handlung fortsetzen wollen ■Eine neue Handlung machen wollen ■Mehr von einem Gegenstand haben wollen ■Eine Auswahl treffen ■Einen neuen Gegenstand haben wollen ■Etwas haben wollen, das nicht da ist | ||
| Beteiligung an sozialer Interaktion | ■Jemanden begrüßen ■Aufmerksamkeit fordern ■Zuneigung zeigen ■Etwas teilen ■Höflichkeitsformen nutzen ■Aufmerksamkeit steuern | Soziale Interaktion | ■Jemanden begrüßen ■Aufmerksamkeit fordern ■Jemanden herbeirufen ■Eine soziale Routine fordern ■Um Erlaubnis fragen ■Jemanden zur Kenntnis nehmen |
| Informationen weitergeben oder erhalten | ■Ja- / Nein-Fragen beantworten ■Fragen stellen ■Dinge oder Mitmenschen benennen ■Etwas kommentieren | Gemeinsame Aufmerksamkeit | ■Etwas kommentieren ■Informationen über etwas einfordern ■Etwas klären |
Als Verhaltenssteuerung anderer lassen sich jene Intentionen bzw. Absichten zusammenfassen, die sich darauf beziehen, dass ein / e SenderIn versucht, eine / n EmpfängerIn dazu zu bringen, etwas zu tun. In der frühen Kommunikationsentwicklung geht es dabei z. B. darum, einen begehrten Gegenstand zu erhalten, jemanden dazu zu bringen, eine konkrete Handlung umzusetzen oder das Gegenteil, also einen Gegenstand abzulehnen oder eine Handlung zu unterlassen. Letzteres beschreibt Rowland (2011; 2015) als „Handlungen oder Dinge ablehnen“ und „Bekommen, was man möchte“.
Soziale Interaktion bezieht sich auf kommunikative Signale mit sozialer Funktion, z. B. auf sich aufmerksam zu machen oder jemanden zu begrüßen (Wetherby et al. 1988). Diese Beschreibung entspricht im Wesentlichen der Beteiligung an sozialer Interaktion bei Rowland (2011; 2015).
Gemeinsame Aufmerksamkeit beschreibt jene kommunikativen Handlungen, die die Aufmerksamkeit auf ein Gegenüber oder auf ein Objekt lenken. Hierzu gehört z. B., eine Person auf einen Gegenstand oder eine Handlung aufmerksam zu machen oder Informationen über einen Gegenstand einzuholen (Wetherby et al. 1988).
Intention und Wirkung
Die Sprechakttheorie Austins (1962) zeigt, dass kommunikative Intentionen und damit erzielte Wirkungen nicht automatisch deckungsgleich sind. Basierend auf seiner Theorie sowie auf Basis des vorgestellten Kommunikationsentwicklungsmodells sind vielmehr verschiedene Szenarien denkbar.
Szenario 1: Die Intention des Senders oder der Senderin und die bei dem / der EmpfängerIn ausgelöste Wirkung sind deckungsgleich (Abb. 3). Dies entspricht einer kommunikativen Handlung ohne Missverständnisse.
Abb. 3: Szenario 1 – Übereinstimmung von Intention und Wirkung
Szenario 2: Die Person auf der Linken verfolgt mit ihrem Verhalten keine kommunikative Intention. Beim Gegenüber wird aber dennoch eine Wirkung ausgelöst (Abb. 4). Für die Kommunikationsentwicklung spielt dieses Szenario eine wichtige Rolle, um den Zusammenhang zwischen eigenen Handlungen und der Reaktion der Umwelt erlernen zu können.
Abb. 4: Szenario 2 – Keine kommunikative Intention
Szenario 3: Der / die SenderIn verfolgt eine Intention, aber der / die EmpfängerIn reagiert darauf nicht (Abb. 5).
Abb. 5: Szenario 3 – Keine kommunikative Wirkung
Szenario 4: Die bei dem / der EmpfängerIn ausgelöste Wirkung entspricht nicht der Intention des Senders oder der Senderin (Abb. 6).
Abb. 6: Szenario 4 – Unerwartete kommunikative Wirkung
Der / die SenderIn hat in den Szenarien 3 und 4 unterschiedliche Möglichkeiten, zu reagieren. Dazu gehört z. B. das erneute Aussenden der Nachricht oder eine qualitative Veränderung des Signals (z. B. lauter sprechen), bis die Intention verwirklicht ist. Auch ein Wechsel des kommunikativen Signals ist möglich. Anstatt der Nutzung von Lautsprache könnte z. B. eine (zusätzliche) Gebärde genutzt werden, um verstanden zu werden. Auch könnte z. B. damit begonnen werden, durch einen hin und her wandernden triangulären Blick den / die NachrichtenempfängerIn auf das Wunschobjekt hinzuweisen (Wetherby / Prizant 1989). Die Nutzung einer dieser genannten Möglichkeiten kann gleichzeitig auch als Signal gedeutet werden, dass der / die SenderIn intentional kommuniziert (Kap. 4.2).
Was es für Menschen bedeuten kann, wenn es (fortlaufend) zu kommunikativen Missverständnissen (Abb. 5; Abb. 6) kommt, wird wiederum mit den theoretischen Überlegungen Bodenheimers (1967) klar. Er geht davon aus, dass jeder Mensch, um sich als wirksames Individuum zu erfahren, darauf angewiesen ist, dass Mitmenschen seine Ausrufe – seien sie verbaler oder nonverbaler, vokaler oder nonvokaler Art – auch als sinnhafte Anrufe wahrnehmen und mittels einer Antwort reagieren. Dabei muss die Antwort zum initialen Ausruf passen, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Person keinen Bezug zwischen ihrem Ausruf und dem Handeln des Gegenübers herstellen kann und somit eine Verblüffungserfahrung macht. Diese kann Angst auslösen, zum Scheitern der Kommunikationssituation führen und bei fortwährenden Negativerfahrungen zur Entstehung von Beziehungsstörungen und erlernter Hilflosigkeit beitragen. Bodenheimer (1967) erläutert dies mit der Metapher des Echos. So sei es wichtig, dass eine Person auf einen Ausruf eine Antwort erhält, die einen Zusammenhang mit ihrem initialen Ausruf hat, diesen dabei aber auch nicht einfach wiederholt, sondern vielmehr modifiziert und so eine Abgrenzungs- und Selbstwirksamkeitserfahrung ermöglicht. Gelungene Kommunikation fußt also immer auf gegenseitigem Verstehen und Selbstwirksamkeitserfahrungen.
Forschungsschlaglicht 2 – Bedeutung der Gegenseitigkeit in der Interaktion
Das von Tronick et al. (1978) durchgeführte sog. Still Face Experiment zeigt besonders eindrücklich, welche Auswirkungen ausbleibende Reaktionen in kommunikativen Interaktionen haben. Im Experiment wurden Babys und Mütter bei ihrer Interaktion gefilmt. Zunächst erfolgte eine dreiminütige Phase, in der die Mütter normal auf die Signale der Babys reagierten und so eine gegenseitige Interaktion entstand. In einer nächsten Phase (ebenfalls drei Minuten) wurden die Mütter gebeten, kein responsives Verhalten im Bereich der verbalen oder nonverbalen Kommunikation mehr zu zeigen und ausdruckslos zu bleiben (Still-Face-Bedingung). Bereits in der kurzen Zeit von drei Minuten konnte beobachtet werden, dass die Babys in der Still-Face-Bedingung immer weniger Interaktionsversuche starteten und sich schließlich komplett zurückzogen, indem sie Körper und Gesicht von der Mutter wegdrehten.