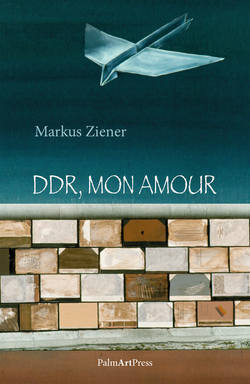Читать книгу DDR, mon amour - Markus Ziener - Страница 5
IN DER RHÖN, OKTOBER 1981
ОглавлениеDas Visum, auf das ich wartete, kam nicht. Ich wusste zwar, dass es keinen Sinn machte, allzu viel über die Gründe für die Verzögerung nachzudenken. Mal kam ein DDR-Visum schnell, mal brauchte es Ewigkeiten. Wirklich ergründen oder gar beeinflussen konnte man den Gang der Dinge nicht. Dennoch hätte ich schon gerne gewusst, ob und wann mir denn nun die DDR die Einreise erlauben würde.
Diese Gedanken beschäftigten mich, als ich an einem herbstlich-klaren Montagvormittag wieder einmal von meiner Wohnung die 72 Stufen nach unten stieg, um in meinem Briefkasten nachzusehen, ob sich darin ein Hinweis auf die Visumssache finden würde. Ich wohnte in Würzburg, in einer kleinen Mansardenwohnung. Wenn ich aus einem der beiden schmalen Fenster blickte, vor denen mein Schreibtisch stand, dann konnte ich ein Stückchen von der Festung Marienberg sehen. Und von den Weinbergen, die sich unterhalb der Festung an den Berg schmiegten. Würzburg war ein Idyll, eine heile, unterfränkische Welt, in der die Menschen nichts aus der Ruhe brachte. Die meisten Bewohner Würzburgs schienen diesen Rhythmus gut zu finden. Ich hingegen hatte mit dem so gemächlichen Tempo in dieser Stadt zunehmend meine Mühe. Während die Welt sich drehte, blieb in Würzburg die Zeit stehen. So kam es mir zumindest vor. Dieses Unwohlsein hatte sich seit meiner Moskau-Reise vor einigen Monaten noch verstärkt.
Als ich also an diesem Montag im Oktober 1981 erneut mit leeren Händen vom Besuch meines Briefkastens die Stufen nach oben nahm, fasste ich einen Entschluss. Wenn ich schon nicht erfuhr, ob ich jetzt in die DDR reisen würde, dann könnte ich mich der DDR doch wenigstens nähern. Noch waren Semesterferien und ich hatte Zeit für einen kleinen Ausflug. Ich packte ein paar Sachen zusammen, holte meine BMW aus der Tiefgarage der Uni, und am nächsten Morgen ging es los. Ich drückte auf den Anlasser, der Zweizylinder-Boxermotor sprang an, die Sitzbank vibrierte und ich bekam Gänsehaut.
Mein Ziel war die Rhön. Zwischen Mellrichstadt in Bayern und Rasdorf in Hessen hatte man den besten Blick auf den Grenzstreifen, der Deutschland teilte. Am Vorabend hatte ich noch ausgiebig die Karte studiert und dann unter das Zellophan meines Tankrucksacks gesteckt. Ich wollte auf kleinen Nebenstraßen fahren und die Fahrt genießen. Die Rhön war für mich stets etwas Besonderes. Sie war ein eigenartiges Stück dieses eigenartigen Staates Bundesrepublik Deutschland. Fast wie vergessen lag die Rhön, fast wie aufgegeben. Ein Stück Land, in dem nur noch jene wohnten, die nicht weg wollten oder weg konnten. Für mich war die Rhön Zwischendeutschland. Nicht ganz Westen, weil als Zonenrandgebiet abgeschnitten vom Fortschritt. Aber mit einem kräftigen Hauch Osten, der dann und wann hinüberwehte von den thüringischen Höhen zu den sanften Kuppen der Rhön. Und mittendrin in dieser grandiosen Schönheit war die Brutalität der Grenze zu besichtigen. In Fladungen hielt ich an einem Gasthof, der „Zum Goldener Adler” hieß, und fragte nach einem Zimmer. Die Grenze war hier kaum mehr als zwei Kilometer entfernt. Der Wirt begrüßte mich freundlich, und war auch dann noch freundlich, als er erfuhr, dass ich nur eine Nacht bleiben würde. Ein Motorradfahrer für eine Nacht war für einen Gastwirt nicht das beste Geschäft. Motorradfahrer brachten zumeist Unordnung, Schmutz und wenig Umsatz. Aber hier in Fladungen, dazu noch im Herbst, war nicht viel los, eigentlich war gar nichts los. Und ein Übernachtungsgast war immer noch besser als kein Übernachtungsgast. Selbst wenn es ein Motorradfahrer war.
Als der Wirt mir den Zimmerschlüssel gab, fragte ich ihn bewusst beiläufig nach dem Leben an der Grenze.
Aus Erfahrung wusste ich, dass Grenzbewohner oft etwas gereizt reagieren konnten, wenn es um dieses Thema ging. Sie wollten ihre Region nicht alleine auf diesen doch eher unerfreulichen Umstand reduziert wissen - und zählten dann die Sehenswürdigkeiten der Umgebung auf. Das war zwar nachvollziehbar, denn wer will schon in einem zerschnittenen und vergessenen Winkel leben? Doch mich interessierten weder die Wasserkuppe noch das Schwarze Moor. Mich interessierte die Grenze.
Der Wirt des „Goldenen Adler” aber war entspannt. Während ich noch den Meldezettel ausfüllte, erzählte er davon, dass er „drüben” Verwandte habe. Einen Onkel und eine Tante, die er das letzte Mal vor vielen Jahren gesehen hatte. Anfang der 70er Jahre war zwischen den beiden deutschen Staaten der kleine Grenzverkehr vereinbart worden. Für Bewohner entlang der Grenze war es damit einfacher geworden, sich zu besuchen. „Das war für uns ein echter Fortschritt”, sagte der Wirt. „Wir waren auch ein paar Mal drüben, morgens hin, abends zurück.” Doch dann seien die Verwandten, die in der Nähe von Suhl und damit gerade mal 50 Kilometer Luftlinie entfernt gewohnt hatten, nach Dresden umgezogen. „Jetzt brauchten wir wieder ein reguläres Visum für die DDR. Und das war mir einfach zu umständlich.“ Der Wirt machte eine Pause. Er schien sich nicht sicher, ob er weiterreden sollte. Dann sagte er: „Und überhaupt.” Ich blickte ihn fragend an. „Weil …”, sagte ich und dehnte dabei das Wort so gut es ging. „Weil”, nahm der Wirt den Faden auf, „sich Ost und West ziemlich verändert haben. Jeder lebt in seiner Welt. Wir haben uns nicht mehr so viel zu sagen.” Die Offenheit des Wirts überraschte mich, und ich war gespannt, ob er noch weitererzählen würde. Doch es schien, als habe der Wirt nun beschlossen, genug gesagt zu haben. „Ihr Zimmer ist im ersten Stock gleich rechts”, sagte er nur noch. Ich dankte und nahm den Schlüssel, an dem ein schwerer, eiserner Anhänger baumelte, in den in schwarzer Farbe meine Zimmernummer eingeprägt war.
Es war noch früh am Nachmittag und es würde noch einige Stunden dauern, bis es dunkel wurde. Ich wollte mir den Ort ansehen und machte mich bald auf den Weg. Beim Herausgehen fragte ich den Wirt, der wieder an der Rezeption stand, wo man denn im Ort gut essen könne und ich merkte sofort, wie ihn meine Frage enttäuschte. „Wollen Sie nicht hier bei uns essen?“, fragte er mich, und als ich nicht gleich antwortete, sagte er noch: „Wir haben heute Jägerschnitzel mit Pilzen. Sie können aber auch unsere Rhönforelle probieren.“ Etwas verlegen sagte ich, dass ich es mir überlegen würde. Dann ging ich, ohne noch eine Empfehlung des Wirtes abzuwarten, die abzugeben ihm unangenehm sein würde.
Der Ort, obwohl noch zu Franken gehörend, wirkte auf mich durch das viele Fachwerk, die schmalen Bürgersteige und die hohen Tore vor den Häusern wie ein hessisches Dorf. Ich stellte mir vor, wie die Einwohner samstags ihre Autos wuschen, vor ihren Haustüren den Bürgersteig kehrten, das Kiesbett in ihren Vorgärten richteten, dabei im Radio die Bundesligaübertragung hörten und pünktlich um 18 Uhr und fünf Minuten ihre Fernseher einschalteten, um im ersten Programm die Sportschau zu sehen. Ich musste dabei an Würzburg denken, das nun, zumindest im Vergleich zu Fladungen, wie eine pulsierende Metropole wirkte.
Ich ging an ein paar Läden vorbei, deren Auslagen mich nicht interessierten, auch an einem Gasthaus, das „Zum goldenen Ross“ hieß, das aber wenig einladend aussah. Durch die Scheiben sah ich dort schon jetzt Leute vor Bier- und Weingläsern sitzen, ein bisschen früh, dachte ich mir, und überlegte, ob ich nicht doch besser dort essen sollte, wo ich auch über Nacht blieb.
Zudem: Es würde dem Wirt gefallen.
Auf der Teerstraße ging ich weiter Richtung Nordosten, verließ den Ort und erreichte Oberfladungen.
Von der Eisenacher Straße, auf der ich mich nun befand, bog ich nach ein paar hundert Metern Richtung Osten ab. Am ehemaligen Rittergut Huflar vorbei kam ich auf einen alten Viehtriebweg, der mich schließlich zu jener Stelle führte, zu der ich hinwollte, dem „Heimatblick“.
Von dort, der Oberfladunger Hut, öffnete sich der Blick aufs Land. Ich sah das Streutal vor mir liegen und konnte weit hineinschauen in das Grenzgebiet zur DDR. Wo einst Bäume gestanden hatten, zerschnitt nun eine breite gerodete Schneise für die Grenzbefestigungen die Landschaft. An anderen Stellen folgte die Grenze auch immer mal wieder kleinen Flussläufen.
Ich stand auf der Anhöhe - und schaute. Unbeweglich verharrte ich dort, viele Minuten lang. Zunächst versuchte ich das Bild als Ganzes zu erfassen, das beherrscht war von der Gewalt, die hier der Natur angetan worden war. Dann zerlegte ich das Panorama vor mir in kleine Parzellen, ließ meinen Blick ganz langsam von West nach Ost wandern. Ich konzentrierte mich jetzt auf die Details, auf die viereckigen Wachtürme aus Beton, auf die Ortschaft Melpers, die gut zu erkennen war, und die direkt im Sperrgebiet auf DDR-Seite lag. Ich versuchte Bewegungen entlang des Grenzzaunes auszumachen, etwa, ob auf dem Kolonnenweg ein Auto zu sehen war. Dann betrachtete ich noch einmal die Grenzanlagen, um die einzelnen Befestigungsabschnitte zu bestimmen. Die Sperrzone, die fünf Kilometer weit ins Land reichte, den 500 Meter breiten, mit Stacheldraht gesicherten Schutzstreifen, den Fahrzeug-Sperrgraben und schließ-lich den Grenzzaun aus verzinktem Streckmetall, drei Meter hoch und an Betonsäulen befestigt.
Der Aufbau der Grenzanlagen war kein Geheimnis. Die Westmedien berichteten regelmäßig darüber. Entweder, weil der Jahrestag des Berliner Mauerbaus, der 13. August 1961, dazu Anlass bot. Oder aber, weil es wieder mal einen Fluchtversuch gegeben hatte, der in den Zeitungen akribisch nachgezeichnet und analysiert wurde.
Lange stand ich dort auf dem „Heimatblick” und schaute nach Osten. Kalt war es mir inzwischen geworden. War das die Kühle des Herbsttages oder ließ mich der Anblick der Grenze frösteln? Ich zog den Reißverschluss meiner Windjacke etwas höher, aber gehen wollte ich noch nicht. Noch ein paar Minuten wollte ich nun, nachdem ich das Terrain mit den Augen abgesucht hatte, meinen Gedanken nachhängen.
Die Vorstellung, dass nur ein paar hundert Meter von hier das Leben so ganz anders war, dass es eigentlich völlig, komplett, zu hundert Prozent anders war, faszinierte mich. Das hier war nicht Kehl am Rhein, wo man über die Europabrücke hinüber nach Straßburg, nach Frankreich schaute und wo die Grenze inzwischen nur noch eine Touristenattraktion war. Wo es egal war, ob man mit Mark oder Franc bezahlte, ob man Deutsch oder Französisch sprach oder ob man einen Badischen oder einen Elsässer Wein trank. Das Leben war, wenn nicht gleich, dann doch ziemlich ähnlich. Hier jedoch war der Rahmen so grundstürzend anders und damit selbst die einfachste Handlung, mochte sie jener im Westen auch noch so sehr ähneln, nie gleich. Warum? Weil sie in einem anderen Kontext geschah, in einem anderen System, mit anderen Konsequenzen. Die Faszination dieses Gedankens verdrängte jetzt auch das Gefühl über das große Unrecht, das diese Grenze darstellte, weil sie doch ein Volk teilte, Familien zerschnitt, Freundschaften und Lieben. Ich stand auf dieser Seite des Zauns und könnte doch genauso gut auf der anderen Seite stehen, etwa, wenn unsere Familie zum Kriegsende aus dem Osten nicht nach Bayern, sondern eben nur nach Thüringen geflüchtet wäre. Vielleicht würde ich dann an einem Ort leben, der nicht weit entfernt war von jenem, an dem ich mich gerade befand. Ich wäre ein Bürger der DDR, und vielleicht würde ich dann auch gelegentlich an die Grenze fahren und hinüberschauen in den Westen. Gleichzeitig wusste ich, dass ich so weit nie kommen würde. Denn wer das Sperrgebiet betreten wollte, der brauchte dazu eine Erlaubnis - und dafür wiederum einen guten Grund. Aber vielleicht - würde ich drüben leben - würde ich davon träumen. Des Nachts von drüben träumen. Oder wachliegen und an drüben denken, es mir vorstellen, aus den Bruchstücken, die ich wusste und die ich im West-Fernsehen gesehen hatte. „Mein drüben wäre dann das hier”, flüsterte ich leise und bewegte dazu kaum merklich die Lippen. Aber: Was war dann eigentlich drüben?
Ich löste mich aus meiner Starre, mir war nun richtig kalt geworden, ich schlug mir auf die Oberarme, um den Kreislauf in Schwung zu bringen und ging noch einige Meter abseits des Feldweges durch eine Wiese, kehrte aber bald wieder um. Das Gelände war jetzt unwegsam und feucht und die leichten Schuhe, die ich trug, wollte ich nicht nass werden lassen. Die Dämmerung hatte eingesetzt und das milde Abendlicht schliff nun sogar ein wenig die vorher scharfen Konturen der Grenzbefestigungen ab. Es war ein schönes Licht, ein sanftes, ich spürte, wie die Stimmung wechselte und nun auch meine Gedanken weiter hinübertrugen, in den Osten.
Ich erinnerte mich daran, wie ich im Jahr zuvor mit Frieder an der Saale spazieren gegangen war. Frieder hatte kurzerhand meinen Arm genommen und ihn an seinem untergehakt, ich wollte das zunächst gar nicht, weil ich es seltsam fand, wenn zwei Männer so unterwegs waren, aber Frieder tat es so selbstverständlich, dass ich es geschehen ließ und mich nach einiger Zeit mit der Männernähe sogar sehr wohl fühlte. Die Saale strömte uns entgegen, während wir von Naumburg nach Bad Kösen gingen, zumeist über Wiesen, auf denen hoch das Gras stand und in Sichtweite der Weinberge von Saale und Unstrut. Munter unterhielten wir uns, die Landschaft regte uns an und schuf Vertrautheit. Mein Besuch beflügelte Frieder zur einer Fülle launiger Kommentare über die DDR, jede Bemerkung von ihm mutiger als die vorherige, provozierender, sarkastischer. Als wir eine Gruppe von Rotarmisten sahen, die sich nur wenige Meter von uns entfernt um eine Art Jeep versammelt hatte, hob er demonstrativ die Stimme und spekulierte darüber, wie viel Altöl die Burschen da nun wieder vergraben hätten. Er tat dies so laut, dass ich ihn anstieß und dazu mahnte, leiser zu sprechen, es könnte gefährlich sein. Doch Frieder kümmerten meine Warnungen nicht, dies sei doch schließlich sein Land, sagte er, und war dabei immer noch laut, denn er sei doch Bürger dieser DDR. Frieder wollte mir zeigen, dass er nicht zu denen gehörte, die alles mit sich machen ließen, die jede Erniedrigung und jede Schikane stoisch ertrugen, sondern dass er sehr wohl seinen Mund aufmachte, wenn ihm etwas nicht passte.
Dies wiederholte sich, als wir abseits des Wegs eine HO-Gaststätte ansteuerten, uns dort an einen Tisch setzten, aber von der Bedienung ignoriert wurden. Ohne dass Frieder ein Wort sagen musste, spürte ich, wie ihn diese Tatsache erregte, so sehr, dass er schließlich durch das Lokal die Kellnerin rief, dass es alle hören konnten: „Hallo, wir sitzen hier bereits seit einer Viertelstunde, wollen Sie denn nicht mich und meinen Gast aus der BRD bedienen? Gibt es kein Essen für den Besucher aus Bayern?” In der Gaststätte wurde es auf einmal totenstill, niemand sprach mehr und keiner klapperte mit dem Besteck, ich versank dabei fast in den Boden, bewunderte aber auch Frieders Mut, und tatsächlich kam dann auch die Bedienung, wenngleich unwillig, aber immerhin nahm sie unsere Bestellung auf, ohne auch nur mit einem Wort auf Frieders Bemerkungen einzugehen. Ebenso wortlos stellte sie uns dann das Essen auf den Tisch, sogar eine Flasche Weißwein aus der Region, von Saale und Unstrut. Als die Flasche auf dem Tisch stand sah ich, wie Frieders Augen glänzten, und er sich dann zu mir herüberbeugte und leise sagte, so etwas habe er noch nie erlebt, dass er eine Flasche des hiesigen Weißweins bestellen konnte, und dass er die dann auch bekommen habe, das sei heute das erste Mal. Ich grinste ihn an, dann prosteten wir uns zu und tranken die Flasche bis zur Neige aus. „Ist doch gar nicht so schlecht bei uns“, sagte Frieder beschwingt, als wir die HO-Gaststätte verlassen hatten, und dabei zwinkerte er mich an. Für einen Moment wusste ich nicht, ob ich diese Bemerkung nun ernst nehmen sollte oder ob eigentlich das genaue Gegenteil gemeint war.