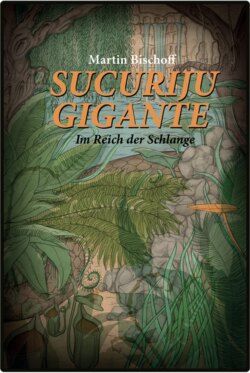Читать книгу Sucuriju Gigante - Martin Bischoff - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеProlog
Mato Grosso, August 1925
Er warf den Kopf unruhig von einer Seite auf die andere. An seinem inneren Auge flimmerten die Bilder ihrer Expedition vorüber. Dead Horse Camp, der Dschungel, der Fluss, das fürchterliche Gewächs, Farne, überall Farne, Feuer, ein See, riesige Kristalle, die Höhle.
Und dann das Mädchen. Hoch oben auf der Empore. Und ihr Blick. Abgrundtiefer Hass stand in ihren eiskalten Augen. In seinem Kopf wurden ihre Augen immer größer. Sie bewegten, nein, flogen auf ihn zu. Jetzt konnte er in diesen Augen lodernde Flammen erkennen. Ein Feuer, das ihn gleich erreichen und bei lebendigem Leib verbrennen würde. Jetzt! Jetzt waren sie da.
Mit einem Stöhnen riss er die Augen auf und sog gierig die dumpfe Luft in seine Lungen. Einmal, zweimal musste er tief durchatmen, um die Bilder des Traums zu verjagen. Er schmeckte Blut in seinem Mund. Schweiß rann von seiner Stirn.
Aber wo war er? Absolute Finsternis umgab ihn. Nichts als Dunkelheit. Er starrte fieberhaft in die Schwärze. Sein Adamsapfel hüpfte nervös auf und ab.
Und dann kam die Erinnerung.
Wie ein Orkan brach sie über ihn herein und durchflutete sein Gehirn mit brachialer Gewalt.
Nur mit Mühe konnte er einen Schrei unterdrücken.
Und dann der Schmerz.
Der Schmerz überwältigte ihn, noch bevor er über sich, aber ganz in der Nähe, ein bösartiges Zischen vernahm. Ein weiterer stummer Schrei blieb ihm in der Kehle stecken.
Manaus, November 2012
Seit anderthalb Jahren lebte Dr. Andrea Braun nun schon in Manaus, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amazonien.
Andrea war Historikerin und hatte sich auf die Geschichte Südamerikas spezialisiert. Mithilfe des Goethe-Instituts hatte sie einen Lehrauftrag an der hiesigen Universität erhalten. Es war der 14. November 2012 und wie jeden Mittwochvormittag schlenderte sie durch die riesige Markthalle von Manaus direkt am Hafen. Das imposante Gebäude war den Pariser »Les Halles« nachempfunden und tatsächlich hatte Gustave Eiffel die Baupläne für das Eisengerüst der Halle beigesteuert. Heute nahm Andrea die architektonischen Finessen ihrer Umgebung jedoch nicht richtig wahr. Ihre Gedanken waren ganz woanders.
Die schillernde Metropole am Rio Negro war für Andrea der ideale Ort für einen Neuanfang gewesen. Zwar hatte sie eine ganze Weile gebraucht, um sich an die drückende Schwüle zu gewöhnen, die wie in einer riesigen Käseglocke über der Stadt lastete, aber inzwischen ging es. Vor allem im Hafen, wo eine leichte Brise vom Rio Negro her für etwas Abkühlung sorgte. Sie war jetzt fünfundvierzig Jahre alt und seit gut einem Jahr geschieden. Sie hatte ihren Mann, sein Getue und – das musste sie sich zähneknirschend eingestehen – seinen Erfolg nicht mehr ertragen. Da sie sich wegen ihrer akademischen Karriere bewusst gegen Kinder entschieden hatten, war die Scheidung eine reine Formsache gewesen.
Kennengelernt hatten sie sich während ihrer Zeit als Doktoranden. Genau wie sie hatte er an der historischen Fakultät der Ruhr-Universität-Bochum promoviert. Nach Erlangung des Doktortitels waren ihre akademischen Laufbahnen dann immer weiter auseinandergedriftet.
Zwar schrieb Andrea Veröffentlichung um Veröffentlichung, aber bei der Vergabe der raren Professuren wurde sie geflissentlich übergangen. Ganz anders verhielt es sich bei ihrem Mann. Schon seine erste Bewerbung auf einen Lehrstuhl war von Erfolg gekrönt. Aus der Juniorprofessur wurde wenig später eine vollwertige Professorenstelle. Und nur vier Jahre später wurde er zum Dekan der Fakultät ernannt. Die ganze Zeit über fristete Andrea ihr Dasein als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Privat war aus Liebe längst Routine geworden und dann kam ihr dreiundvierzigster Geburtstag. Andrea saß allein in ihrer Villa in Bochum-Stiepel, trank ein Glas Wein und schaute in ihren Garten hinaus. Ihr Mann war auf einer Historikertagung in London und hatte ihr lediglich per SMS gratuliert. So viel zum Thema Liebe, war ihr bitterer Gedanke gewesen. An jenem Tag waren ihr zwei Dinge klar geworden: Zum einen, dass sie in ihrer Ehe nur noch eine unliebsame Funktion erfüllte. Die Funktion des schmückenden Beiwerks eines erfolgreichen Geschichtsprofessors. Und zum anderen, dass sie in Deutschland nie eine Professur erhalten würde. Sie wusste nur zu gut, dass sie mit Mitte vierzig in Deutschland die eherne Altersgrenze für eine Erstberufung an einen Lehrstuhl schon fast überschritten hatte. Nein, ihre wissenschaftliche Karriere war beendet, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Schluss, aus, Feierabend. Gehen Sie nicht über Los, kassieren sie keine zweihundert Euro, dachte sie desillusioniert, nachdem sie endlich aufgehört hatte zu heulen und leicht beschwipst im Bett lag.
Knapp zwei Wochen später hatte sie die Ausschreibung des Goethe-Instituts über die Stelle in Manaus gelesen. Noch am selben Abend teilte sie ihrem Mann mit, dass sie die Scheidung wolle und er sich ihren weitgehenden Verzicht auf ehelichen Zugewinn erkaufen könne, indem er ihr die Stelle besorgte.
Dass er auf diese Eröffnung richtiggehend erleichtert reagierte, hatte Andrea innerlich zum Kochen gebracht. In seiner widerlich gönnerhaften Art hatte er ihr dann mitgeteilt, dass er mit den »Kollegen« im Goethe-Institut mal sprechen würde. Ein Telefonat später wurde ihr die Stelle angeboten. Sie hasste ihn dafür. Aber natürlich nahm sie an.
Über all dies dachte Andrea nach, als sie die Markthalle verließ und sich ihr ein freier Blick auf das eigentliche Zentrum von Manaus eröffnete, auf den Hafen.
Andrea hielt kurz inne und atmete tief durch. Ja, das war Manaus. Dieser eigentümliche Geruch, der vom Hafen herüberschwappte, fast greifbar intensiv und doch so schwer zu beschreiben. Sie roch Obst, Fisch, Diesel und Motorenöl, den Regenwald mit seiner üppigen Vegetation. Für sie war dieses Konglomerat der Geruch von Abenteuer.
Langsam schlenderte sie vor sich hin summend weiter. Ihre trüben Gedanken waren, zumindest vorläufig, verflogen. Sie liebte das bunte, geschäftige Treiben, das sich vor ihr auftat.
Die Stadt verdankte ihren Aufschwung dem Kautschukboom zwischen 1870 und 1910. Und auch wenn Kautschuk heute natürlich keine große Rolle mehr spielte, war der Haften nach wie vor einer der wichtigsten Umschlagplätze für Waren aus Brasilien. Zudem war er der Ausgangspunkt für die meisten touristischen Touren ins Amazonasbecken. Ein Grund hierfür war sicherlich, dass der Rio Negro nur elf Kilometer unterhalb der Stadt im großen Strom des Amazonas mündete. Und natürlich war der Hafen auch der Startpunkt fast aller größeren Expeditionen entlang des Amazonas und seiner schier unendlichen Regenwälder.
Heute zog es Andrea nicht in die edlen Läden und Boutiquen der Zona Sol. Nach Shoppen war ihr beileibe nicht zumute. Sie wollte, oder besser gesagt, sie musste sich ablenken, auf andere Gedanken kommen. Und das ging am besten in den verwinkelten Nebenstraßen von Manaus, wo die Einheimischen in kleinen Läden und an den allgegenwärtigen Straßenständen einen ganz eigenen Kosmos an Waren feilboten.
Wobei der Begriff »Einheimische« für die Bewohner von Manaus irgendwie nicht zutraf. Auch wenn der rasante Aufstieg der Stadt erst Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Kautschuk kam, war sie bereits 1669 gegründet worden und von jeher ein Schmelztiegel für die unterschiedlichsten ethnischen Gruppen gewesen. Der eigentümliche Reiz Manaus‘ hatte sie über die Jahrhunderte hinweg magisch angezogen: Europäische Eroberer, gefolgt von Wissenschaftlern und Forschern, gefolgt von Abenteurern und Goldsuchern, gefolgt von Kaufleuten. Nachfahren der Inkas, ehemalige Sklaven, Einwanderer aus der Karibik, noch mehr Forscher, Kautschukbarone, Kaffee-, Kakao-, Bananen- und Ölexperten, sie alle waren in Manaus heimisch geworden. Und irgendwann natürlich auch die Kriminellen und Ausgestoßenen der europäischen und amerikanischen Gesellschaft. Sie alle suchten und suchen in Manaus ihr Glück.
Und in der Tat sah Andrea sich auch als eine dieser Ausgestoßenen – verraten und ausgestoßen vom deutschen Wissenschaftssystem, betrogen um die ihr zustehende wissenschaftliche Reputation. Dass ihre Stelle mit weit mehr Vergünstigungen ausgestattet war, als jede normale Professur in Deutschland, ließ sie dabei nicht gelten.
Natürlich gehörte Andrea ethnisch betrachtet zur Gruppe der Weißen, die gut ein Drittel der 1,8 Millionen Einwohner der Stadt ausmachten. Die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe stellten die wahren Kinder des Schmelztiegels, die Caboclos, die Mischlinge, mit circa sechzig Prozent. Wenn man in Manaus von Einheimischen sprach, meinte man in erster Linie die Caboclos.
Andrea schob sich gerade an einer langen Reihe von Straßenständen vorbei, das sich überschlagende, laute Anpreisen und Gekobere der Händler ignorierend, als sie auf der anderen Straßenseite ein heruntergekommenes Schild entdeckte, welches auf einen Antiquitäten- und Kolonialwarenladen aufmerksam machen sollte. Eigentlich waren genau dies die Läden, in denen sie gerne stöberte. Nur dass dieser hier einen wirklich verwahrlosten Eindruck machte. Durch die verdreckten Scheiben konnte sie in der Auslage Macheten, Landkarten und altertümliche Feldstecher ausmachen. Expeditionsbedarf, erkannte sie. Allerdings sahen die Sachen aus, als hätten sie auch schon vor hundert Jahren in der Auslage gelegen.
Nach kurzem Zögern entschied Andrea, es trotzdem einmal zu probieren. Die Messingklinke knirschte hörbar, als Andrea sie herunterdrückte und den Laden betrat. Ein Schwall abgestandener Luft schlug ihr entgegen. Staubflocken begannen, durch die Luft zu tanzen, und trudelten langsam wieder zu Boden, als sie die Tür hinter sich schloss. In dem Laden stand die Luft. Typisch für Manaus, aber alles andere als angenehm. Der sich langsam drehende Deckenventilator war mehr Zierde, als dass er die nach kaltem Rauch und Schweiß stinkende Luft zur Zirkulation brachte.
»Boa tarde, moça«, begrüßte sie ein fetter Caboclo hinter dem Verkaufstresen. Das verschwitzte, schmuddelige Hemd des Kerls war Andrea ebenso wenig entgangen wie sein unverhohlen lüsterner Blick. Beides störte sie nicht weiter.
»Olá«, nickte sie in seine Richtung.
»Precisas de ajuda, moça?« Kam es vom Tresen. Dass er sie jetzt schon zum zweiten Mal »moça«, junge Frau, nannte, gehörte zu den Verkaufsritualen in solchen Geschäften, wie Andrea wusste. Heute war ihr nicht nach diesem Balztanz. Also machte sie ihm freundlich, aber bestimmt klar, dass sie ebenso wenig ein junges Mädchen wäre, wie er ein schlanker Jüngling und nein, er könne ihr nicht helfen, da sie sich erst mal umsehen wollte.
»Sim, Sim«, beeilte der Kerl sich, leicht unterwürfig zu beschwichtigen und fügte dann »tudo puro, tudo barato« hinzu, während er ausladend auf seine Waren deutete.
Natürlich, musste Andrea schmunzeln, alles echt, alles billig, ja, ja.
Als sie sich dem ersten der drei schmalen Gänge zuwandte, die sich durch die bis zur Decke vollgepackten Regale schlängelten, wusste sie, dass der Kerl ihr auf den Hintern stierte. Auch das störte sie heute ausnahmsweise nicht. Im Gegenteil.
Die Regale enthielten Gebrauchsgegenstände. Mehr oder weniger brauchbar. Mehr oder weniger echt. Mehr oder weniger preiswert. Alle dreckig und von einer Staubschicht bedeckt und alle für Andrea absolut uninteressant. An einer Fliegenfalle, die unter der Decke hing, klebten unzählige Moskitos. Ausverkauft, alle Plätze besetzt, ekelte sie sich.
Am Ende des Ganges entdeckte sie einen großen Spiegel. Die Goldlackierung des pseudo-barocken Rahmens war großflächig abgeblättert und Teile des Spiegels waren mit Rostflecken gesprenkelt oder bereits blind geworden. Dennoch konnte sie sich in dem Spiegel komplett betrachten.
Gar nicht so schlecht, moça, dachte sie.
Trotz ihrer fünfundvierzig Jahre hatte sie nach wie vor eine schlanke Figur mit den richtigen Kurven am Hintern. Der enganliegende Rock betonte zudem ihre Beine. Die Blicke des Kerls hinter dem Tresen waren für Andrea ein Indikator dafür, dass ihr Hintern immer noch knackig war. Gleiches galt für ihre Brüste: Fest wie vor zwanzig Jahren, nicht zu groß, aber auf gar keinen Fall klein, füllten sie ihre Bluse aus. Wenn sie in ihren Uni-Veranstaltungen die oberen beiden Knöpfe offen ließ, wurden ihrer männlichen Studenten in den ersten Reihen immer noch nervös.
Vielleicht, überlegte sie, hat mein Busen die Form behalten, weil noch nie ein Kind daran gestillt worden ist. Tja, alles hat seine Vor- und Nachteile, philosophierte sie. Dann betrachtete sie ihr Gesicht.
Ihre Lippen waren voll und sinnlich. Ein echter Kussmund hatte ihr Ex immer gesagt. Eines seiner wenigen ernstgemeinten Komplimente. Ihre Nase war aristokratisch gerade und eher schmal. Ihre braunen Mandelaugen ließen sie irgendwie verletzlich wirken und weckten bei den Männern den Beschützerinstinkt. Ein Umstand, den sie sich außerhalb ihrer akademischen Karriere immer zunutze gemacht hatte. Vielleicht war es aber gerade das, was den Beschützerinstinkt der Männer ansprach, was sie zugleich als zu schwach für eine Professur erscheinen ließ.
Tja, alles hat seine Vor- und Nachteile, fuhr sie mit ihrer Betrachtung fort.
Ihr dunkelblondes Haar – Gott sei Dank war noch kein einziges graues dabei – trug sie in einer modischen Kurzhaarfrisur, was ihre Augen und ihren vollen Mund zusätzlich zur Geltung brachte. Zum Glück. In Manaus hatte man als Frau, insbesondere als Weiße, frisurentechnisch wenige Optionen. Bei Temperaturen, die zu jeder Jahreszeit tagsüber auf über dreißig Grad klettern und nachts nie unter dreiundzwanzig Grad fielen, und einer Luftfeuchtigkeit zwischen achtzig und fünfundneunzig Prozent war man als Frau dazu verdammt, eine Kurzhaarfrisur oder einen Pferdeschwanz zu tragen. Wem das nicht stand, hatte Pech gehabt. Eine offene Langhaarfrisur endete unweigerlich in einer an Nacken, Hals und Wangen klebenden, verschwitzten Katastrophe.
Andreas kurzes Haar stand ihr perfekt. Und auch wenn sich um Augen und Mund einige Falten eingegraben hatten, ging sie locker für Mitte bis Ende dreißig durch. Für Mitte dreißig und sexy, richtig sexy, stellte sie befriedigt fest.
Nach diesem kleinen Höhenflug schob sich wieder die dunkle Wolke in ihre Gedanken, die sie schon den ganzen Tag über zu verdrängen suchte. Am Morgen hatte ihr Ex sie angerufen und ihr angetrunken verkündet, dass er wieder heiraten wolle. Seine Assistentin. Fünfundzwanzig Jahre alt.
Die Frage, ob sie sich denn gar nicht für ihn freuen würde, hatte den Vogel dabei abgeschossen.
Natürlich freue ich mich, dass du jetzt eine Fünfundzwanzigjährige vögelst, du widerlicher Bock, grollte es noch immer in ihr. Das Telefonat hatte sie wütend gemacht. Und noch mehr hatte sie die Erkenntnis aus der Fassung gebracht, dass das Telefonat sie wütend gemacht hatte. Ihr Ex war doch ein abgeschlossenes Kapitel! Was interessierten mich seine Sexeskapaden in Deutschland? Kein bisschen, aber auch nicht das Geringste, stellte sie für sich mit Nachdruck fest.
Dennoch hatte sie sich gerade im Spiegel fortwährend mit einer Fünfundzwanzigjährigen verglichen. Wobei ihr natürlich von vorneherein klar war, dass sie den Vergleich unmöglich bestehen konnte, egal, wie gut sie sich gehalten hatte. Sie schüttelte unmerklich den Kopf über sich selbst, atmete einmal tief durch und wischte den dünnen Schweißfilm, der sich in dem stickigen Laden sofort auf ihrer Stirn gebildet hatte, beiläufig mit dem Handrücken weg.
»Espelho bonito, comprar espelho«, wurde sie von dem Dicken aus ihrer Selbstbetrachtung und ihren trüben Gedanken gerissen.
»Não, obrigado«, schüttelte sie den Kopf und nahm ihren Streifzug durch den Laden wieder auf. Eine Viertelstunde später war Andrea alle Gänge entlanggebummelt und wollte den Laden gerade enttäuscht verlassen, als sie am unteren Ende eines Regals einen mit Wasserflecken übersäten alten Pappkarton erblickte. Was mag da wohl drin sein, fragte sie sich.
Kurz entschlossen zog sie den Karton vor und schlug die Pappdeckel zur Seite. Dokumente, Briefe, Zeichnungen füllten den Karton bis fast zum Rand. Alte Dokumente. Andrea wäre eine schlechte Historikerin, wenn nicht schlagartig ihr Interesse erwacht wäre. Sie nahm einen Schwung der losen Blätter heraus und betrachtete sie eingehend.
Zeitgenössisch sicherlich interessant, aber nichts von wirklicher Bedeutung, lautete schließlich ihr nüchternes Urteil. Sie hatte den Karton zu gut zwei Dritteln geleert und die Blätter ordentlich auf dem Boden gestapelt, als sie auf eine stark verdreckte und schon etwas verwitterte Kladde stieß. Vorsichtig hob sie das Büchlein aus dem Karton. Der verwaschenen Schrift auf dem Einband konnte sie lediglich entnehmen, dass es sich um ein Tagebuch handelte. Der Name des Autors war weitestgehend unter rostbraunen Flecken verschwunden. Ob es sich hierbei wohl um Blut handelt?, schoss es ihr kurz durch den Kopf. Aber natürlich konnten die Flecken auch von irgendeinem Pflanzensaft oder was auch immer stammen.
Vorsichtig schlug sie das Buch auf und überflog den ersten Eintrag, blätterte um und erstarrte. Ungläubig verharrten ihre Augen auf der Signatur des Eintrags. Der Text war auf den 20. April 1925 datiert. Das passte! Es passte sogar genau. Dann wanderten ihre Augen wieder zu der Unterschrift des Tagebucheintrags. Wieder und wieder las sie die Signatur. Atemlos, fassungslos.
Hastig blätterte sie weiter, den Blick immer auf Datum und Unterschrift gerichtet. Schließlich ließ sie das Tagebuch wie in Zeitlupe auf ihren Schoß sinken und schüttelte wie benommen den Kopf. Sie runzelte die Stirn. Das konnte doch nicht wahr sein. Was sie hier in den Händen hielt, war nicht mehr und nicht weniger als eine wissenschaftliche Sensation. Und, war ihr sofort klar geworden, das Katapult für meine wissenschaftliche Karriere.
Sie blätterte das Tagebuch nochmals durch. Ganz vorsichtig, fast ehrfürchtig. Diesmal fokussierte sie sich allein auf die Datumsangaben. Nur mühsam konnte sie einen Jubelschrei unterdrücken. Sie musste sich beruhigen. Nachdem sie das Buch vorsichtig geschlossen hatte, wühlte sie noch einen Moment ziellos in den anderen Papieren herum, die in dem Karton gelegen hatten. Nur nicht auffallen, hämmerte ein Gedanke in ihrem Kopf.
Um ihre Nervosität nicht zu zeigen, fragte Andrea den schmierigen Verkäufer über die Schulter, woher er den Karton habe.
Keine Ahnung, der Karton hätte schon dort gestanden, als sein verstorbener Vater den Laden noch geleitet habe, war seine lapidare Antwort.
Als Andrea – immer noch über die Schulter – nach dem Preis fragte, nannte er ihr eine astronomische Summe. Astronomisch hoch, wenn man davon ausging, dass in dem Karton wertlose Aufzeichnungen und Papiere waren. Eine lächerlich geringe Summe, wenn man wusste, welcher Schatz sich darin verbarg. Andrea zögerte einen Moment, um nicht durch eine zu schnelle Reaktion das Misstrauen des Kerls zu wecken, ehe sie zustimmte und bat, ihr den Karton an ihre Privatadresse zu liefern. Sie hatte kurz überlegt, ihre Universitätsadresse anzugeben, dies aber schnell verworfen, weil auch das seinen Argwohn hätte erregen können.
Eilfertig, in der Überzeugung, das Geschäft seines Lebens gemacht zu haben, stimmte der feiste Verkäufer zu. Andrea zahlte die vereinbarte Summe und verließ, verfolgt von den schleimigen Komplimenten des Kerls, den Laden so schnell sie konnte.
Draußen bahnte sie sich fast wie in Trance ihren Weg durch die Straßenstände. Die Motorengeräusche der vielen kleinen Motorräder und Vespas, die durch die engen Gassen kurvten, drangen wie durch Watte gedämpft an ihre Ohren. Endlich hatte sie die nächste Straßenecke erreicht. Ihr Herz schlug ihr immer noch bis zum Hals, als sie sich hinter der Ecke kurz, ihre Handtasche fest an sich pressend, an eine Hauswand lehnte.
Das Tagebuch hatte sie natürlich direkt mitgenommen und in ihrer Handtasche verstaut. Wahnsinn. Sie konnte ihr Glück noch gar nicht fassen.