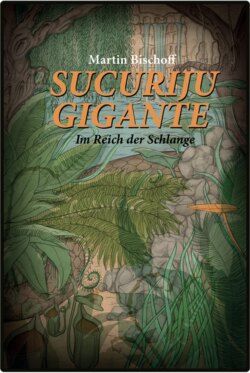Читать книгу Sucuriju Gigante - Martin Bischoff - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 2
Am nächsten Morgen wachte Lennard um kurz nach halb acht auf. Trotz des Umstands, dass er erst um zwei Uhr ins Bett gekommen war, fühlte er sich frisch und ausgeruht.
Wahrscheinlich lag das daran, dass ihn sein spezieller Traum in dieser Nacht verschont hatte. Er schlurfte zur Dusche und stellte das Wasser auf gut fünfunddreißig Grad ein. Dann legte der den Kopf in den Nacken und ließ seine Gedanken zurück zum vergangenen Abend schweifen, während das warme Wasser auf seinen Kopf prasselte.
Natürlich war die Runde sofort über Andrea und Prof. Schmidt hergefallen, um zu erfahren, was Jones mit seiner mysteriösen Aussage meinte. Prof. Schmidt lachte nervös auf und räusperte sich.
Er wirkte erleichtert, als Andrea das Wort ergriff: »Also, was Prof. Jones meint, ist, dass Fawcett zwar die Ruinen einer Stadt entdeckt hat, nur leider endet sein Tagebuch dort. Herauszufinden, ob es sich bei den Ruinen tatsächlich um Manoa handelt, liegt bei uns und ist natürlich eins der zentralen Ziele der Expedition.«
Sollte dies tatsächlich die profane Erklärung für Jones‘ rätselhafte Worte sein, fragte sich Lennard. Ein Blick in die Gesichter der anderen zeigte ihm, dass sie die Erklärung geschluckt hatten. Lennard selbst war nicht so leicht zu überzeugen. Klar, Andreas Worte waren einleuchtend, aber hätte Jones diese einfache Erklärung nicht auch selbst geben können? Vielleicht wollte Jones aber auch einfach nur die Autorität von Andrea und Prof. Schmidt herausstellen, mutmaßte Lennard, als ihn Andrea ansprach. »Na Lennard, sind deine Fragen nun beantwortet?«
»Teils, teils. Ich weiß, wo es hingeht, und ich weiß, warum so ein Geheimnis aus der Sache gemacht wurde. Aber das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs.«
»Wieso?«, fragte sie lächelnd und hakte sich bei ihm ein. Lennard war von der körperlichen Geste überrascht, ließ sie aber widerstandslos zu. Gemeinsam schlenderten sie in Richtung Hotelbar. Ein Hotelangestellter hatte die Tür mittlerweile geöffnet und erwartete die Expeditionsteilnehmer mit einem Tablett voll alkoholischer und nicht-alkoholischer Cocktails am Eingang der Bar.
»Nun, ob eine Expedition ihr Ziel erreicht oder nicht, hängt normalerweise nicht vom Ziel ab, sondern von der Ausrüstung, der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Teilnehmers, dem Funktionieren als Team und der gewählten Route. Ganz zu schweigen von der Begleitmannschaft.«
»Ich verstehe, aber ist das nicht alles unglaublich faszinierend?«
»Ja, unglaublich faszinierend und unglaublich gefährlich«, kommentierte Lennard ihre Bemerkung.
»Risiko und Chance sind immer die beiden Seiten einer Medaille, Lennard.«
»Tja, und manchmal sind die beiden Seiten unterschiedlich groß.«
Andrea rollte lächelnd die Augen. »Lennard, du Miesepeter, ich werde mir von dir nicht die Vorfreunde verderben lassen und außerdem wollen Prof. Schmidt und ich morgen Vormittag mit dir zur Rita, unserem Amazonas-Flussschiff, damit du die Ausrüstung überprüfen kannst. Wenn etwas fehlt, sagst du einfach Lucas, dem Kapitän, Bescheid. Er wird dann bis zu unserem Ablegen alles besorgen. Zufrieden?«
»Nö, aber durstig«, grinste Lennard und griff sich zwei Caipirinhas von dem angebotenen Tablett. Eins der Gläser hielt er fragend Andrea hin.
»Danke«, nahm sie das kühle Glas entgegen. »Auf eine erfolgreiche Fawcett-Expedition 2013«, prostete sie Lennard fast schon verschwörerisch lächelnd zu.
»Auf unseren Erfolg und eine glückliche Heimkehr«, stieß er sein Glas nun ebenfalls lächelnd leicht gegen das ihre. Beim ersten Schluck schauten sie sich in die Augen. Vielleicht eine Sekunde zu lang.
»Entschuldigen Sie, Mr Larson, aber ich muss Ihnen Dr. Braun mal kurz entführen«, gesellte sich Prof. Schmidt zu den beiden und beendete so ihren Blickkontakt.
»Aber bitte«, grinste Lennard den älteren Herrn freundlich an und schaute sich dann in der Hotelbar um, während Schmidt mit Andrea wieder im Konferenzraum verschwand. Die ganze Bar war im Kolonialstil eingerichtet.
An fünf kleinen runden Tischen, die scheinbar aus Mahagoni waren, standen jeweils drei Korbsessel. Am oberen Ende des Raums befand sich die eigentliche Bar mit dem Tresen. In den Regalen hinter dem Barkeeper konnte Lennard eine beeindruckende Zahl hochprozentiger Getränke ausmachen.
Der hölzerne Deckenventilator, der gemächlich seine Runden drehte, erinnerte Lennard irgendwie an Rick’s Café Americain in Casablanca. Die gegenüber liegende Frontseite der Bar wurde von großen Fenstern und zwei Flügeltüren dominiert, wie man sie in einem Western-Saloon erwarten würde. Die Türen führten auf eine überdachte Veranda, an die der Garten des Hotels angrenzte. Durch die Fenster konnte Lennard erkenne, dass unter dem Vordach kleinere Tische und Schaukelstühle standen, die zum Ausspannen einluden. Nicht schlecht, dachte Lennard und sah sich wieder im Inneren der Bar um.
Das Buffet war an der Wand zum Konferenzraum auf einer länglichen Anrichte aufgebaut worden. Auch nicht schlecht, stellte Lennard fest. Die Society war wirklich nicht knausrig gewesen. Neben Fleisch und Fisch in allen Varianten gab es einen eigenen Bereich für die unzähligen Früchte Amazoniens. Landestypische Gemüsegerichte und Salate rundeten die reichhaltige Palette an Speisen ab. In Anbetracht der Köstlichkeiten spürte Lennard, dass er tatsächlich einen Bärenhunger hatte. Er leerte seinen Cocktail und brachte das Glas zum Tresen. Dabei glitt sein Blick über die lange Wand gegenüber der Fensterfront. Historische Musketen, Macheten, Indianerschmuck und verzierte Masken hingen überall an der hellen Holzvertäfelung. Gestecke aus in allen Farben schillernden Papageienfedern und getrockneten Orchideen verliehen dem Arrangement einen lebendigen, bunten Touch. Ja, die Bar gefiel Lennard ausgesprochen gut. Also, dann wollen wir mal, beendete Lennard seine Betrachtung, nahm sich einen Teller und trat ans Buffet.
Sein Plan war einfach. Er wollte mit jedem der Teilnehmer ins Gespräch kommen und zwar nicht nur, um sie einfach kennenzulernen. Nein, oftmals konnte ein lockerer Plausch wichtige Hinweise über die Stärken und Schwächen eines Expeditionsteilnehmers offenbaren. Wer verfügte über welche Tropenerfahrungen? Wer war schon auf Expeditionen unterwegs gewesen? Wer beherrschte den Umgang mit einer Schusswaffe. Hatte jemand – außer der Ärztin – medizinische Grundkenntnisse und so weiter ging die Liste der Fragen, die Lennard interessierten.
Jetzt dachte Lennard, der gerade unter der Dusche die Wasserhähne zudrehte und sich ein großes Frotteehandtuch schnappte, dass der restliche Abend recht positiv verlaufen war.
Als Erstes hatte er sich zu Olaf Helbig und Martina Wenger gestellt, den beiden Assistenten von Prof. Schmidt. Um von vorneherein ein möglichst gutes, kameradschaftliches Verhältnis zu den beiden aufzubauen, hatte Lennard ihnen umgehend das Du angeboten. Ein Vorschlag, dem die beiden sofort begeistert zugestimmt hatten.
Helbig hatte strohblondes Haar und war mittelgroß. Mit seiner kräftigen Figur hätte er auch als Preisboxer durchgehen können.
Martina Wenger war sehr groß. Sie überragte Helbig bestimmt um einen halben Kopf. Da ihr rotes Haar scheinbar nur schwer zu bändigen war und in alle Himmelsrichtungen von ihrem Kopf abstand, wurde der Eindruck sogar noch verstärkt. Genau wie Helbig war sie Archäologin, allerdings mit einem weiteren Schwerpunkt auf Ethnologie und Kulturgeschichte. Zudem war sie mit siebenundzwanzig Jahren das Küken der Expedition.
»Ist dies eure erste größere Expedition?«, erkundigte sich Lennard.
»Für mich schon. Für Martina nicht wirklich«, antwortete Olaf und schaute sie lächelnd an.
Sie erwiderte das Lächeln und wandte sich dann an Lennard: »Ich habe während meines Studiums drei Jahre lang als Entwicklungshelferin in den ärmsten Ländern Afrikas gearbeitet. Wenn das als Erfahrung gilt, bin ich tatsächlich kein Frischling mehr.« In ihrem hübschen Gesicht hatte sich ein offenes Lächeln breitgemacht, herzlich aber auch ein bisschen nachdenklich.
»Ich denke schon, dass das als eine ganze Menge Erfahrung gilt.« Lennard nickte ihr anerkennend zu.
Olaf hatte Martina die ganze Zeit über angestrahlt. Man spürte sofort, dass die beiden mehr verband als ihr Arbeitsplatz und dass Martina, obwohl zwei Jahre jünger, die Reifere von beiden war. Lennard vermutete, dass es daran lag, dass sie bei ihren Auslandsaufhalten auch und vielleicht sogar gerade die schlechten Seiten der Welt gesehen hatte. Am meisten aber beeindruckte ihn die ruhige Art, mit der die junge Frau sprach. Trotz ihres Alters wirkte sie gelassen und selbstbewusst ohne jegliche Spur von Überheblichkeit.
Aber auch Olaf war Lennard auf Anhieb sympathisch. Der junge Mann sprühte förmlich vor Enthusiasmus. Lennard meinte sich daran erinnern zu können, im Dossier über Olaf gelesen zu haben, dass dessen Aufgabe während der Expedition auch darin bestehen würde, den Funkkontakt zur Außenwelt aufrechtzuerhalten. Als er ihn darauf ansprach, entpuppte sich Olaf als ein wahres Elektronik-Genie. Und beim Thema Funken war Olaf dann gar nicht mehr zu stoppen. Lennards Neugier erntete einen zehnminütigen Vortrag über die Möglichkeiten von Langwellensendern und deren Bedeutung trotz Internet. In der Tat nutzte einem das Internet in den Weiten des brasilianischen Regenwald nichts, aber auch gar nichts.
Da sich auch Martina – wahrscheinlich notgedrungen – mit dem Hobby ihres Freundes beschäftigt hatte, verfügte das Kernteam der Expedition über mindestens drei Teilnehmer, die sich mit Funkgeräten auskannten, wenn Lennard sich selbst mitrechnete. Beruhigend, sehr beruhigend sogar, notierte er in Gedanken und befand, dass die zwei sicher eine Bereicherung für das Team darstellten. Dass sich die beiden körperlich in einer ausgezeichneten Verfassung präsentierten, bestärkt seinen positiven Eindruck zusätzlich.
Schließlich hatte sich Lennard von den beiden verabschiedet und war, bewaffnet mit einem bunten Früchteteller, zu Dr. Edda Velmer geschlendert.
»Ist das ein Bestechungsversuch?«, begrüßte ihn die kleine Ärztin auf den Teller deutend und schelmisch lächelnd, während sie sich mit der Hand durch ihr langes Haar fuhr.
»Na klar. Ich weiß nur nicht wofür«, lächelte Lennard zurück und hielt ihr auffordernd den Teller hin. Die Ärztin entschied sich für eine Papaya-Ecke.
»Wie kommt es, dass wir Sie als Expeditionsärztin gewinnen konnten? Bei Ihrer Ausbildung hätte ich eher geschätzt, dass Sie an einer der großen Kliniken in Deutschland arbeiten würden, dem UKE in Hamburg zum Beispiel.«
»Nun, wenigstens machen Sie keine großen Umschweife«, antwortete sie und biss herzhaft in die Papaya. »Also«, erwiderte sie und schluckte den Rest der Frucht herunter, »neben meiner – unzweifelhaft vorhandenen – fachlichen Qualifikation«, ein breites Grinsen unterbrach ihre Antwort, »fühle ich mich noch zu jung für die starren Dienstpläne in einer großen Klinik. Und wahrscheinlich ist der Hauptgrund romantische Abenteuerlust. Mal ganz abgesehen von der extrem guten Bezahlung.« Lennard grinste, die Ehrlichkeit der untersetzen Ärztin hatte in nicht nur beeindruckt, sondern regelrecht entwaffnet.
»Tja«, entgegnete er, »damit sind dann ja wohl alle Fragen beantwortet.«
»Von wegen, Mr Larson. Jetzt bin ich an der Reihe mit Fragen.« Bei diesen Worten funkelten ihre Augen verschmitzt über den Rand ihrer Nickelbrille hinweg.
Die nächste halbe Stunde unterhielten sie sich über den Amazonas, die Expedition und dies und das. Lennard war nicht umhingekommen, sich einzugestehen, dass er die quirlige Ärztin mochte. Von ihrer fachlichen Kompetenz war er schon vorher überzeugt gewesen. Nein, da gab es für ihn keinen Zweifel, Edda Velmer war eine gute Wahl.
Gerade als Lennard die junge Frau zu einem weiteren Drink an der Bar überreden wollte, war Alberto Ruiz zu ihnen getreten, verbeugte sich formvollendet vor der Dame und bat dann Dr. Velmer um Entschuldigung dafür, dass er ihr Lennard jetzt kurz entführen würde. Er beabsichtige, sich bald zu Bett zu begeben und wolle unbedingt noch kurz mit Herrn Larson sprechen.
Lennard hatte den Vortrag zwar als höflich, aber auch als hölzern, ja distanziert, wahrgenommen.
»Na klar«, entließ ihn Dr. Velmer und Lennard folgte dem FUNAI-Experten mit einer entschuldigenden Geste in Richtung der Ärztin auf die Terrasse. Draußen nahm die unwiderstehliche Atmosphäre Amazoniens Lennard sofort gefangen. Die schwere, schwüle Luft, angefüllt mit tausend Aromen, roch nach Leben. Der intensive Eindruck wurde untermalt von den geheimnisvollen Geräuschen des nahen Urwalds. Das Geschrei roter Brüllaffen bildete den Refrain des alten Urwaldliedes. Genau wie Fawcett, erkannte Lennard, hat die grüne Hölle auch mich in ihren Bann geschlagen.
»Mr Larson«, riss Ruiz ihn aus seinen Gedanken, »was halten Sie denn nun von unserer Expedition und unserem Expeditionsziel?«
Lennard zuckte die Schultern. Täuschte er sich oder hatte die Frage einen leicht provokanten Unterton gehabt. »Nun, Mr Ruiz«, antwortete er schließlich, »eine Expedition, die in ein Gebiet führt, in das noch nie ein – in unserem Sinne – zivilisierter Mensch seinen Fuß gesetzt hat, beinhaltet zwangsläufig eine Vielzahl von unkalkulierbaren Risiken. Niemand kann da was voraussagen. Treffen wir auf Ureinwohner? Und wenn ja, wie verhalten sie sich uns gegenüber?«
»Oder wir uns ihnen gegenüber«, unterbrach ihn Ruiz.
Lennard zögerte einen Moment, dann nickte er langsam. »Ja, oder wir uns ihnen gegenüber.«
»Mr Larson, ich möchte ganz ehrlich zu Ihnen sein. Die FUNAI-Behörde war gegen die Expedition, aber die brasilianische Regierung hat uns überstimmt. Das Renommee für unser Land, die Medienaufmerksamkeit et cetera, all das scheint wichtiger, als der Schutz von ein paar indigenen Völkern.« »Übertreiben Sie da nicht ein wenig?«
»Ich glaube kaum.«
»Hmm, nun gut, dann sagen Sie mal, worauf wollen Sie eigentlich hinaus.«
»Um zum Punkt zu kommen, ich möchte den Kontakt mit den Ureinwohnern komplett verhindern und wenn das nicht möglich ist, zumindest auf ein absolutes Minimum beschränken. Denken Sie nur an die Gefahr, dass wir Krankheitserreger in den Dschungel schleppen könnten, die für uns harmlos sind, für die Indios aber den sicheren Tod bedeuten, und natürlich sind auch gewaltsame Konfrontationen nicht ausgeschlossen. Und, Mr Larson, ich möchte Ihr Wort, dass Sie mich dabei bedingungslos unterstützen.« Ruiz fixierte Lennard mit seinen dunklen Augen.
»Da ein Kontakt mit den Ureinwohnern nicht im Interesse der Expedition und vor allen Dingen auch nicht in meinem Interesse ist, kann ich Ihnen das gerne zusagen.«
»Danke, Mr Larson.« Ruiz nickte knapp, fast schon militärisch in Lennards Richtung, drehte sich auf dem Absatz um und war eine Sekunde später wieder im Inneren des Gebäudes verschwunden.
Lennard hatte sich nachdenklich an das Terrassengeländer gelehnt. Was für ein komischer Kauz und was für ein eigenartiger Auftritt. Ruiz könnte zu einem Problem werden. Es war zwar in Ordnung, dass er sich vehement, wenn auch mit etwas viel Pathos, für die Belange der Indios einsetzte, aber er hatte auch klargemacht, dass er sich nicht als Teilnehmer der Expedition, nicht als Teammitglied, sah, sondern ausschließlich als Beobachter und Aufpasser.
Auf einer Expedition, bei der jeder auf den anderen angewiesen war, bot dies eine Menge Zündstoff. Lennard befürchtete, dass sich Ruiz bei den Gemeinschaftsaufgaben nur allzu schnell auf seinen passiven Beobachterstatus zurückziehen würde. Und dann noch diese übertrieben souveräne, dabei aber kühle und irgendwie arrogante Art. Da könnten sich andere Teilnehmer schnell vor den Kopf gestoßen fühlen, grübelte Lennard, als Brigitte Schneider, die Biologin, auf die Terrasse trat.
Ihre Gesichtszüge wirkten jetzt etwas entspannter, was vielleicht an dem einen oder anderen Cocktail lag. Auf alle Fälle hatte sie in jeder Hand einen Caipirinha und bot Lennard mit einem zurückhaltenden Lächeln ein Glas an.
»Danke!« Er griff nach dem Glas und deutete auf die Schaukelstühle. Damit kein peinliches Schweigen entstand, wenn sie sich gesetzt hatten, entschied sich Lennard für einen Witz: »Sie sind also wegen der Riesenschlange in unserem Team?«
»Ja, unter anderem«, war ihre prompte Antwort und als sie Lennards verblüfftes Gesicht sah, fügte sie schnell hinzu, »in erster Linie bin ich natürlich aus anderen Gründen dabei. Wenn wir wilden Tieren begegnen, soll ich aus deren Verhalten schließen, ob wir uns in einer Gefahrensituation befinden oder nicht. Wenn jemand von einem giftigen Tier gebissen wird, soll ich es möglichst schnell identifizieren, damit die Ärztin das entsprechende Gegengift verabreichen kann und natürlich soll ich auch generell nach neuen Tier- und Pflanzenarten Ausschau halten. Immerhin geht es in ein unbekanntes Gebiet.«
Sie schaute einen kurzen Moment in ihren Cocktail, dann blickte sie Lennard in die Augen. »Mr Larson …«
»Lennard bitte«, unterbrach er die lächelnd.
»Okay, Brigitte.« Sie prosteten sich kurz zu, dann nahm die Biologin mit ernster Stimme den Faden wieder auf: »Also Lennard, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob eine Sucuriju Gigante existiert oder nicht. Was ich aber weiß, ist, dass alle Argumente die gegen ihre Existenz ins Feld geführt werden, nicht greifen, oder besser gesagt nicht mehr greifen.«
Lennard warf ihr einen auffordernden Blick zu, damit sie fortfuhr. »Na gut, aber das kann ein bisschen dauern«, warnte ihn Brigitte.
»Ich hab Zeit und bin jetzt wirklich gespannt.«
Sie nippte an ihrem Glas, stellte es auf dem Tisch ab und wandte sich wieder Lennard zu. »Das Fach Wissenschaftstheorie geht der Frage nach, wie Wissen oder genauer ausgedrückt ein Erkenntnisfortschritt entsteht. An den Universitäten ist diese Teildisziplin noch nicht einmal seit zwanzig Jahren etabliert und noch heute wird vor dem Hintergrund der Wissenschaftstheorie gerade auch in der Biologie sozusagen falsch geforscht.« Sie machte eine kurze Pause und fuhr fort: »Ich mache mal ein Beispiel: Stell dir einen Forscher vor, der nur einen See untersucht und behauptet, alle Schwäne sind weiß. Und jetzt stell dir einen zweiten Forscher vor, der zum gleichen See geht, wieder kommt und sagt: Ja, das stimmt. Alle Schwäne sind weiß. Wie groß ist nun der Erkenntnisfortschritt?«
»Nun, weiß ich nicht, aber er hat zumindest die Aussage bestätigt.«
»Das stimmt, Lennard, aber der Erkenntnisfortschritt ist gleich Null. Er hat nichts Neues herausgefunden. Wissenschaft soll nicht versuchen zu bestätigen. Sie soll versuchen zu widerlegen. Das ist vereinfacht betrachtet die Kernaussage des Falsifikationismus nach Karl Popper und sollte das Leitbild moderner Wissenschaft sein. Lennard, wäre es denn nicht viel sinnvoller gewesen, wenn der zweite Forscher einen weit entfernten See aufgesucht hätte, um dort ganz bewusst nach roten, braunen oder schwarzen Schwänen zu suchen?«
»So gesehen schon, aber was hat das mit Riesenschlangen zu tun?«
»Gedulde dich noch einen Moment, gleich komme ich dazu. Das Problem mit dem Versuch der Bestätigung hat zu regelrechten Auswüchsen in der Wissenschaft geführt. Der Philosoph Thomas Kuhn hat dies mal als Baustein-Theorie-der-Wahrheit bezeichnet.«
»Langsam verliere ich den Anschluss, Brigitte«, lächelte Lennard die Biologin entschuldigend an. Eine Falte hatte sich zwischen seinen Augenbrauen gebildet.
»Okay, ich mach langsam«, erwiderte sie sein Lächeln. Die Baustein-Theorie-der-Wahrheit besagt, dass als Grundlage eine wissenschaftliche Aussage als Dogma festgeschrieben wird. Auf diesen Grundstein werden dann andere Bausteine, die alle mit dem Gesetz in Einklang sind, aufgehäuft.
Steine, also andere Meinungen, Forschungsergebnisse, die nicht passen, werden als falsch oder noch schlimmer, als Blödsinn abgetan. Erst wenn es so viele falsche Bausteine gibt, dass die herrschende Lehrmeinung – allein das Wort schon …« Brigitte verdrehte die Augen, »die herrschende Lehrmeinung nicht mehr aufrechterhalten werden kann, wird die gesamte Mauer mit allen Bausteinen eingerissen und eine neue Aussage zum Gesetz erhoben. Und dann beginnt das gleiche Spiel von vorne.«
»Noch ein Beispiel, bitte«, bat Lennard.
Brigitte nickte kurz. »Die Aussage, alle Schwäne sind weiß, ist das Gesetz. Jeder andere See oder Fluss, auf dem man auch nur weiße Schwäne gefunden hat, ist ein weiterer passender Baustein. Wird von einem schwarzen Schwan berichtet, wird entweder gesagt:
A) Der Forscher muss sich geirrt haben oder er ist ein Spinner.
B) Der Schwan ist krank und wäre eigentlich weiß.
C) Der Schwan ist gar kein Schwan, sondern eine Krähe.
Das geht so lange weiter, bis es so viele Beobachtungen von schwarzen Schwänen gegeben hat, dass keine Ausrede mehr gilt. Erst dann wird akzeptiert, dass die herrschende Lehrmeinung, das zugrunde liegende Gesetz – alle Schwäne sind weiß –, falsch ist. Das Fundament und damit alle Bausteine werden eingerissen. Lennard, ich möchte gar nicht wissen, wie vielen falschen Lehrmeinungen momentan in der Wissenschaft als ewigen Gesetzen gehuldigt wird«, schüttelte Brigitte den Kopf und brachte ihren Vortrag zum Ende.
»Schön und gut, Brigitte, aber ist das nicht alles Theorie?«
Entschieden schüttelte die Biologin ihren Kopf, wobei ihre braunen Locken einen wilden Tanz aufführten. »Beileibe nicht. Denk nur an die Paläontologie. Jahrzehnte lang wurde behauptet, die Dinosaurier wären primitive Reptilien gewesen. Als dann die ersten Funde gemacht wurden, die in eine andere Richtung deuteten, wurde die Grundaussage lediglich dahingehend verändert, dass das primitiv gestrichen wurde. Die ersten Wissenschaftler, die in den achtziger Jahren ihre Vermutung äußerten, die Dinosaurier seien näher mit den Vögeln verwandt, wurden von der Gemeinschaft der Paläontologen mit Hohn und Spott überhäuft. Frei nach dem Motto: Schau mal, da vorne fliegt ein T-Rex. Erst als durch eine Vielzahl von Funden die Reptilientheorie absolut nicht mehr haltbar war, wurde sie verworfen. Heute geht man davon aus, dass sich der Stammbaum der Reptilien und Dinosaurier schon früh trennte. Aus dem einen Zweig entwickelten sich die heutigen Reptilien; aus dem anderen im Endeffekt die Vögel.«
»Mhm«, rieb sich Lennard nachdenklich das Kinn, »aber wie passt da unsere Riesenschlange rein? Da liegt der Fall doch irgendwie anders.«
»Nicht wirklich, Lennard. Nehmen wir mal an, das zugrunde liegende Dogma heißt: Die Anakonda ist mir gut neun Metern die größte Schlange der Welt …«
»Lass mich mal versuchen, Brigitte!«, unterbrach Lennard sie: »Dann würde derjenige, der etwas anderes behauptet, verhöhnt werden. So wie es Fawcett ergangen ist.« Er sah Brigitte fragend an.
Die Biologin nickte bedächtig. »Und nicht nur Fawcett. Auch andere Forscher und Missionare haben von Begegnungen mit einer Sucuriju Gigante berichtet. Und diese Leute galten allesamt nicht als Verrückte oder Aufschneider«, fügte sie hinzu.
»Und«, übernahm Lennard wieder das Wort, »es wird nicht versucht, dieses Gesetz zu widerlegen, sondern zu bestätigen. Dann ist es wie mit den Schwänen: Der zweite Forscher geht zu dem See mit den weißen Schwänen und bestätigt das Gesetz Alle Schwäne sind weiß, weil er nach weißen Schwänen gesucht hat. Das bedeutet, die Riesenschlangen wurden immer dort gesucht, wo es viele normale Anakondas gibt und eigentlich wurde auch nur nach normalen Anakondas Ausschau gehalten.« Er machte eine kurze Pause. »Mein Gott, das würde für die Sucuriju Gigante bedeuten, es wurde bisher immer das falsche Tier am falschen Ort gesucht. Ist es das?«
»Bravo«, grinste Brigitte, »du bist wirklich ein gelehriger Schüler.«
Beide schwiegen einen Moment und tranken einen Schluck. »Und«, hob Lennard wieder an, »jede gefundene Anakonda macht das Gesetz nicht wirklich richtiger, insbesondere wenn nur nach normalen Anakondas gesucht wird.«
»Der Kandidat erhält die volle Punktzahl«, lobte ihn Brigitte amüsiert.
»Moment mal. Ein Einwand bleibt bestehen. Fawcett hatte seine Begegnung mit der Riesenschlange in einem absolut klassischen Anakonda-Gebiet«, hakte Lennard nach.
»Isolation ist ein relativer Begriff, Lennard. Die meisten Tiefseefische kennen wir nur daher, dass sie sich in Schleppnetzen kurz unter der Meeresoberfläche verfangen haben. Kein Mensch weiß, was die Fische da wollten. Oder denk doch nur an unsere bevorstehende Expedition. Wir werden vermutlich auf Indios treffen, die noch nie Kontakt zur Zivilisation hatten. Stell dir vor, wir treffen auf den Spähtrupp eines solchen Stammes. Der Spähtrupp nimmt Reißaus vor uns und berichtet später dem Häuptling von weißen Menschen im Dschungel. Der Häuptling schickt eine Woche später einen weiteren Spähtrupp in den Dschungel. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser zweite Trupp wieder auf Weiße trifft? Sicherlich fast null«, beantwortete sie ihre Frage selbst. »Und natürlich würde der zweite, dritte und vierte Spähtrupp die Weißen genau da suchen, wo der erste Trupp auf sie gestoßen ist. Wenn es keine weiteren Sichtungen von Weißen gibt, werden die Mitglieder des ersten Trupps vielleicht als Spinner abgetan. Sollte Jahre später eine weitere Sichtung erfolgen, so kann dies der Beginn vom Mythos der weißen Dschungelmenschen sein«, schloss sie nachdenklich. »Ach ja«, fiel ihr noch ein, »auch die Begegnungen mit der Sucuriju Gigante waren natürlich seltene Einzelfälle und beileibe kein Massenphänomen.«
Wieder schwiegen beide einen Moment. Brigitte um einen kühlen Lufthauch zu genießen, der in den schwülen Dschungelnächten selten genug vorkam, Lennard, um seine Gedanken zu ordnen. Ihm war aufgefallen, dass jetzt, wo Brigitte in ihrem Element war, ihre Gesichtszüge keinerlei Härte mehr aufwiesen und ihre Augen fast kindlich strahlten. Sie war eine brillante Logikerin, soviel stand mal fest. Lennard konnte sich ausmalen, dass sie während der kommenden Tage noch so manches anregende Gespräch führen würden. Er war froh, dass sie zum Team gehörte. Die offene Art mit der sie an Probleme und Fragestellungen heranging, gefiel ihm.
»Komm, ich hol uns noch zwei Caipis. Muss sowieso mal kurz rein«, schreckte Brigitte ihn auf.
»Gerne.« Er reichte ihr sein leeres Glas und kehrte in Gedanken zu ihrem Gespräch zurück.
Als sie fünf Minuten später mit zwei frischen Drinks zurückkam, war ihm ein weiterer Einwand eingefallen. »Brigitte ein Argument spricht aber doch ganz eindeutig gegen die Existenz dieser Schlange.«
»So, und welches wäre das?«, fragte sie während sie wieder Platz nahm.
»Die Größe, die gigantische Größe und die damit verbundene Frage, wovon sich das Tier ernähren soll?«
»Gute Frage, Lennard. Dafür muss ich einen kleinen Schlenker machen. Also zunächst muss eins klar sein: Die Sucuriju Gigante ist keine besonders große Anakonda, sondern eine ganz eigene Schlangenart. Die Anakonda ist optimal auf ihren Lebensraum angepasst, was Größe, Farbe et cetera betrifft. Eine wichtige Determinante ist dabei auch das Nahrungsangebot. Es würde also überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn einzelne Exemplare mehr als die doppelte Größe erreichen würden. Zumal dann auch die Paarungsmöglichkeiten an ihre Grenzen stoßen. Wir Biologen sprechen da von genetischer Isolation. Nein, die Sucuriju Gigante stellt eine eigene Art dar. Wahrscheinlich eng verwandt mit der Anakonda, aber eine ganz eigene Art. Das passt übrigens auch wieder zu unseren Schwänen. Man weiß mittlerweile, dass die verschiedenen Schwan-Arten auch unterschiedliche Gewässer bevorzugen, es also auch einen Grund gibt, warum man auf bestimmten Gewässern nur eine Art findet!« Sie nahm ihr Glas, prostete Lennard zu, trank einen Schluck und fuhr fort. »In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren wurde in der Biologie auf zwei Phänomene besonderes Augenmerk gelegt, den sogenannten Inselgigantismus und den Tiefseegigantismus. Noch vor zwanzig Jahren war die Wissenschaft davon überzeugt, dass in der Tiefsee ausschließlich winzige Fische und andere Kleinstlebewesen existieren können. Inzwischen weiß man, dass häufig das Gegenteil der Fall ist. Asseln, die wie unsere Kellerasseln aussehen, haben sich in der Tiefsee zu wahren Monstern entwickelt. Die Riesenassel, Bathynomus Giganteus, wird bis zu 45 Zentimeter lang und 1,7 Kilo schwer. Oder der Kolosskalmar, der größte aller Kalmare. Er bevölkert die Tiefsee rund um die Antarktis. Warum diese Tiere so gigantische Ausmaße erreichen, ist gänzlich unbekannt. Manche Wissenschaftler vermuten, dass die Tiere durch einen verlangsamten Stoffwechsel erst sehr spät ihre Geschlechtsreife erreichen. Da die Zeit bis zur Geschlechtsreife für die überwiegende Zahl der Lebewesen die Hauptwachstumsphase ist, wird in dieser Theorie die Größe durch die zeitliche Ausdehnung eben jener Wachstumsphase begründet. Vielleicht stimmt es, vielleicht nicht.« Brigitte zuckte mit den Schultern. »Beim Inselgigantismus, Lennard, hat man einen anderen Erklärungsansatz für Riesenwuchs. Es wird vermutet, dass auf Inseln das Fehlen von Fressfeinden den Riesenwuchs verursacht und dass größere Tiere dann Vorteile bei der Partnersuche haben. Das bekannteste Beispiel hierfür sind die Galapagos-Riesenschildkröten. Interessant ist insbesondere, dass Schildkröten Reptilien sind.«
»Genau wie Schlangen«, unterbrach Lennard die Biologin. »Genau wie Schlangen«, bestätigte sie nickend. »Also, um das Ganze kurz zusammenzufassen«, hob Brigitte wieder an: »In einem mehr oder weniger isolierten Lebensraum ist Gigantismus beileibe kein ungewöhnliches Phänomen. Und wer weiß, was wir da draußen für einen Lebensraum vorfinden werden?«
Diesmal war es an Lennard, bedächtig zu nicken. »Bleibt die Frage der Ernährung«, hob er den Kopf und blickte zu Brigitte.
»Nun«, begann die Biologin, nachdem sie an ihrem Glas genippt hatte, »in ihrem Lebensraum muss sich die Anakonda ihre Nahrung, zum Beispiel Wasserschweine, mit Mohrenkaimanen und Jaguaren teilen. Es gibt also drei Top-Prädatoren an der Spitze der Nahrungskette. Jetzt stell dir unseren isolierten Lebensraum vor. Was, wenn es dort keine Jaguare und Mohrenkaimane geben würde, wohl aber Wasserschweine?«
Nach einer kurzen Pause antwortete Lennard lächelnd: »Okay, du hast gewonnen. Ohne Mohrenkaimane und Jaguare wird die Zahl der Wasserschweine deutlich zunehmen und damit wäre auch genügend Nahrung vorhanden, um Schlangen zu ernähren, die doppelt so groß sind wie eine gewöhnliche Anakonda, stimmt’s?«
»Exakt«, grinste Brigitte.
Auch Lennard trank einen schnellen Zug. Dann wandte er sich wieder der Biologin zu. »Das waren alles Argumente, sehr gute Argumente, die die Existenz der Sucuriju Gigante nicht ausschließen, aber gibt es denn auch Argumente, die tatsächlich für ihre Existenz sprechen?«
»Natürlich.« Brigitte schaute ihn mit großen Augen an, so als ob er eine total dämliche Frage gestellt hätte. »Fawcett, Fawcett selbst«, fügte sie jetzt wieder milder lächelnd hinzu.
Lennard runzelte die Stirn. Er war sich nicht sicher, worauf Brigitte hinauswollte.
»Wie wird Fawcett beschrieben? Was war er für ein Mensch, Lennard?«
»Nun, militärisch korrekt, sehr penibel.«
»Galt er als Angeber?«
»Nein.«
»War er ein Spinner?«
»Nein, aber …«
»Also«, ignorierte sie seinen Einwand, »lass uns mal unterstellen, dass diese Beschreibung von Fawcett zutrifft. Alles andere würde ja auch keinen Sinn ergeben. Die Royal Society hätte ihm andernfalls ja wohl kaum die Verantwortung für fünf weitere Expeditionen übertragen. Wenn wir also unterstellen, dass Fawcett nicht zu Übertreibungen neigte und alle seine Angaben möglichst korrekt und präzise waren, dann müssen wir zwei Sachen daraus folgern …« Brigitte machte eine kurze Pause.
»Und zwar?«, drängte Lennard.
»Erstens: Er hatte eine Begegnung mit einer großen Schlange. Und zweitens: Er hat sich bei der Längenabschätzung der Schlange unglaublich geirrt. Und jetzt frage ich dich, Lennard, für wie wahrscheinlich hältst du es dann, dass ein Mann, dessen Landvermessungen vor über hundert Jahren, ausgeführt mit primitiven Messgeräten, so genau und exakt waren, dass sie noch heute genauso in unseren Karten und Atlanten vermerkt sind, also für wie wahrscheinlich hältst du es, dass eben dieser Mann bei der Längenabschätzung, Vermessung einer Schlange total versagt. So versagt, dass er ein maximal neun Meter langes Tier auf fast zwanzig schätzt. Wie wahrscheinlich ist das?«
»Nicht sehr wahrscheinlich, fast schon unmöglich«, musste Lennard der Biologin recht geben.
»Und noch was, Lennard. Die Abweichung ist einfach zu groß. Selbst wenn man unterstellt, die Lichtverhältnisse wären schlecht gewesen et cetera und sagt, okay, Fawcett hat sich bei dem Teilstück der Schlange verschätzt, bliebe immer noch eine Länge von ungefähr fünfzehn Metern. Die Schlange wäre also immer noch um gut die Hälfte länger als das größte gesichtete Exemplar einer Anakonda.«
Lennard nickte langsam aber anerkennend in ihre Richtung. Er musste sich eingestehen, dass die Argumente der Biologin durch die Bank Hand und Fuß hatten. Beeindruckend. »Eine geheimnisvolle Stadt, wilde Indiostämme und jetzt auch noch eine Riesenschlange, na denn«, grinste er Brigitte an.
Sie grinste ebenfalls, als sie ihm zuprostete und ihr Glas leerte. »Oh je, jetzt wird es aber auch für mich Zeit«, sagte die Biologin nach einen Blick auf die Uhr und lächelte Lennard entschuldigend zu. Vertieft in das anregende Gespräch hatten sie die Zeit vollkommen vergessen.
Lennard begleitete Brigitte ins Innere, wünschte ihr eine gute Nacht und ließ sich an der Rezeption ein Taxi rufen. Er wollte sich schnell noch ein paar Klamotten aus seinem Appartement holen und dann auch sein Zimmer beziehen. Er hatte gesehen, dass nur noch Andrea und Prof. Schmidt in einem Gespräch vertieft am Tresen der Bar saßen.
Die Wanduhr im Foyer zeigte Viertel vor eins, als sein Wagen vorfuhr. Vielleicht sind die beiden ja noch wach, wenn ich zurückkomme, hoffte er während der Fahrt. Natürlich hätte er mit den beiden auch noch gerne über die Expedition gesprochen, vor allem mit Andrea.
Als er jedoch eine halbe Stunde später wieder am Hotel ankam war, die Bar menschenleer. Dann halt morgen, dachte er, während er auf sein Zimmer ging.
Mittlerweile war Lennard fertig mit seiner Morgentoilette, hatte sich angezogen und sein Zimmer Richtung Frühstücksbuffet verlassen. Im Foyer kam er an einer Auslage mit der aktuellen Tagespresse vorbei. Von jedem Deckblatt lächelte ihn Andrea an. Donnerwetter, dachte er, die Society drehte mit der Expedition wirklich das ganz große Rad. Er schnappte sich eine der Tageszeitungen und überflog den zum Foto gehörenden Artikel. Der Sensationsfund von Andrea war der Aufmacher. Dann wurde in wenigen Sätzen an Fawcett erinnert und schließlich über die geplante Expedition auf Fawcetts Spuren berichtet. Gott sein Dank wurde weder der Name des Hotels, noch der Name des Expeditionsschiffes in dem Artikel erwähnt. Die zweite Hälfte des Berichts beschäftigte sich dann mit der herausragenden Bedeutung der National Geographic Society. Lennard legte die Zeitung zurück und betrat die Bar, die jetzt als Frühstücksraum diente. Obwohl es schon fast halb neun war, war der Raum bis auf Prof. Schmidt und einen Bediensteten menschenleer. Umso besser, dachte Lennard und begrüßte den kleinen Wissenschaftler freundlich lächelnd.
»Mr Larson«, strahlte dieser zurück und deutete Lennard, doch an seinem Tisch Platz zu nehmen. Eine Aufforderung, der Lennard nur zu gerne nachkam.
»Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht«, sprudelte der rundliche Mann sofort hervor. Schmidts Teller quoll schier von kleinen Bratwürstchen und Vanillepudding über.
Was für eine Mischung, grauste es Lennard.
»Sie müssen wissen, Mr Larson«, fuhr Schmidt zwischen zwei Löffeln Pudding unbeirrt fort, »meine letzte echte Expedition liegt schon fünfzehn Jahre zurück. Damals ging es auch nach Amazonien, aber ins nördliche Gebiet.«
»Tja, und jetzt halt ins Mato Grosso. Sagen Sie mal Prof. Schmidt, ich habe in den Unterlagen keine Kopie von Fawcetts Tagebuchaufzeichnungen gefunden. Können …«
»Da können Sie sich bei Dr. Braun bedanken.«
»Bei Dr. Braun?«
»Ja, die Gute hat ihre Expeditionsteilnahme mit dem Buch erpresst. Dr. Braun ist eine reine Hochschulforscherin, sie hat nie Feldforschung betrieben oder gar an einer Expedition teilgenommen. Die Society hätte sie nie und nimmer für dieses Projekt ausgewählt. Mit dem Tagebuch hatte sie aber alle Trümpfe in der Hand. Die Society konnte lediglich verhindern, dass sie noch irgendwelche anderen Bücherwürmer als Assistenten mit in den Dschungel schleppt.«
»Kennen Sie denn wenigstens das Tagebuch?«
»Wo denken Sie hin? Nur ein paar Auszüge, die mir die Society unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit hat zukommen lassen. Dr. Braun hat scheinbar nahezu paranoide Angst, dass sie immer noch von der Expedition ausgeschlossen werden könnte. Sie hat mir gestern Abend mitgeteilt, dass sie Ihnen und mir erst eine Kopie des Tagebuchs aushändigt, wenn wir unser Zielgebiet erreicht haben. Kann man sich so was vorstellen?« Missbilligend schüttelte Schmidt den Kopf, während er die letzten beiden Bratwürstchen verdrückte. Ohne Lennard die Gelegenheit zu einer Antwort zu geben, erhob sich der kleine Professor schwerfällig. »Sie entschuldigen bitte, Mr Larson, aber ich will mich noch etwas frisch machen, bevor es zum Schiff geht. Und machen Sie sich mal keine Sorgen, ich werde schon mit Dr. Braun klarkommen.«
»Aber sicher, das will ich doch mal hoffen!« So entließ Lennard Prof. Schmidt, der sich schnurstracks zum Ausgang der Bar begab. Lennard nippte an seinem Kaffee. Der bissige Ton von Schmidt hatte ihm natürlich trotz des versöhnlichen Ausklangs des Gesprächs überhaupt nicht gefallen. Zwei wissenschaftliche Leiter waren schon eine ungewöhnliche Konstellation. Zwei wissenschaftliche Leiter, die sich schon vor Beginn der Expedition in den Haaren lagen, waren eine Katastrophe. Lennard wusste nur zu gut, dass aus einer einfachen Meinungsverschiedenheit in einer Extremsituation schnell ein handfester Streit werden konnte – und Expeditionen führten zwangsläufig zu Extremsituationen. Er würde die beiden gut im Auge behalten müssen. Nachdenklich machte er sich über sein Rührei her.
Er hatte gerade sein Frühstück beendet und den letzten Schluck Kaffee genossen, als Andrea die Bar betrat und strahlend zu seinem Tisch schlenderte.
»Morgen Lennard, schon fertig mit dem Frühstück?«
»Ja, aber ich nehme noch einen Kaffee, setz dich doch.«
Andrea nahm ihm gegenüber Platz, während Lennard ihnen Kaffee einschenkte.
»Und? Hast du gestern interessante Unterhaltungen geführt«, fragte Andrea über den Rand ihrer Tasse hinweg.
»Mhm, gestern und heute Morgen. Ich habe mit Prof. Schmidt zusammen gefrühstückt.« Lennard hatte Andrea bei seiner Antwort genau beobachtet.
Als der Name Prof. Schmidt fiel, konnte man förmlich spüren, wie sie vorsichtig wurde und in ihren Verteidigungsmodus umschaltete. Erst nach einer kleinen Pause antwortete sie: »Und?«
Lennard musterte sie kurz. Dann beugte er sich vor: »Ach komm Andrea, er hat mir erzählt, dass du ihm und mir Fawcetts Tagebuch erst am Zielort geben willst und ich will wissen, was das soll. Traust du mir so wenig?«
Andrea atmete tief durch. »Dir schon. Schmidt oder der Society nicht einen Meter … Lennard«, fuhr sie fort, »Fawcetts Tagebuch ist meine große Chance und ich werde sie mir nicht nehmen lassen. Mein ganzes Leben lang sind wissenschaftliche Meriten, die mir zugestanden hätten, an andere gegangen. Diesmal nicht.« Sie schüttelte energisch den Kopf.
»Dir ist sicher klar, dass du mit deinem Verhalten die Expedition gefährdest?«
»Ach nein. Das Tagebuch wird erst wichtig, wenn wir das Zielgebiet am Rio Xingu erreichen, vorher nicht. Lennard, die Society wollte mich von Anfang an von der Expedition ausschließen. Ich hätte keine Erfahrung in der Feldforschung, war ihr Argument. Ja, wie denn auch, wenn einem zwanzig Jahre lang jede Möglichkeit zum Sammeln von Erfahrung verwehrt wird, frage ich dich.« Andrea hatte sich in Rage geredet und als sie ihre Tasse auf die Untertasse knallte, schwappte ein kleiner Schluck Kaffee über und bildete eine Lache auf dem Tisch, die sie nervös mit ihrer Serviette abtupfte.
Lennard wusste, dass es extrem schwierig war, sich gegen die Interessen der Society durchzusetzen. »Wie konntest du die Society überzeugen?«
Sie hatte sich etwas beruhigt und startete den schwachen Versuch eines Lächelns. Mit gerunzelter Stirn antwortete sie ihm schließlich. »Ich habe sie nicht überzeugt. Ich hab sie erpresst.«
Lennards fragender Blick forderte sie auf weiterzureden. »Also, ich habe die Society über den Fund informiert und zwei Seiten von Fawcetts Tagebuch als Kopie beigelegt. Nach einigem Hin und Her stimmte die Society zu, Prof. Jones das Buch bei mir einsehen zu lassen. Widerwillig. Das Treffen fand im Beisein meiner studentischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter bei mir zu Hause statt. Volle acht Stunden las und prüfte Jones das Original. Zum Abschluss und das hat mir natürlich in der Seele wehgetan, ja fast schon das Herz rausgerissen, trennte ich vorsichtig eine Seite aus dem Tagebuch und gab sie Jones zur Prüfung der Echtheit mit. Vierzehn Tage später erhielt ich ein Angebot über 250.000 Dollar von der Society für das Buch. Ich lehnte ab, beharrte auf meinem Posten als Expeditionsleiterin und teilte der Society mit, dass sich das Original in meinem Schließfach bei einer Bank befände. Die Society drohte mir, das Expeditionsvorhaben komplett fallen zu lassen und erhöhte das Angebot auf 350.000 Dollar. Ich blieb hart und nach vielen weiteren, sehr unerfreulichen Verhandlungen einigten wir uns auf die Doppelspitze mit Schmidt. Als Zugeständnis von meiner Seite muss ich auf der Expedition auf eigene Assistenten verzichten. Verstehst du mich jetzt, Lennard?«, sie griff über den Tisch nach seiner Hand und drückte sie fest. »Wenn sie den Text hätten, könnten sie mich immer noch ausschließen.« Ihr Blick war jetzt schon fast flehentlich. »Ich traue dir, Lennard. Mehr noch, ich mag dich«, fügte sie fast eine Spur zu kokett hinzu, »aber ich habe im Moment wirklich keine andere Wahl.«
Sie saßen sich einen Moment lang schweigend gegenüber. Andrea hielt weiter Lennards Hand umfasst. Lennard musste sich eingestehen, dass ihre Argumente einer gewissen Plausibilität nicht entbehrten. Glücklich machte ihn das natürlich trotzdem nicht. Und er wurde aus Andrea nicht richtig schlau. Suchte die Frau wirklich seine Nähe? Oder nur einen Verbündeten gegen Schmidt? Oder beides? Um das Schweigen nicht peinlich werden zu lassen, räusperte sich Lennard und zog seine Hand zurück.
»Okay, deine Argumente gegen die Society kann ich ja vielleicht noch nachvollziehen. Aber woher kommen deine Vorbehalte gegenüber Schmidt?«
Unschlüssig zuckte Andrea mit den Schultern. »Nichts Spezielles, einfach so«, druckste sie herum. »Vermutlich misstraue ich ihm nur, weil er von der Society ausgewählt worden ist«, fügte sie schließlich kleinlaut hinzu.
Lennard atmete einmal tief durch, bevor er antwortete: »Andrea, es geht hier überhaupt nicht darum, ob ich deine Argumente akzeptiere oder nicht. Es geht darum, dass wir nur als Team Erfolg haben werden. Und dazu gehören in vorderster Front auch du und Prof. Schmidt. Das solltest du nicht außer Acht lassen, okay?«
»Ich werden alles dafür tun, dass die Expedition ein Erfolg wird, alles.«
Lennard wusste nicht, ob ihn diese Antwort freuen oder ihm Angst machen sollte. Trotz des wenig erbaulichen Verlaufs des Morgens war er froh, dass er sich jetzt ein wesentlich besseres Bild von der Situation und den Teilnehmern machen konnte.
»Gut«, sagte er schließlich und musste sich diesmal um ein Lächeln bemühen. »Du solltest jetzt schnell frühstücken. Gleich geht es doch in den Hafen. Ich werde jetzt auch noch mal kurz verschwinden.« Damit verabschiedete er sich und erhob sich von seinem Stuhl.
Auch Andrea stand auf. »Bis gleich.« Sie zwinkerte ihm zu und ging zum Frühstücksbuffet.
Hoffentlich erlebe ich bei dem Schiff, der Ausrüstung und der Begleitmannschaft nicht noch weitere Überraschungen, ging es Lennard durch den Kopf, als er die Treppe zu seinem Zimmer hocheilte.
Die Tageszeitungen von Manaus wurden natürlich nicht nur im Hotel gelesen, sondern auch in den kleinen Nebenstraßen der Zona Sol. Hugo Delgardo, der Besitzer eines kleinen Antiquitäten- und Kolonialwarenladens, konnte es nicht fassen, als er Andreas lächelndes Gesicht auf der Titelseite sah und den nebenstehenden Text las. Jetzt schäumte er vor Wut. Schlimmer noch, sein Stolz war tief gekränkt. Damals, als er der Frau den Karton Altpapier verkauft hatte, war er nach Ladenschluss in die Bar eines Freundes gegangen und hatte sich damit gebrüstet wie er die louca alemã mulher, diese verrückte Deutsche, ausgenommen hatte. Natürlich hatte er das Ganze nach landestypischer Sitte noch ein wenig ausgeschmückt und sich eine halbe Flasche Rum später selbst zum König aller Verkäufer gekrönt. Ob seines geschäftlichen Triumphs hatte er sich sehr generös gezeigt und mit seinen Freunden bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Eben jenen Freunden, die schon den ganzen Vormittag kleckerweise in seinen Laden kamen. Immer mit einer aktuellen Tageszeitung bewaffnet. Immer mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Und immer mit der Bitte, er möge doch noch mal die Geschichte von der verrückten Deutschen erzählen. Der Satz, er, der König der Verkäufer, solle aber ja nichts auslassen, ging dann schon meistens im schallenden Gelächter unter.
Jetzt stand er vor dem Spiegel, vor dem Andrea gestanden hatte und funkelte sich selbst böse an. Er war betrogen worden. Schlimmer noch, er war von einer Frau betrogen worden, oben drein noch von einer Ausländerin.
Nicht mit mir! Er schüttelte langsam den Kopf. Nicht mit Hugo Delgardo. Ein diabolisches Grinsen machte sich langsam auf seinen wütenden Zügen breit. Abwarten, dachte er, abwarten. Das Schicksal hatte sich nicht ganz gegen ihn gewandt. Immerhin wusste er, in welchem Hotel das Expeditionsteam logierte. Abwarten.
Die Rita lag gut vertäut an einem Pier etwas abseits des Haupthafens für die großen Frachtschiffe. Auch wenn die Rita auf Lennard wirkte, als hätte sie schon einige Jahre auf dem Buckel, war das Schiff und insbesondere sein Innenleben tadellos in Schuss.
Lennard hatte sich um 10:30 Uhr mit Andrea und Prof. Schmidt auf den Weg zum Hafen gemacht. Von der gereizten Stimmung zwischen den beiden war wenig zu spüren. Vielleicht auch, weil Lennard das Gespräch ganz bewusst auf Themen wie die benötigte Ausrüstung und die topografischen Besonderheiten am Oberlauf des Rio Xingu lenkte. Themen also, bei denen die beiden Wissenschaftler keine Experten waren und demzufolge die Rolle von Zuhörern einnahmen.
Am Schiff angekommen wurden sie überschwänglich von Kapitän Lucas begrüßt, einem bärbeißigen Amazonasschiffer wie aus dem Bilderbuch. Lenard schätzte den Latino auf Anfang fünfzig. Er war mittelgroß vielleicht so um die eins fünfundsiebzig und schob einen ordentlichen Bierbauch vor sich her. Der obligatorische Dreitagebart fehlte ebenso wenig wie das ölverschmierte Hemd, das der Kapitän damit entschuldigte, dass er gerade noch mal die Dieselmotoren überprüft hatte.
Wie nicht anders zu erwarten, überhäufte Lucas Andrea augenblicklich mit Komplimenten. Eine Prozedur, die in diesem Teil der Welt einfach dazugehörte. Andrea ließ es lächelnd über sich ergehen und fragte den Kapitän, als er eine Pause eingelegt hatte, um sich neue Komplimente zu überlegen, ob sie sich mit Prof. Schmidt etwas an Deck umschauen könne. Lennard und er könnten in der Zwischenzeit dann ja ungestört die Ausrüstung überprüfen.
Obwohl der Kapitän etwas überrumpelt schien, stimmte er zu und wies einen Matrosen an, die beiden über Deck zu führen. Hoffentlich kriegen die nicht wieder Zoff, dachte Lennard, als Kapitän Lucas ihm lächelnd die Hand auf die Schulter legte und ihn auf die Kommandobrücke der Rita führte.
Zwei Stunden später betrat Lennard wieder das Oberdeck. Vom Heck drang Gelächter zu ihm herüber. Als er in die Richtung schaute, sah er Andrea, Prof. Schmidt und Edda Velmer an einem Klapptisch sitzend Kaffee trinken. Die junge Ärztin musste kurz nach ihnen an Bord gekommen sein, um die kleine medizinische Abteilung der Rita zu inspizieren. Nach Streit sieht das zumindest schon mal nicht aus, freute sich Lennard und schlenderte zu den dreien herüber. Auch Lennard war bester Laune, hatte der Rundgang doch alle seine Fragen mehr als befriedigend beantwortet.
Die Rita verfügte über zwei leistungsstarke Dieselmotoren, die auch einem schwierigen Gewässer wie dem Rio Xingu problemlos trotzen sollten.
Nach dem Maschinenraum hatte Kapitän Lucas ihm zunächst die Kabinen gezeigt, die klein, aber funktional eingerichtet waren. Eine Expedition ist nun mal keine Luxuskreuzfahrt. Weiter war es dann in den Vorratsraum gegangen, wo sich Lennard überzeugen konnte, dass der Proviant, sowohl was die Menge als auch die Zusammenstellung betraf, nichts zu wünschen übrig ließ.
Ein ähnliches Bild zeigte sich in der Waffenkammer. Neben einigen Präzisionsgewehren und Handfeuerwaffen gab es eine große Auswahl an Macheten, die sich in Länge und Gewicht unterschieden, sodass jeder Expeditionsteilnehmer prüfen konnte, mit welcher Machete er am besten zurechtkam. An einer Wand hingen zudem zwei Taucheranzüge mit den dazugehörenden Tauchmessern und zwei Hochdruckharpunen. Zwar war kein Tauchgang vorgesehen, aber falls sich im Wasser treibende Schlingpflanzen und Wurzeln in der Schraube der Rita verfingen, konnte dies überaus nützlich sein, um den Kahn wieder flottzukriegen. Der zweite Taucher würde dann dem ersten den Rücken freihalten. Die Durchschlagskraft der Harpunen, wusste Lennard, konnte es sogar mit der Panzerung der mächtigen Mohrenkaimane aufnehmen. Und müssten einmal sehr große Hindernisse beseitigt werden, war auch eine Kiste Dynamit an Bord. Lennard war beeindruckt.
Nachdem Lucas ihm die weitere Ausrüstung wie Schlafsäcke, Zelte, Werkzeug et cetera gezeigt hatte, endete der Rundgang schließlich wieder auf der Brücke, wo der Kapitän ihm die Funkanlage der Rita sowie die beiden tragbaren Funkgeräte für die Expedition inklusive Ersatzteilkoffer präsentierte.
Die Society hatte wirklich an nichts gespart, musste Lennard sich anerkennend eingestehen. Als er nun zu dem Klapptisch ging, fiel sein Blick auf den Ausleger, der am Heck der Rita befestigt war. In zwei Reihen, leicht versetzt, waren dort fünf Kanus deponiert worden, die jeweils vier, maximal fünf Personen Platz boten. Damit konnte er endgültig einen Haken hinter das Thema Ausrüstung machen.
»Und sind Sie zufrieden mit der medizinischen Ausrüstung«, begrüßte Lennard die junge Ärztin, während er nach einem leeren Stuhl griff, um sich mit an den Tisch zu setzten.
»Mehr als das. Alles perfekt.«
»Zu dem gleichen Ergebnis bin ich bei meinem Rundgang mit Kapitän Lucas auch gekommen«, erklärte Lennard der Runde, nachdem er sich gesetzt hatte.
Als Lennard sich etwas Kaffee einschenkte, wandte sich Prof. Schmidt an ihn: »Mr Larson, was vermuten Sie, wird uns am Oberlauf des Rio Xingu erwarten?«
»Die Hölle, Prof. Schmidt, die Hölle«, war seine lakonische Antwort und als er merkte, dass in alle weiterhin anschauten, führte er aus: »Der Rio Xingu ist besonders im Unterlauf bis zu seiner Mündung im Amazonas ein sehr mächtiger Strom. Zwischen der Einmündung in den Amazonas und seiner Quelle liegen 1980 Kilometer, die in Richtung Quelle mit jedem Meter unbefahrbarer werden. Bis hinter den großen Belo-Monte-Staudamm wird uns die Rita problemlos bringen. Dann kommen die tückischen Stromschnellen und wir werden auf die Kanus umsteigen müssen. Trotz der Stromschnellen ist die Fließgeschwindigkeit im Oberlauf eher träge. Eine Unzahl von kleinen Nebenflüssen schließt sich dort seinem Weg an. Ansonsten ist die Landschaft am Oberlauf Wildnis und zwar im ursprünglichen Sinne: Kaum zu durchdringen, von Sümpfen und Seen durchsetzt und von Milliarden Moskitos bevölkert, die uns förmlich auffressen werden. In weite Teile dieses Gebiets hat noch nie ein Mensch seinen Fuß gesetzt, außer vielleicht ein paar wenige der indigenen Völker, die dort leben. Soll heißen: Es wird eine Reise ins Ungewisse.«
»Und wir alle brennen drauf, dieses Ungewisse zu erforschen!« Andrea strahlte einen nach dem anderen an, bis ihr Blick fragend auf Schmidt ruhen blieb. Dieser nickte bedächtig, Dr. Velmer enthusiastisch.
»Ich werde dich daran erinnern, wenn das Jucken und Brennen der Moskitostiche dich um den Schlaf bringt«, grinste Lennard sie an.
»Und ich halte sie allesamt für verrückt, total verrückt«, gab Kapitän Lucas seinen Kommentar ab.
Lennard blickte über seine Schulter. Er hatte gar nicht bemerkt, dass der Flussschiffer sich dem Tisch genähert hatte.
»Dort oben leben Kreaturen, die direkt aus der Hölle stammen und Wilde, die Sie skalpieren werden oder fressen oder beides. Sie müssen einfach verrückt sein. Aber meine Rita und ich werden gut bezahlt, sie bis zu den großen Stromschnellen zu bringen. Verrückt aber reich, was soll‘s«, beendete er kopfschüttelnd seinen Vortrag.
»Sind das nicht nur Ammenmärchen, Kapitän?«, hakte Andrea nach.
Lucas zuckte mit den Schultern. »Moça, ich weiß nur zwei Dinge. An jeder Legende ist immer was Wahres dran. Über die Gegend, in die sie wollen, gibt es viele Geschichten und Legenden. Fürchterliche, grauenhafte Geschichten.« Er kratzte sich ausgiebig hinter dem rechten Ohr, bevor er mit seiner zweiten unerschütterlichen Wahrheit fortfuhr: »Und ich bin froh, dass ich nicht in Ihrer Haut stecke, wenn sie das selber herausfinden.«
Kurz vor 14:00 Uhr hatte die Gruppe sich dann vom Kapitän verabschiedet und die Rita verlassen. Gut fünfzig Meter vom Kai drehte sich Lennard um. Seine Augen wanderten noch einmal über die Rita. Er schätzte ihre Länge auf etwa mehr als zwanzig Meter, ihre Breite betrug sechs Meter. Das hatte er abschreiten können, als er an Bord war. Dabei hatte er sofort an sein Gespräch mit Brigitte gedacht. Sollte Fawcett wirklich nicht in der Lage gewesen sein, eine halbwegs vernünftige Längenabschätzung hinzukriegen? Kaum vorstellbar. Nachdenklich drehte sich Lennard wieder um und schloss zum Rest der Gruppe auf.
Als sie die Zona Sol erreichten, trennten sich ihre Wege. Um 20:00 Uhr waren alle Teilnehmer zum gemeinsamen Abendessen im Hotel verabredet. Dann sollte auch Jack Cameron, der Presse- und Kameramann der Expedition, endgültig zur Gruppe stoßen. Auch mit ihm wollte sich Lennard natürlich noch vor dem Beginn der Expedition unterhalten. Aber bis zum Abend war ja noch reichlich Zeit. Lennard wollte diese nutzen, um sein persönliches Gepäck an Bord der Rita zu bringen. Außerdem wollte er am Nachmittag seine Abwesenheit mit den Mitarbeitern seiner Agentur organisieren.
Andreas Blick war mehr als bedauernd, als er in eine Seitenstraße in Richtung seines Apartments abbog, nachdem er den anderen mitgeteilt hatte, nicht mit ihnen auf der Suche nach einem netten Restaurant durch die Zona Sol zu bummeln.
Knapp drei Stunden später hatte Lennard alles erledigt und kehrte mit einem Rucksack bepackt und einer Jumbo-Reisetasche an Bord der Rita zurück. Er hatte gerade alles in seiner Kabine verstaut und war schon wieder auf dem Weg zur Gangway, als er auf dem Achterdeck Jack Cameron entdeckte. Lennard winkte dem schlaksigen Mann lächelnd zu und Cameron erwiderte den Gruß freundlich nickend.
»Was hat Sie denn an Bord verschlagen?«, fragte Lennard als er das Achterdeck erreichte.
»Nichts Besonderes, ich wollte nur schon einmal meine Kabine beziehen und das Foto- und Filmmaterial verstauen.«
»Ja, das habe ich auch gerade erledigt.«
»Und, Mr Larson, wie gefällt ihnen die Rita?«
»Ein grundsolides Schiff. Ich denke, die Rita wird ihre Aufgabe gut meistern.«
»Das wird Prof. Jones freuen, dass sie zufrieden sind.«
»Mhm, bei der Ausrüstung hat die Society nicht gespart.«
»Das hört sich fast so an, als hätte die Society an anderer Stelle gespart?«
»Ja. An Informationen, Mr Cameron, an Informationen.«
Cameron blickte Lennard nachdenklich durch die Gläser seine John-Lennon-Brille an. Er schien über etwas nachzudenken. Schließlich wandte er sich wieder an Lennard. »Was meinen Sie, wir haben ja noch genügend Zeit. Darf ich Sie auf ein Bier in eine der Hafenkneipen einladen?«
»Gerne«, erwiderte Lennard und keine fünf Minuten später hatten die beiden Männer die Rita verlassen und den Schankraum eine nahegelegen Hafenbar betreten.
Im Laufe der nächsten Stunde bestätigte Cameron Lennard die Geschichte, wie sie ihm Andrea am Morgen geschilderte hatte. Man merkte Cameron an, dass dabei zwei Herzen in seiner Brust schlugen. Als Mitarbeiter der Society konnte er das Zurückhalten von Informationen natürlich nicht gutheißen, aber er zeigte auch Verständnis für Andreas Situation. Ein Umstand, der vermuten ließ, dass Andreas Befürchtungen nicht ganz aus der Luft gegriffen waren. Außerdem brachte ihm diese Objektivität bei Lennard einige Sympathiepunkte ein. Als die beiden Männer gegen 18:00 Uhr die Hafenkneipe verließen, waren sie vom förmlichen Sie zum ungezwungenen Du übergegangen.
Die beiden hatten beschlossen, zeitig zum Hotel zurückzukehren, damit ihnen noch genügend Zeit bliebe, um sich etwas frisch zu machen, bevor es zum gemeinsamen Abendessen ging.
Als Lennard um kurz vor acht die Hotelbar betrat waren bis auf Alberto Ruiz bereits alle Teilnehmer versammelt. Auch heute war das Buffet reichhaltig mit allerlei Köstlichkeiten bestückt. Lennard gesellte sich zu Martina und Olaf an die Bar. Das erschien ihm am unverfänglichsten. Solange er sich noch kein abschließendes Urteil über Andrea gebildet hatte, wollte er lieber ein wenig Abstand zu ihr halten. Er hatte kaum Platz genommen, als die beiden ihn auch schon mit Fragen über die Rita und zur Expeditionstour überhäuften.
Wenige Minuten später erschien dann auch Ruiz und das Buffet wurde eröffnet. Alles in allem war die Stimmung etwas ruhiger und weniger ausgelassen als gestern Abend. Irgendwie schien jeder seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Verwundert war Lennard darüber aber nicht, schließlich begann für manche Teilnehmer übermorgen vielleicht das Abendteuer ihres Lebens. Da fragte man sich natürlich dreimal, ob man an alles gedacht hatte und auch, was einen wohl erwarten würde.
Andrea hatte im Laufe des Abends mehrmals versucht, mit ihm Blickkontakt aufzunehmen, aber Lennard hatte so getan, als ob er es nicht bemerken würde. Nach dem Essen hatte er es sich noch mit Brigitte und Jack auf der Terrasse bequem gemacht. Gegen 23:00 Uhr nagte dann aber doch die vorangegangene Nacht an ihm und er verabschiedete sich von den beiden. Als er die Bar durchquerte, entdeckte er Andrea, die mit Ruiz und Edda an der Bar saß. Die anderen hatten sich bereits auf ihre Zimmer begeben.
Er wünschte auch den dreien eine angenehme Nacht und merkte, als er Andrea in die Augen sah, dass ihr Blick gekränkt wirkte. Hatte er sie etwa verletzt? Aber womit denn? Er hatte doch gar nichts gemacht. Naja, vielleicht gerade damit, dachte er, als er auf sein Zimmer ging.
Hier, ich bin hier! Hier bin ich! Hier! Hier!
Die Wände des Eislabyrinths schoben sich immer enger an Lennard ran. Verzweifelt fiel sein Blick in den nächsten Gang. Die Wände würden ihn gleich erreichen und dann ganz langsam zerquetschen.
Die Rufe seiner Frau waren in seinen Kopf zu einem Orkan angeschwollen. Hier bin ich! Hier!
Jetzt hatten ihn die Wände erreicht.
Hier bin ich! Hier!
Er wachte mit einem Schrei auf.
Lennards Oberkörper war nassgeschwitzt und seine Atmung ging stoßweise. Er setzte sich auf die Bettkante und griff nach seiner Schachtel Luckys auf dem Nachttisch. Mit zitternden Fingern zündete er sich eine Zigarette an und inhalierte tief. Eigentlich hatte er sich ja fest vorgenommen, das Rauchen endlich aufzugeben. Aber scheiß auf das Gequatschte von wegen Gesundheit, meldete sich eine nagende Stimme in seinem Kopf. In solchen Momenten hatte eine Zigarette etwas unglaublich beruhigendes.
Während er rauchend in seinem dunklen Zimmer auf der Bettkante saß, kehrten seine Gedanken zurück in die Vergangenheit. Zurück zu Victoria. Und so sehr er auch dagegen ankämpfte, füllten sich seine Augen doch langsam mit Tränen.
Es hatte über ein Jahr gedauert, ehe sich der Schmerz auf ein erträgliches Maß eingependelt hatte. Und ein weiteres Jahr war vergangen, ehe ihm seine Arbeit langsam wieder Spaß gemacht hatte. Wenn nur dieser verfluchte Traum nicht wäre, dachte er und drückte seine Kippe im Aschenbecher aus. Er wischte sich mit dem Handrücken über die Augen und schüttelte den Kopf, schnaufte einmal kräftig durch und wollte sich wieder hinlegen, als er ein Geräusch hörte.
Erst konnte Lennard das Geräusch nicht wirklich einordnen. Er wusste nur, dass es nicht zur nächtlichen Melodie des Urwalds gehörte. Als das Geräusch ein weiteres Mal erklang, ahnte er, was es war. Schritte. Leise Schritte. Und zwar auf dem Balkon, der die komplette erste Etage und damit auch die Zimmer aller Teilnehmer umrahmte.
Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass es bereits halb vier war. Sollte so spät noch jemand aus der Gruppe auf dem Balkon sein, um Luft zu schnappen? Vielleicht kann der- oder diejenige ja auch nicht schlafen, dachte Lennard. Da ich eh wach bin, kann ich auch einfach nachsehen, entschied er und schwang sich aus dem Bett. Irgendein Instinkt riet ihm, leise zu sein und so entriegelte er behutsam seine Balkontür und öffnete sie vorsichtig.
Als er leise auf den Balkon trat, sah er eine ganz in Schwarz gekleidete Gestalt, die sich durch das Fenster in Lennards Nachbarzimmer beugte.
Andreas Zimmer, schoss es ihm durch den Kopf. Vermutlich hatte sie das Fenster nur angelehnt, denn Einbruchsgeräusche hatte er keine gehört.
»Hey«, rief er der Gestalt zu.
Der Eindringling wirbelte herum, stieß einen Fluch aus und machte im nächsten Moment schon eine elegante Flanke über das Balkongeländer. Im Garten rollte er sich geschickt ab und eine Sekunde später war der Schatten bereits zwischen den schemenhaften Umrissen der Bäume verschwunden.
Was war das denn, überlegte Lennard vollkommen perplex. Habe ich jetzt gerade einen Einbruch verhindert? Oder Schlimmeres? Andrea war ohne Zweifel eine attraktive Frau. Immer noch nachdenklich ging er zu ihrem Fenster. Er beugte sich vorsichtig vor, um in Andreas Zimmer zu gucken. Dann sog er erschreckt die Luft durch die Zähne. In dem Halbdunkel hatte er erkannt, dass Andrea kerzengerade in ihrem Bett saß.
»Andrea …«
»Lennard?«
»Ja.«
»Lennard, der Mann … am Fenster … er … er hat etwas auf mein Bett geworfen … Oh Gott, Lennard … Es sitzt auf meiner Brust … und bewegt sich.«
Ihre Stimme war ein zittriges Flüstern und Lennard hörte, dass sie kurz davor stand, in Panik auszubrechen.
»Okay, mach keinen Mucks und rühr dich nicht. Versuch, ruhig zu atmen. Ich bin sofort bei dir.«
Noch ehe Andrea etwas erwidern konnte, war Lennard in sein Zimmer gelaufen und schnappte sich seinen Rucksack. Er wühlte kurz drin herum und förderte seine Taschenlampe und sein Nahkampftauchermesser zutage.
Sekunden später war er wieder an Andreas Fenster. Während er durch das Fenster kletterte, leuchtete er den Zimmerboden vorsichtig ab.
Als Erstes fiel der Lichtkegel auf den mit Holz verstärkten Schuhkarton. Direkt daneben lag der mit Luftlöchern perforierte Deckel. Vorsichtig darauf bedacht, kein Geräusch zu machen, glitt Lennard tiefer in den Raum hinein.
Andrea wimmerte leise. Der Strahl der Taschenlampe wanderte vom Fußende ihres Bettes aus höher. Andrea schien zu zittern. Um Gottes willen, ruhig Mädchen, dachte er, als er den Lichtstrahl langsam über ihre Hüften höher gleiten ließ. Das Licht beschien nur ihr dünnes schwarzes Satinnachthemd. Scheinbar wollte sie sich noch mal etwas Luxus gönnen, bevor es losging. Frauen halt.
Als der Lichtkegel Andreas Brust erreichte, traf der Schein der Taschenlampe auf die acht Augen der Armadeira. Die handgroße Spinne riss sofort angriffslustig ihre beiden vordersten Beine hoch. Sie saß genau zwischen Andreas Brüsten und nur der dünne Satinstoff trennte ihre Giftklauen von Andreas Haut. So eine Scheiße, fluchte Lennard in Gedanken. Ausgerechnet eine Bananenspinne. Keine Spinne der Welt war für mehr tödliche Bisse bei Menschen verantwortlich als die Bananenspinne. Zudem galt sie als äußerst aggressiv. Größere Angreifer versuchte sie sogar mehrmals zu beißen und war bekannt dafür, diese sogar anzuspringen. Er ließ den Lichtkegel weiterwandern, um die Spinne nicht noch aggressiver zu machen. Der Strahl hatte dabei auch kurz Andreas Gesicht gestreift.
Sie biss sich auf die Unterlippe. Ihre Mundwinkel zitterten. Die Augen hatte sie fest zugekniffen und Lennard hatte auf ihren Wangen zwei Tränen erkannt. Er stand jetzt direkt neben ihr. Seine rechte Hand, die das Messer hielt, war schweißnass. Um die Spinne abzulenken, hatte er begonnen, mit der Taschenlampe kleine Achten über dem Tier in den Raum zu malen. Das Messer näherte sich der Spinne. Er wollte versuchen, die scharfe Klinge unter ihren Vorderkörper zu bringen, um sie dann mit einem Ruck von Andrea wegschleudern zu können.
Als seine Hand dabei über Andreas Busen strich, wimmerte sie wieder leise. Dann begriff sie, dass es seine Hand war und entspannte sich ein wenig. Die Spinne verharrte weiterhin in Angriffsposition. Bereit, jederzeit zuzubeißen.
Trotz des schwachen Lichts konnte Lennard erkennen, dass das Messer die Spinne inzwischen erreicht hatte. Millimeter für Millimeter schob er die Klinge zwischen dem ersten und dem zweiten Beinpaar unter das Tier. Mittlerweile war auch seine Stirn schweißnass. Die Klinge erreichte Andreas linke Brust. Lennard atmete noch einmal tief durch. Dann riss er mit einem Ruck das Messer hoch.
Andrea schrie jäh auf.
Die Spinne wurde durch das Zimmer katapultiert. Lennard sprang sofort ans Fußende des Bettes, um nach dem Tier zu leuchten. In dem Moment, in dem der Strahl der Taschenlampe sie erfasste, sprang die Spinne Lennard mit weit von sich gespreizten Beinen an.
Fast hätte sie ihn erreicht.
Sie landete gut zehn Zentimeter von seinem nackten linken Fuß entfernt und bewegte sich sofort wieder auf ihn zu. Lennard ließ sich auf sein rechtes Knie fallen und rammte die Klinge durch den Vorderkörper der Spinne, bis sie tief in den Bodendielen stecken blieb. Die Giftklauen des Tiers waren keine drei Zentimeter mehr von seinen Zehen entfernt und obwohl die Spinne am Boden festgenagelt war, versuchte sie, weiter auf Lennard zuzukrabbeln. Ihre Beine verursachten dabei ein widerlich schabendes Geräusch auf dem Holzboden. Aber Lennard wusste, dass das nur noch die letzten Zuckungen waren. Es war vorbei.
Er stand auf, machte das Licht im Zimmer an und lehnte sich einen Moment mit dem Rücken gegen die Zimmertür. Andrea hatte angefangen, hemmungslos zu schluchzen. Er wollte gerade zu ihr rübergehen, um sie tröstend in den Arm zu nehmen, als es aufgeregt an der Tür klopfte. Draußen standen Martina und Olaf, die der Krach geweckt hatte. Noch ehe sie fragen konnten, was los war, deutete Lennard auf die Spinne, die immer noch nicht eingesehen hatte, dass sie tot war.
Martina schrie: »Igitt!«, und schlug sich eine Hand vor den Mund. Olaf war beim Anblick des sich windenden Tieres mehr als nur eine Spur blasser geworden.
Mittlerweile waren auch die anderen Teilnehmer auf dem Flur erschienen. Nur Ruiz fehlte, der den Schlaf eines Toten zu haben schien. Lennard wollte ihnen gerade erzählen, was passiert war, als Andrea zu ihm kam, ihre Arme um ihn schlang und ihren Kopf an seine Brust lehnte. Lennard erkannte mit Erstaunen, wie schnell sie sich wieder gefangen hatte.
»Erzähl es ihnen nicht jetzt. Wir müssen ihnen nicht die Nacht versauen. Morgen früh reicht«, raunte sie ihm leise zu.
Ganz schön taff, dachte Lennard und nickte unmerklich. Als sie sich von ihm löste, entdeckte er einen kleinen Blutfleck auf seinem T-Shirt. Er sah Andrea mit weit aufgerissenen Augen an. Doch diese schüttelte lächelnd den Kopf und deutete auf ein Loch in ihrem Nachthemd.
»Sie hat mich nicht gebissen, das war die Messerspitze, als du sie weggeschleudert hast. Nur ein ganz kleiner Kratzer.«
Noch ehe er sich bewusst wurde, was er da sagte hatte er Andrea gefragt: »Soll ich mir das nicht besser mal ansehen?«
Grinsend drängte sich Dr. Velmer an ihm vorbei. »Das ist ja wohl eher meine Aufgabe.« Sie schüttelte immer noch grinsend den Kopf.
Alle mussten Schmunzeln, auch Lennard, der etwas errötete. Aber die Anspannung löste sich. Für die Nacht blieb es dabei, dass Lennard Andreas Hilferuf gehört hatte, geistesgegenwärtig genug gewesen war, über den Balkon in ihr Zimmer zu gelangen und der Spinne schließlich den Garaus gemacht hatte.
Martina bestand darauf, dass Andrea die restliche Nacht bei ihr im Zimmer verbringen müsse und quartierte den vollkommen überrumpelten Olaf kurzerhand bei Lennard ein. Andrea ließ es sich nicht nehmen, Lennard einen Gutenachtkuss auf die Wange zu hauchen und eine Viertelstunde später lagen alle wieder in ihren Betten.
An Schlaf war für Lennard freilich nicht zu denken und er vermutete, dass es Andrea nicht anders erging.
Wer wollte Andrea umbringen und vor allem warum? Davon, dass die Expeditionsteilnehmer dieses Hotel bezogen hatten, wusste doch kein Außenstehender. Ging es dem Kerl überhaupt um Andrea oder hatte sich der Attentäter im Zimmer geirrt? Oder wollte er egal wen töten, um dem Hotel zu schaden? Fragen über Fragen gingen Lennard durch den Kopf. Gegen sechs Uhr morgens fiel er dann doch noch in einen unruhigen Schlummer.
Am nächsten Morgen erwachte Lennard mehr schlecht als recht ausgeruht gegen neun Uhr. Olaf kam gerade aus dem Bad und teilte Lennard mit, dass er mal nach den Mädels sehen wolle.
Was Andrea wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass der Jungspund sie Mädel nennt, schmunzelte Lennard in sich hinein, nickte Olaf aber aufmunternd zu.
Eine halbe Stunde später waren alle Teilnehmer zum Frühstück versammelt. Vor dem Frühstück hatte Andrea Lennard noch darum gebeten, ihr den Bericht über die Geschehnisse der vergangenen Nacht abzunehmen. Und so war es Lennard, der am Ende des Frühstücks um Aufmerksamkeit bat und die ganze Geschichte erzählte. Die Gruppe war fassungslos. Fassungslos und bestürzt. Es wurde wild durcheinanderdiskutiert.
Als dann Ruiz auf die gleiche Idee kam wie Lennard in der Nacht, nämlich dass vielleicht ein anderer Opfer des Anschlags hätte werden sollen, mischte sich noch eine zusätzliche Spur Entsetzen in die Gemütslage der Teilnehmer. Um seinen Bericht noch zu unterstreichen, führte Lennard die Gruppe in Andreas Zimmer. Die Spinne war mittlerweile verendet und wurde mit Ehrfurcht bestaunt. Ebenso der Schuhkarton mit den Luftlöchern. Als die Teilnehmer sich wieder aufmachten, um sich in die Bar zu begeben, war die Euphorie vor dem Expeditionsstart einer dumpfen Bedrückung gewichen.
Bevor Lennard das Zimmer als Letzter verließ, zog er sein Messer aus den Dielen, entsorgte die tote Spinne im Mülleimer, wischte die Klinge an seiner Jeans ab und verstaute sie. Den Mülleimer drückte er im Flur dem vollkommen aufgelösten, sich ständig entschuldigenden Hotelmanager in die Hand.
Überraschenderweise war es Andrea, welche die Gruppe aus dem Trübsalblasen riss, als alle wieder in der Bar waren: »Okay«, fing sie an, »mir ist dank Lennard nichts passiert und heute Abend sind wir hier weg. Es geht endlich los, also vergesst den Vorfall. Mir geht es gut, ja?«
Anerkennend stellte Lennard fest, dass sie damit den Bann gebrochen hatte. Die Erinnerung an den nahenden Aufbruch hellte die Stimmung tatsächlich ein wenig auf.
Für Lennard, der seine Vorbereitungen ja bereits abgeschlossen hatte, vergingen die nächsten Stunden quälend langsam.
Die anderen Teilnehmer waren emsig damit beschäftigt, ihre Sachen zu packen und zur Rita zu bringen. Im Hotel herrschte demzufolge ein reges Kommen und Gehen. Lennard lag auf seinem Bett und hatte gerade zum x-ten Mal die Flecken an der Zimmerdecke gezählt, als gegen 14:00 Uhr jemand an seiner Zimmertür klopfte. Es war Andrea und sie sah umwerfend aus. Die enganliegende Jeans betonte ihre Figur und auch ihre weiße Bluse hob ihre Qualitäten eindrucksvoll hervor. Sie lächelte Lennard strahlend an. In der linken Hand hielt sie einen Briefumschlag, in der rechten zwei Stielgläser und eine kleine Flasche Champagner.
»Ich muss mich noch mal bei dir bedanken«, zur Untermalung schwenkte sie die Hand mit den Gläsern und der Flasche leicht in seine Richtung und lächelte verschwörerisch.
»Musst du nicht, aber gegen ein Gläschen hab ich nichts einzuwenden«. Lennard bat sie in sein Zimmer.
Sie stellte die Gläser und die Flasche auf dem Schreibtisch ab und reichte ihm dann den Briefumschlag. »Der ist wohl versehentlich an der Rezeption in mein Postfach gerutscht.«
Tatsächlich stand auf dem Umschlag Lennards Name. Er riss das Kuvert auf und fand eine Nachricht von Kapitän Lucas, der ihm mitteilte, dass die Begleitmannschaft, bestehend aus zehn Echoca-Indios, gestern wie geplant aufgebrochen war, um das Basislager für die Expedition an der Stelle zu errichten, ab der die Rita wegen der Stromstellen nicht weiter konnte.
Die Echoca waren ein Indiostamm, der ursprünglich das brasilianische Hinterland nahe der bolivianischen Grenze bewohnt hatte. Sie waren eher klein und von kompakter Statur. Trotz ihres kriegerischen Naturells waren die Echoca schon zu Fawcetts Zeiten begehrte Expeditionsbegleiter gewesen. Kein Weißer kannte den Regenwald so gut wie sie. Außerdem waren sie begnadete Fährtenleser. Lennard konnte sich keine bessere Begleitmannschaft wünschen. Wenn überhaupt etwas, konnte er den quirligen Kerlen nur ihren notorischen Aberglauben als Manko ankreiden. Aber eigentlich auch das nicht. Im ganzen Amazonasbecken gab es nicht einen einzigen Indiostamm, der nicht abergläubisch war. Mythen und Legenden waren ein fester Bestandteil ihres Lebens. Und wenn Lennard ganz ehrlich zu sich war, jagte er doch gerade selbst den Märchen um eine vergessene Stadt hinterher. Nein, die Echoca waren zweifelsohne die bestmögliche Besetzung für die Begleitmannschaft.
Lennard nickte zufrieden und legte den Zettel auf den Schreibtisch. In der Zwischenzeit hatte Andrea den Champagner geöffnet und zwei Gläser eingeschenkt. Sie prostete ihm zu und als er den Gruß erwidert hatte, nippten beide an ihren Gläsern.
Die ganze Zeit über hatte sie ihn mit ihren braunen Mandelaugen aufreizend, fast schon herausfordernd, fixiert. Erneut wurde Lennard bewusst, was für eine Schönheit diese Frau war und noch ein Gedanke ließ sich nicht mehr aus seinem Kopf verbannen: Seit Victoria hatte er mit keiner Frau mehr geschlafen. Er konnte nicht ahnen, dass es sich bei Andrea ähnlich verhielt. Auch sie hatte seit ihrer Trennung enthaltsam gelebt. Lennard räusperte sich.
»Andrea, ich würde dich jetzt gerne in den Arm nehmen und … naja … küssen, aber …«
»Was aber …?«
»Ich weiß halt nicht, ob … ich meine … ich denke …«
Mein Gott, was für ein Blick. Lennard versank förmlich in ihren Augen. Sie wirkte jetzt unglaublich verletzlich.
»Nun«, fuhr er endlich mit einem unsicheren Lächeln fort, »aber als ich das letzte Mal deine Brust berührt habe, hast du angefangen zu jammern.«
»Und diesmal passiert das mit dem Jammern, wenn du sie nicht endlich berührst.«
Sie küssten sich. Erst vorsichtig, dann immer forschender und irgendwann fordernd, drängend, bevor sie ausgehungert, wie sie waren, übereinander herfielen. Ihr Liebesspiel dauerte den ganzen Nachmittag. Gegen 18:00 Uhr schlich Andrea auf ihr Zimmer. Sie hatten entschieden, ihre Liaison vorerst geheim zu halten. Trotzdem waren beide aufgeregt wie frisch verliebte Teenager und konnten es nicht erwarten, sich um halb acht in der Bar zur offiziellen Verabschiedung durch Prof. Jones wiederzusehen.
Wie nicht anders zu erwarten, war Prof. Jones auf die Minute pünktlich in der Hotelbar erschienen. Lennard war schon eine Viertelstunde früher in der Bar gelandet und hatte sich mit Brigitte und Jack einen Drink gegönnt. Andrea war kurz vor Jones hereingeschneit und hatte sich gleich dazugesellt. Als sie sich neben Lennard schob, war ihre Hand kurz über seinen Arm gefahren. Ein angenehmes Prickeln durchzuckte seinen Körper.
Jones wurde natürlich sofort über die Ereignisse der Nacht informiert. Er war schockiert. Nicht wegen der Gefahr, in der Andrea geschwebt hatte, sondern wegen der vagen Möglichkeit, dass mit dem Anschlag die gesamte Expedition torpediert werden sollte.
Man merkte ihm an, wie froh er sein würde, wenn sich alle Teilnehmer in wenigen Stunden an Bord der Rita befänden und damit aus der Gefahrenzone heraus waren. Das galt natürlich insbesondere für Andrea.
Das Buffet, welches an diesem Abend aufgefahren wurde, war phänomenal und übertraf sogar die Gaumenfreuden der vergangenen Abende. Alle Teilnehmer ließen es sich schmecken und scheinbar schwirrte das Wort Henkersmahlzeit dabei nur Lennard durch den Kopf.
Gegen 22:00 Uhr war es dann soweit. Jones schlug gegen sein Glas, um die ungeteilte Aufmerksamkeit des Teams zu bekommen. Nachdem er noch mal auf die besondere Bedeutung und Rolle der National Geographic Society eingegangen war, wandte er sich einem Hotelangestellten zu, der mit einem Tablett Cachaça, jenem typischen brasilianischen Zuckerrohrschnaps, den Raum betreten hatte. Jones nahm ein Glas und wartete, bis alle Teilnehmer versorgt waren. Dann hob er sein Glas, prostete allen zu und sagte: »Auf eine erfolgreiche Expedition Fawcett 2013 und eine glückliche Heimkehr.«
Die Teilnehmer wiederholten seine Worte und tranken dann ihren Cachaça in einem großen Zug. Wie es der alte Brauch verlangte, wurden die leeren Gläser dann in dem Kamin an der Wand zerschmissen.
Jetzt hatte die Expedition offiziell begonnen. Jones verabschiedete sich noch von jedem persönlich und verschwand dann mit einem Taxi zu seinem Hotel. Auf die Gruppe wartete ein Kleinbus, der sie zur Rita brachte.
Alle waren vor Abenteuerlust und Neugier schier elektrisiert. Jetzt ging es also los zu einem der letzten, geheimnisvollen schwarzen Flecken auf unserem Planeten, von denen der Schriftsteller Joseph Conrad ach so gerne doch noch mehr gehabt hätte.
Gegen 5:00 Uhr morgens legte die Rita ab. Fast alle Expeditionsteilnehmer schliefen ruhig in ihren Kabinen, nur Lennard und Andrea standen eng aneinander geschmiegt an der Reling und betrachteten die Lichter der Stadt. Mit gedrosselten Motoren ließ sich die alte Dame gemächlich von der Strömung des Rio Negro zu dessen Einmündung in den Amazonas tragen.
Schon bald verblassten die Lichter und Geräusche der Stadt und die ganz eigene Magie des großen Stroms und des Regenwaldes nahm sie gefangen. Das Abenteuer hatte begonnen.