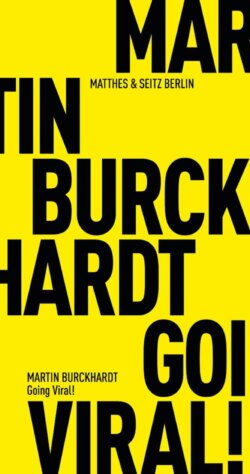Читать книгу Going Viral! - Martin Burckhardt - Страница 7
Krieg
ОглавлениеStell dir vor, es ist Krieg, aber niemand hat ihn erklärt. Niemand hat den vermeintlichen Angriff mit der Erklärung beantwortet, man schieße zurück. Es gibt keinen Schuldigen, der satisfaktionsfähig wäre. Clausewitz, der den Krieg auf die Urszene des Zweikampfes zurückgeführt hat, wäre ratlos in Anbetracht eines Gegners, der durch Abwesenheit glänzt. Tritt der Ernstfall ein, stirbt der Betreffende nicht von der Hand eines Feindes, sondern ertrinkt in der eigenen Lunge, überwältigt von einer Überreaktion des eigenen Immunsystems. Man kann frohlocken, dass es die Ungläubigen trifft oder die alten, weißen Männer, aber diese Haltung ist so töricht wie der Spott der Normannen, die sich zu den Zeiten der Pest darüber mokierten, wie schnell ihre bretonischen Nachbarn dahingerafft wurden. Den Gegner bekümmert es nicht, welcher Religion, welcher Ideologie oder welcher privilegierten Kaste ich angehöre. Er schlägt zu, unterschiedslos. Nein, er schlägt nicht einmal zu, sondern überlässt die Kampfhandlungen mir. Wenn mein Schutzschild zu meinem ärgsten Feind werden kann, so deswegen, weil es nicht für diese Form der Kriegsführung gewappnet ist. Stattdessen wendet es sich gegen mich selbst und wird zur Autodestruktion, ähnlich widersinnig wie ein Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Nein, dieser Krieg ist nicht erklärt worden – und er wird nicht erklärt werden können.
Wie man weiß, beginnt der Krieg dort, wo die Zwiesprache endet. Befremdlich bloß: Es hat gar keine Zwiesprache gegeben, keine Auseinandersetzung, nichts. Gewiss, vor Jahren einmal hat sich eine Kommission der pandemischen Drohung gewidmet, aber niemand hat sich für die Ergebnisse ihres Nachdenkens interessiert. So gering war das Interesse, dass man, um Lagerkosten zu sparen, sich all der Schutzmaterialien entledigte, der Visiere, Masken, Schutzanzüge. In jedem Fall ist der Krieg zuallererst – eine Diskurskatastrophe. Indem er (als drohender Fremdkörper) in unsere Gegenwart tritt, lässt er die Sprachlosigkeit laut werden. Umgekehrt lassen die Slogans von gestern eine schrille, unerträgliche Leichtfertigkeit durchklingen. Gewiss, man sieht sie noch immer, die alten Bekannten, die unsere Talkshows bevölkern. Jedoch muten ihre Vorkriegsweisheiten wie ein nachblubbernder Motor an, das Gebrabbel eines Greises, der nur mehr vor sich hin bramarbasiert. Wenn das erste Opfer des Krieges die Wahrheit ist, müssten wir eingestehen, dass all das, was wir für wahr oder sozial akzeptabel gehalten haben, sich in Schall und Rauch aufgelöst hat. Es hat uns die Sprache verschlagen. Das ist die Lektion. Dass sich nichts mehr von selbst versteht, sondern dass wir uns auf die Umwertung aller Werte einstellen müssen. Fair is foul and foul is fair! Gewiss ist nur: Der Ernstfall ist da – und es ist gleichgültig, mit welchen Attributen wir ihn belegen. Nein, ärger noch: Was gestern gut und wünschenswert war, gilt heute als ärgste Gefahr. Haben wir die gesellschaftliche Nähe gepredigt, ist Distanz zur höchsten Bürgerpflicht avanciert. Selbst der freundlichste, durch und durch gut meinende Nachbar wird plötzlich als Gefährder, als potenzieller Virenträger betrachtet! Die Ortlosigkeit des Krieges schlägt uns mit dem Gefühl umfassender Wehrlosigkeit. Mag sein, dass wir uns der Paranoia, mit ihren überschießenden Angstattacken, zu erwehren vermögen, dennoch ist die Schlussfolgerung bitter: Nicht wir entscheiden darüber, was richtig und falsch ist, sondern – ja, wer? Die Umstände? Aber die Umstände, die allerlei Unbekannte enthalten, laufen auf nichts Geringeres als eine Form der Notstandserklärung hinaus. Ach, wären doch wenigstens die Frontlinien klar! Hat uns die asymmetrische Kriegsführung gelehrt, dass der Terror sich in der Gestalt des Schläfers verbirgt, so lauert die Gefahr nun allüberall. Es sind nicht die Menschen allein, auch ihre Spuren sind eine Bedrohung. Der Terror klebt an der Türklinke, am Ziffernblock des Bankautomaten, am Griff des Einkaufswagens. Er senkt sich in die Psyche hinab, als Memento all der Augenblicke, da man sich einer unkalkulierbaren Gefahr ausgesetzt hat. Selbst dort, wo man sich eremitengleich gegen die Außenwelt abschottet, ist man nicht sicher. Das Klingeln des Paketboten, der etwas für einen Nachbarn abgeben will. Werde ich öffnen? Jede Öffnung zur Außenwelt ist eine offene Flanke. Und all diese Momente, da man sich für die Außenwelt geöffnet hat, nähren die Befürchtung, dass man dem Feind Einlass gewährt hat, dass er sich über die Schleimhäute eine Schneise ins Körperinnere geschlagen, dass er das Atemzentrum in seinen Besitz gebracht hat. Nein, das Einer-im-andern ist keine Metapher, vielmehr beschreibt es (als Nachtseite der Netzwerkgesellschaft) das Wesen der Pandemie. Das drohende Inferno: der Feind im eigenen Leib. Der Feind, der sich an jedem Atemzug nährt. Macht er sich als Kratzen im Hals bemerkbar, ist es zu spät. Selbst wenn ich mich gesund und unversehrt wähne, mag ich längst infiziert sein. Ohne es zu wissen, bin ich zum Fremdkörper geworden, der seine Umgebung bedroht. In diesem Umschlag ist selbst die Möglichkeit des Heldentods dispensiert, ist es unmöglich, dass man sich für seine Liebsten aufopfert. In einer reductio ad absurdum wird die eigene Existenz auf die nackte Körperlichkeit reduziert – Absicht, Wille und Motivation geraten zu bedeutungslosen Anhängseln. Wenn es eine res cogitans gibt, so liegt sie allein in der Apparatur, die das Testergebnis ausspuckt. Die Drohung, dass ich positiv sein könnte – und die Unmöglichkeit, diese Frage selbst beantworten zu können. In diesem Sinn souffliert mir der Feind jene Unsäglichkeit, welche die Überbietungsmaschine, Hollywoods Traumfabrik, verlässlich ausgespuckt hat: »Du bist tot. Du weißt es bloß nicht.« Der Tod hat keine Adresse – er ist ortlos, allgegenwärtig. Und hat er sich meiner bemächtigt, folgt er mir auf Schritt und Tritt. Mit diesem Gegner zu kämpfen heißt, sich mit dem eigenen Schatten herumzuschlagen. Das ist neu: dass die Intimität, das Bei-sich-Sein zur Kampfzone wird: der Griff ins Gesicht, das Reiben der Augen, all die Automatismen, die man nicht zu kontrollieren vermag. Als der Physiker Richard Feynman die Ära der Nanophysik mit den Worten There’s plenty of room at the bottom einleitete, hat er en passant die Verlagerung der modernen Kampfzone deutlich gemacht: vom Plusultra (der Außenwelt) zum Plusintra (der Innenwelt). Das ist die Lektion. Der Krieg findet im eigenen Innern statt, in radikaler Einsamkeit. Und das letzte, was ich dabei zu Gesicht bekommen werde: das Visier eines Menschen, der sich, zur Wehr gegen meine letzten Atemzüge, in einen Schutzanzug gehüllt hat.