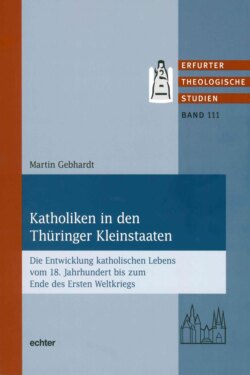Читать книгу Katholiken in den Thüringer Kleinstaaten - Martin Gebhardt - Страница 12
ОглавлениеA. KIRCHE UND GESELLSCHAFT IN THÜRINGEN – HISTORISCHE GRUNDLAGEN IM ÜBERBLICK
1. Thüringen – Land der Kleinstaaten und der Reformation
Die thüringische Landschaft wies als das für sie typisches Merkmal eine Vielzahl von Edlen und Adelshäusern auf, die ihren Eigeninteressen nachgingen und bestrebt waren, eigenständige Territorien aufzubauen.21 Erst das Geschlecht der Ludowinger konnte eine Vorrangstellung als regierende Landgrafen erreichen. Ihre Herrschaft ist dennoch nicht mit der Region Thüringen gleichzusetzen.22 Nach einer geschichtlich kurzen Episode mit herausragenden Personen wie Ludwig IV. (1200-1227)23 und der Heiligen Elisabeth (1207-1231), endete die Ludowinger Herrschaft durch Aussterben im Mannesstamm im Jahr 1247.24
Das Machtvakuum führte zum Thüringisch-Hessischen Erbfolgekrieg 1247-1264, der nicht einem anderen thüringischen Adelshaus, sondern einer „ausländischen“ Macht die Herrschaft sicherte. Das Haus Wettin setzte sich in den Streitigkeiten durch und stieg zu einer der bedeutendsten europäischen Mächte auf. Im Weißenfelser Vertrag von 1249 wurde dem Wettiner Heinrich dem Erlauchten (1221-1288) das Erbe der Landgrafschaft für den Thüringer Teil zugesprochen.25 Damit trat das sächsische Adelshaus in eine enge Verbindung zur Thüringer Geschichte und prägte die Geschicke des Landes bis zum Untergang der Monarchie im Jahr 1918. Diese Verbindung degradierte Thüringen zu einer Randprovinz Sachsens. Auch den Thüringern muss der wettinische Machtanspruch als fremde Machteinwirkung erschienen sein, sind doch immer wieder Vorbehalte zu der sächsischen Fremdherrschaft nachweisbar.26
1.1 Thüringen – Land der Kleinstaaten
Im Jahr 1485 teilten die Brüder Ernst (1441-1486) und Albrecht III. (1443-1500) die wettinischen Gebiete unter sich auf, so dass eine ernestinische und eine albertinische Linie entstanden.27 Den Albertinern fiel dabei die Mark Meißen zu. Die Ernestinern, die auch die Kurwürde28 innehatten, herrschten über weite Teile Thüringens und die sächsischen Kurgebiete.29 Im Zuge der religiösen, politischen und militärischen Auseinandersetzungen der Reformationszeit mussten die Ernestiner die Kurwürde und die damit verbundenen Kurländer an die Albertiner abtreten.30 Zwar war die Macht der Ernestiner auf Reichsebene extrem geschwächt, doch konnten sie die bestimmende Größe in Thüringen bleiben. Die 1553 von Herzog Johann Friedrich (1503-1554) festgesetzte Unteilbarkeit des ernestinischen Besitzes, welche die verbliebene politische Macht erhalten sollte, wurde unter seinem Sohn Herzog Johann Friedrich II. (1529-1595) aufgegeben, der 1566 in Weimar die Teilung der Einkünfte zwischen ihm und seinem Bruder Herzog Johann Wilhelm (1530-1573) vereinbarte.31 In der Folge kam es zu mehreren Erbteilungen und zeitweisen Wiedervereinigungen der Ländereien. Hieraus erwuchs eine unübersichtliche Zerrissenheit und eine ständige Veränderung der ernestinischen Herrschaftsgebiete.32 Die Thüringer Kleinstaaterei steht damit in direktem Zusammenhang zu den ernestinischen Territorialteilungen und den daraus entstandenen Herzogtümern.33
Darüber hinaus konnten sich innerhalb des ernestinischen Einflussbereichs weitere Territorialherrschaften behaupten, die die politische Teilung Thüringens verstärkten. Es waren vor allem zwei Geschlechter, die sich gegenüber der sächsischen Machtpräsenz etablierten: Zum einem das Haus Schwarzburg und zum anderen das Geschlecht derer zu Reuß.34
Die Herkunft der Schwarzburger lässt sich nicht bis ins Detail klären. Fest steht, dass schon um das Jahr 700 erste Vorfahren der Stammlinie in Thüringen vorzufinden waren und die Familie zum Thüringer „Altadel“ gehörte.35 Die Herrschaft des Hauses beruhte wahrscheinlich bereits im 8. Jahrhundert auf zwei Standorten, die im späteren Verlauf namensgebend für die Familie bzw. für sich aus ihr ergebenen Zweige werden sollten: die Käfernburg bei Arnstadt und die Schwarzburg, im Schwarzatal des Thüringer Waldes gelegen.36 Eine Unterscheidung in zwei selbstständige Familien ist ab dem 12. Jahrhundert nachweisbar, jedoch nur von kurzer Dauer, da die Käfernburger im 14. Jahrhundert ausstarben.37
Die Wettiner versuchten mehrfach den Schwarzburgern die Reichsstandschaft38 abzusprechen. Nur eine direkte Verbindung zum Reich und dem Kaiser konnte die Adelsfamilie in ihrer Eigenständigkeit bewahren und ihren Anspruch als souveräne Herren garantieren. Unter Kaiser Maximilian II. (1527-1576) wurde den Schwarzburgern die Viergrafenwürde bestätigt und ihnen unter Rudolf II. (1552-1612) sämtliche Rechte zu Sitz und Stimme in der Reichsversammlung zugebilligt.39 Die Reichsunmittelbarkeit des Hauses bedeutete jedoch nicht, dass damit auch alle anderweitigen Verpflichtungen und Abhängigkeiten aufhörten, denn die Schwarzburger waren Reichs- und Landstände und als letztere blieben sie auch den Wettinern verpflichtet.40
Auch die Schwarzburger unterschieden sich in mehrere Erbschaftslinien. Im Stadtilmervertrag von 1599 wurde die Aufteilung des Gesamtbesitzes geregelt: danach unterteilte sich das Haus Schwarzburg in eine Rudolstädter- und eine Sondershäuserlinie, die jeweils Besitzungen in der Ober- und Unterherrschaft verwalteten.41 Auch nach dem Stadtilmervertrag gab es weitere Erbschaftsteilungen, sie sich dann auf die jeweilige Linie beschränkt blieb.
Der Aufstieg des Hauses Reuß in den adligen Stand beruhte auf der geschickten Dienstpolitik der Familie.42 Als Vögte verstanden sie es eigene erbliche Besitzungen zu etablieren und ein eigenes Machtzentrum an der Weida, an der sie den gleichnamigen Ort gründeten, zu schaffen.43 Ähnlich den Schwarzburgern konnten die Reußen ihre Herrschaft nur behaupten, indem sie die Verbindung zum Kaiser und der böhmischen Krone eng knüpften.44 Erst dies ließ aus einem Geschlecht von Vögten reichsunmittelbare Herren werden, die letztendlich zu Fürsten mit eigenen Staaten aufsteigen sollten. Im Jahr 1564 teilten die Reußen den Gesamtbesitz in drei zu unterscheidende Erblinien auf: eine ältere Linie, mit der Herrschaft Untergreiz, eine mittlere Linie mit der Herrschaft über Obergreiz und eine jüngere Linie mit dem Besitz der Herrschaft Gera.45 Die Aufteilung in drei Linien beendete die Erbteilungspraxis in der Folgezeit jedoch nicht, sondern beschränkte diese auf den jeweiligen Familienzweig, mit der Folge, dass sich die Zersplitterung der Ländereien verstärkte.
Doch nicht nur Erbteilungen der Adelshäuser führten zu einem territorialen Flickenteppich.46 Auch die kirchlichen Besitzungen des Mainzer Erzstifts47, welche die bedeutendste Metropole Thüringens, Erfurt48, umfasste und das auch das Eichsfeld besaß, verstärken die Unterteilung.49
1.2 Thüringen – Land der Reformation
Thüringen ist Ausgangspunkt einer der größten Umbrüche in der europäischen, besonders aber der deutschen Geschichte geworden. Die von Martin Luther ausgehende bzw. von ihm auf vielfältigem Weg angestoßene Kirchenreform war in besonderem Maße an die wettinische Herrschaft gebunden: Thüringen als Teil des sächsischen Machtraumes wurde zum Ausgangspunkt bzw. mittragenden Faktor der Reformation.50 Sie veränderte Thüringen in seinen Herrschaftsgebieten nachhaltig. Eine umfassende Darstellung der entsprechenden Zeitumstände kann an dieser Stelle jedoch nicht erfolgen.51 Stattdessen soll auf das neue Miteinander von Staat und Kirche aufmerksam gemacht werden, das fortan die Thüringer Staatenwelt prägen sollte: Das evangelische Landeskirchentum.
Die Schutzfunktion des sächsischen Kurfürsten Friedrich III., genannt Friedrich der Weise (1463-1525), über Luther und seine Lehre deutet bereits an, wie stark und wichtig die Rolle des Staates innerhalb der Reformation war. Nach dem Tod des Kurfürsten, 1525, hatte die bis dahin nur passiv ausgeübte, die Reformation fördernde Politik ein Ende und wurde durch eine aktiv in die Kirchenreform eingreifende Herrschaftsausübung abgelöst.52 Friedrichs Bruder, Kurfürst Johann der Beständige (1468-1532), ergriff entschieden Partei für Luthers Lehre und unterhielt zum Wittenberger Theologen eine gute Beziehung.
Der Bruch mit dem alten Glauben entsprach dabei einem indirekten Bruch mit Kaiser Karl V. (1500-1558), der den katholischen Glauben verteidigte, auch um hiermit die Einheit des Reiches zu sichern. Kurfürst Johann scheute zunächst eine Konfrontation mit dem Kaiser, nicht nur aus staatsdynastischen, rechtlichen und militärischen, sondern auch aus Gründen der Gefolgschaft. Für andere Fürsten stellte die neue Lehre jedoch ein willkommenes Mittel zur Profilierung gegenüber dem Kaiser dar.53
In Kursachsen entwickelten sich erste strukturschaffende Elemente für den Umgang mit der neuen Kirchensituation. Die allgemeine Tendenz zur Staatenbildung und der Aufbau eines sich vom alten Vasallenwesen abhebenden Verwaltungssystems zum Beginn des neuen Jahrhunderts begünstigte diese Situation.54
Als im Jahr 1527 Kursachsen eine Landeskirche wurde, oblag die Leitung dieser fortan dem Kurfürsten. Es war zunächst eine Notlösung, die eben durch die verworrenen Verhältnisse nötig wurde. Die Kirche sollte demnach zwar vom Staat unabhängig sein. Da aber der weltliche Fürst nach göttlichem Willen Herrscher sei, stehe ihm auch in kirchlichen Fragen Verantwortung und Entscheidungskompetenz zu.55 Hatte also die kirchliche Eigenbestimmung versagt und war diese nicht in der Lage die christliche Lehre wirksam zu schützen, kam es dem Landesherrn zu, in die Belange der Kirche einzugreifen und diese zu ordnen.56
Dass Landesherren Einfluss auf die Kirche vor Ort ausübten, war schon in vorreformatorischer Zeit üblich.57 Durch Sicherung von päpstlichen Privilegien und Stiftung geistlicher Einrichtungen vermochte es auch der katholische Fürst, Einfluss auf die kirchlichen Verhältnisse seines Landes zu nehmen.58 Die Schaffung eines Kirchenregiments durch die sächsischen Kurfürsten ist bereits vorreformatorisch in Grundsätzen nachweisbar und steht in engem Zusammenhang eines sich wandelnden Bildes der Landesherrschaft.59
Im Jahr 1526 ordnete Kurfürst Johann der Beständige eine umfassende Prüfung der kirchlichen Verhältnisse an.60 Bei diesen Visitationen61 handelte es sich um eine grundlegende Erhebung der vorhandenen Geistlichkeit, der kirchlichen Güter, der Besitzstände der Geistlichen, aber auch der Klöster62 und deren geistlichen Zustandes. Damit verschoben sich klar die bisherigen Kompetenzen. Luther verkörperte wie kein anderer den Umbruch, doch wurde er zunehmend zu einer Randfigur. Der Staat war es, der fortan administrativ eingriff und damit die Reformation lenkte.63 Dazu sah er sich auch in der Verantwortung, denn die Disziplinierung der Bevölkerung, auch in ihrem moralischen Lebenswandel, wurde in die Kompetenz des Landesherrn gelegt.64 Die Reform der Kirche wurde zunehmend eine Reformation der Fürsten, wenn auch nicht eine absolute.65 Die drängendsten Fragen im Land mussten gelöst werden. Von daher war eine neutrale Haltung des Landesherrn nicht möglich und eine Lösung auf Reichsebene schien nicht realisierbar.66 Die von Johann angeordneten Visitationen waren somit auch Mittel der Politik und Grundlage der Umformung Kursachsens zu einer Landeskirche.67 Kirche wurde damit nicht nur zu einem Organ des Staates, sondern auch im mitteldeutschen Raum eine Kirche lutherischer Ausprägung: katholische Geistliche, wie auch andere protestantische Strömungen, hatten nur die Möglichkeit sich der allgemeinen lutherischen Auffassung anzuschließen.68 Die staatliche Kirchenpolitik, ausgestattet mit der kurfürstlichen Instruktion zu den Visitationen, erlassen am 16. Juni 152769, die es in dem Sinne vorher nicht gab, wurde zum Garanten des Luthertums.
Schrittweise wurde eine durch den Staat gelenkte kirchliche Verwaltung aufgebaut und durch den Erlass von Kirchenordnungen70 eine neue Rechtsstruktur geschaffen. Aus Aufsichtsbereichen der Visitatoren wurden kirchliche Verwaltungsbezirke, so genannte Superintendenturen, die, da sie „staats-kirchliche Einrichtungen“ waren, eine vollkommen neue Kirchenstruktur entwarfen. In Thüringen entwickelte sich somit die Superintendenturverfassung.71
Diözesangrenzen katholischer Ortskirchen überschritten weltliche Territorien. Einer lutherischen Landeskirche, die Staatskirche war, war dies nicht möglich.72 Die Verbindung von Kirche und Staat war konkret eine Verbindung von Landesherrn und Kirche. Der Kurfürst, später die Fürsten, übten ein landesherrliches Kirchenregiment aus.73 Über die Visitationen und die Bildung von Superintentaturen, entwickelte sich eine konsistoriale Ordnung der inneren Kirchenverwaltung. Von einer Notstandssituation, die dem Landesherrn gewisse Kompetenzen zusprach, kann unter dieser Perspektive nicht mehr gesprochen werden. Vielmehr handelt es sich um den vollständigen Übergang in die staatliche Ordnungsgewalt fast sämtlicher kirchlicher Belange.74 Philipp Melanchton (1497-1560) förderte die Kompetenzen des Landesherrn noch weiter, indem er diesem die „custodia primae tabulae“ zuwies und diesen somit zum Hüter von rechter Lehre und Kult erklärte.75
Der Augsburger Religionsfrieden von 1555 manifestierte die Zuordnung von Landesherrn und Religion in besonderer Weise.76 Den Fürsten stand das „ius reformandi“ zu, das ihnen einräumte, für ihr Territorium die Konfession frei zu bestimmen und nach eigenem Willen auch wieder zu verändern.77 Sollte ein Fürst mit seinem Territorium zum Augsburger Bekenntnis wechseln, so erlosch die Kompetenz des vormals zuständigen katholischen Bischofs für die kirchliche Ordnung dieses Gebietes, in dem fortan ein Landesherrliches Kirchenregiment galt.78 Dieses auszuüben, oblag den Konsistorien als staatlicher Behörde.79
Die Ereignisse im ernestinischen Thüringen griffen auch auf die Herrschafts- und Einflussgebiete der Schwarzburger und Reussen über. Die politische Konkurrenz zu den Wettinern und das Suchen der Schwarzburger nach reichsunmittelbarer Bestätigung ihrer Herrschaft beim Kaiser lies zunächst Heinrich XXXI. von Schwarzburg-Blankenburg (1473-1526) der Reformation skeptisch gegenüberstehen.80 Das Gedankengut und die Dynamik der Reformation fand dennoch Ausbreitung in der Bevölkerung. Beachtenswert ist, wie verschieden die Herrschaftslinien der Schwarzburger darauf reagierten: Brachte der älteste Sohn Heinrichs XXXI., Graf Günther XL. (1499-1552), der die Herrschaft Sondershausen 1526 erbte und diese 1538 um Frankenhausen erweitern konnte, der Reformation anfangs ebenfalls Bedenken entgegen, führte sein Vetter Heinrich XXXII. (1499-1538) ab 1530/1531 diese im Bereich der Herrschaft Arnstadt-Blankenburg, ein.81 Erst als Günther ihn beerbte öffnete er, auch unter dem Druck der Wettiner, das gesamten Herrschaftsgebiet der Reformation. Ab 1540 bekannten sich die Schwarzburger Gebiete zu Luthers Lehre.82
Die Abhängigkeit der Reussen von ihren ernestinischen Lehnsherrn galt auch in der Religionspolitik. Die Reformation war in ihren Anfängen demnach eine Entscheidung des Kurfürsten: Die Visitationen Kursachsens wurden auf Anordnung Johann Friedrichs auch in den Reussischen Landen durchgeführt.
Die neue Lehre veränderte die bestehende Gesellschaft tiefgreifend. Sie wurde zum festen Bestandteil einer neuen staatlich-gesellschaftlichen Ordnung, in der die Kirche ein Organ des Staates wurde. Katholisches Glaubensleben erlosch damit in den Thüringer Herzog- und Fürstentümern vollständig.
Festsetzung und Etablierung konfessioneller Verhältnisse im Reich
Die Folgen der Reformation waren weitreichend. Die Herausbildung der konfessionellen Unterschiede war ein komplexer Vorgang und blieb oftmals undifferenziert.83
In der Vermengung der konfessionellen Auseinandersetzung, der damit verbundenen gesellschaftlichen Unruhen und der politischen Neuordnung des Reiches erwuchs ein Konfliktpotential, das Europa, besonders aber die deutschen Länder, in eines der größten Unglücke ihrer Geschichte führen sollte: in den Dreißigjährigen Krieg. Nach dreißig Jahren Krieg und Elend musste nicht nur der politische Friede hergestellt werden, sondern es wurde auch unabdingbar, eine einvernehmliche Lösung im Bereich der konfessionellen Toleranz zu finden. Es musste ein Kompromiss sein, der es ermöglichte, zumindest das religiöse Konfliktpotential zu mindern.
Im Westfälischen Frieden von 1648 wurden die konfessionellen Verhältnisse im Reich dauerhaft geregelt. Erst im Zuge der napoleonischen Kriege löste eine neue Rechtsstruktur die bis dato bewährte Ordnung ab. Die Vertragsartikel des Westfälischen Friedens umschrieben das konfessionelle Miteinander insbesondere auch dort, wo katholisches und protestantisches Bekenntnis direkt zusammentrafen. Die Ansiedlung von Katholiken in den lutherisch geprägten Territorien Mitteldeutschlands ist demnach in den Rahmenbedingungen dieses Friedensvertrages zu betrachten.
Ein Schlüsselbegriff stellt das sogenannte „Normaljahr“ dar. Dieses setzte mit dem Jahr 1624 eine entscheidende Marke, an der sich die künftige Ordnung des Reiches festmachen sollte.84 Auf den Ist-Zustand der politischen und konfessionellen Ordnung des genannten Jahres einigten sich die Vertragspartner als Punkt des künftig angestrebten „Status quo“. Diese Jahreszahl markiert einen Kompromiss, der weder die katholische noch die protestantische Seite bevorzugte.
Ausdrücklich wurde die Gleichwertigkeit der einzelnen Bekenntnisse bekundet und die zwangsweise Ordnung des „cuius regio – eius religio“ gelockert. Der Religionsfriede von 1555 wurde somit ausdrücklich bestätigt und außerdem um das calvinische Bekenntnis erweitert, das fortan auch anerkannt war.85
Große Bedeutung erlangte der Friedensvertrag für die konkrete religiöse Praxis: War es bis dahin streng genommen nicht gestattet als Katholik in lutherischem Gebieten seinen Glauben auch nur im Privaten nachzugehen, und natürlich auch umgekehrt, so wurde dies nun der Einzelperson zugestanden.86
Zwar war die Konfession des Landes grundsätzlich festgelegt und daher auch das „exercitium publicum religionis“, doch wurde die private Glaubenspraxis der Fremdkonfession zugebilligt, die sich auch durch private Hausandachten (devotio domestica) äußern durfte.87 Für Katholiken in Mitteldeutschland hätte dies bedeutet, dass man auch ihnen dies zugestanden hätte und sie zur privaten Glaubensausübung keinerlei Genehmigung des Landesherrn bedurften. Allerdings ist das Stichjahr 1624 zu beachten. Der entsprechende Gesetzestext ist nur anzuwenden, wenn zum 1. Januar 1624 auch Katholiken im Staat lebten.88 Da dies im Falle der Thüringer Kleinstaaten nicht der Fall war bzw. ohne öffentliche Wahrnehmung blieb, traten die Bestimmungen des Westfälischen Friedens diesbezüglich nicht in Kraft, so dass das Normaljahr für Katholiken diesbezüglich in den Thüringer Kleinstaaten nicht galt.89 Die Konsequenzen daraus lassen sich an der später geübten Praxis innerhalb der Thüringer Herrschaftsgebiete ablesen: Die Abhaltung katholischer Andachten, auch im Privaten, wurde erst nach Anfrage und darauffolgender Genehmigung des Landesherrn ermöglicht.90
Die Bestimmungen des Westfälischen Friedens waren in jeder Hinsicht ein Kompromiss. Die ansatzweise Durchbrechung des „cuius regio – eius religio“ und die Duldung einer anderen Konfession sind damit nicht als freiwilliger Schritt zur Toleranz, sondern als einfache Notwendigkeit zu werten.91 Deutlich wird dies auch am sichtbaren Willen konfessionell einheitliche Gebiete zu schaffen. Der Landesherr hatte demnach das Recht, nach einer einzuhaltenden Frist, Mitglieder anderer Konfessionen des Landes zu verweisen.92 Politik blieb demnach auch künftig Religionspolitik und deutlich an den Landesherrn gebunden, der somit weiterhin die Konfession seiner Untertanen, wenn auch nun abgeschwächt, bestimmen konnte. Viele Menschen waren „Grenzgänger“ zwischen den Konfessionen, ja verbanden in sich die verschiedenen Bekenntnisse und wiesen eine gewisse konfessionelle Hybridität93 auf. Die Konversion eines Landesherrn war daher nicht unüblich und stellte oftmals ein Mittel der Außen- und Wirtschaftspolitik dar.94 Ein daraufhin erforderlicher Konfessionswechsel seiner Untertanen war jedoch mit den neuen Bestimmungen ausgeschlossen worden.95
Offen blieb ferner die Frage der katholischen Diözesanordnung. Man verständigte sich auf einen Kompromiss, der bis zur Beendigung der Glaubensspaltung gelten sollte. In den Gebieten der neuen Lehren blieb die Jurisdiktion der katholischen Bischöfe bis auf Weiteres suspendiert. Formal bestanden sie damit aber immer noch weiter.96 Die geistlichen Territorien wurden teilweise zu Gunsten weltlicher Herrscher aufgehoben, worin erste Ansätze einer Säkularisation zu erkennen sind.97 Die Jurisdiktion über Diözesangebiete, deren Bischofsitze untergingen, ging nach katholischem Verständnis direkt auf den Papst über, der die protestantischen Gebiete Norddeutschlands, aber auch Skandinaviens, zu einer Nordischen Mission zusammenfasste und diese 1622 der „Congregatio de Propaganda Fide“ unterstellte.98 Zur Verbesserung der administrativen Struktur wurde 1667 ein Apostolisches Vikariat für die Nordische Mission99 installiert, dessen Apostolischer Vikar einem Nuntius zugeordnet war.100 Fernerhin entstand bereits 1743 ein gesondertes Vikariat für das albertinische Kurfürstentum Sachsen, bedingt durch die wachsende Zahl von Katholiken am Hof, des zum Katholizismus konvertierten Kurfürsten und Königs Friedrich August (1670-1733), welches für den Ostthüringer Raum von besonderer Bedeutung werden sollte.101
Grundsätzlich war die Bedeutung der Apostolischen Vikariate der Nordischen Mission für Thüringen nur gering, da eine ruhende Jurisdiktion der Mainzer und Würzburger Bischöfe angenommen werden muss. Einzig die Ostthüringer Gebiete der Herren zu Reuß und die Gegend um Altenburg entzogen sich dieser Zugehörigkeit.
Die Bestimmungen des Westfälischen Friedens hatten für katholisches Leben in den Thüringer Herrschaften keine Auswirkung. Die im Friedensvertrag ausgehandelte Festlegung des „Normaljahres 1623“ blieb für die Katholiken bedeutungslos, da 1623 keine katholischen Christen vor Ort lebten. Auf diesem Hintergrund wird deutlich, vor welchen Problemen Katholiken in Thüringen standen. Entgegen dem sonst geltenden Recht waren sie es, die jeweils neu ihre Position im Staat aushandeln mussten. Ab Ende des 18. Jahrhunderts, besonders aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist dies für fast alle thüringischen Kleinstaaten belegbar. Von daher ist die Entwicklung der katholischen Gemeinden Thüringens eng mit der Geschichte des 19. Jahrhunderts verknüpft.
2. Thüringen im „langen“ 19. Jahrhundert102
Die fortbestehende politische Zersplitterung Thüringens im 19. Jahrhundert wirkte wie ein Gegenbild zu den wachsenden Einigungsbestrebungen in Deutschland.103 Dabei brachte sie nicht nur Nachteile mit sich: Beispielsweise hatte die politische Zerrissenheit nicht nur eine machtpolitische Randstellung Thüringens zur Folge, sondern auch dessen überragende Stellung im künstlerischen und kulturellen Bereich.104 Die politische Bedeutungslosigkeit und die kleinstaatliche Verwaltung, die wie nirgends sonst mit einem ausgeklügelten Beamtensystem105 gelenkt wurde und sich nicht nur auf eine Herrschaft106 von Gottes Gnaden aufbauen konnte, sondern moderne Züge in der Verwaltung annahm, führten zu einer ausgeprägten Förderung der Kunst.107 Diese machte Thüringen zu einem Zentrum des Denkens und der Kultur, allerdings im Rahmen der Kleinstaatlichkeit und der damit oftmals in Verbindung stehenden kleinbürgerlichen Gedankenwelt. Demnach war es nicht nur eine persönliche Vorliebe der Thüringer Fürsten für Kunst und Kultur, sondern letztlich deren einzige Möglichkeit ein Eigenprofil zu entwerfen, das auf politischer Ebene unmöglich war. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) macht dies an seinem Weimarer Herrn fest, (Groß-) Herzog Carl August (1757-1828, reg. 1775-1828): „Der Großherzog war eine dämonische Natur, voll unbegrenzter Tatkraft und Unruhe, so daß sein eigenes Reich ihm zu klein war und das größte ihm zu klein gewesen wäre.“108
Die Thüringer Staaten unterlagen in ihrer Geschichte ständigen Grenzverschiebungen, Neuteilungen und Einverleibungen. Im 19. Jahrhundert stellten sich im Wesentlichen die politischen Strukturen Thüringens wie folgt dar:
Der wettinische Herrschaftsbereich teilte sich in die Herzogtümer Sachsen-Weimar-Eisenach109, Sachsen-Gotha-Altenburg, Sachsen-Coburg-Saalfeld, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Hildburghausen auf. Nach einer Gebietsreform durch den Hildburghäuservertrag im Jahr 1826, die nach dem Erlöschen der Linie Sachsen-Gotha-Altenburg notwendig wurde, verringerte sich diese Zahl und erhielt ihre endgültige Aufteilung bis zum Ende der Monarchie.110 Gotha wurde fortan von Coburg aus in Personalunion regiert. Sachsen-Saalfeld und Sachsen-Hildburghausen wurden dem Meininger Staatsgebiet einverleibt, das dadurch riesige Gebietsgewinne verzeichnen konnte, die das ursprüngliche Territorium fast verdoppelten. Der Herzog von Sachsen-Hildburghausen wurde mit dem wiedergeschaffenen, von Gotha gelösten Herzogtum Altenburg neu versehen.
Dominierend unter den wettinischen Herzogtümern war zu dieser Zeit Sachsen-Weimar-Eisenach, das sowohl in kultureller, als auch in politischer Weise Gotha den Rang in Thüringen ablief.111 Gemeinsam trugen die Herzogtümer das Thüringische Oberappelationsgericht112 und die Universität113, beide mit Sitz in Jena, auf großherzoglich weimarischem Boden.
Stetig auf seine Souveränität bedacht, konnte sich das Haus Schwarzburg, das sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts in zwei Linien aufgespalten darstellte, als einziges, wirklich thüringisches Adelsgeschlecht über Jahrhunderte behaupten. Die Ländereien der beiden Staaten unterteilten sich je in eine Ober- und Unterherrschaft mit den Residenzen in Rudolstadt und Sondershausen.
Im Osten Thüringens, zwischen den beiden wettinischen Herrschaften der Ernest- und Albertiner gelegen, erstreckten sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts vier Staaten der Herren zu Reuß, unterteilt in Reuß ältere und jüngere Linie, letztere umfasste zu diesem Zeitpunkt drei zu unterscheidende Einzelstaaten.114 In Reuß etablierte sich ein Territoriengefüge, das auf Grund seiner geringen Größe kaum überlebensfähig wirkte. Neben diesen einheimischen Mächten beherrschten weiterhin auch auswärtige Herrscher größere Thüringer Gebiete. Aus kirchlicher Perspektive sind insbesondere die kurmainzischen Gebiete interessant, die mit dem Kurfürsten und Erzbischof von Mainz einem katholischen Landesherrn unterstanden. Geografisch zentral gelegen waren hierbei Erfurt und das zur Stadt gehörige Umland.115
Neben dem Erfurter Stadtgebiet besaß Mainz noch das nordthüringische Eichsfeld, das nach Einführung der Gegenreformation fast vollständig zum katholischen Bekenntnis zurückgeführt worden war.116 Zum Jahrhundertwechsel 1800 bestanden diese geistlichen Gebiete noch, fielen jedoch in der beginnenden Säkularisationswelle 1802 an Preußen, das nach kurzer französischer Herrschaft erneut diese Gebiete sich einverleiben konnte. Preußen sicherte sich damit dauerhaft in Thüringen Territorien.117 Als weitere, auswärtige Instanz besaß Hessen-Nassau Gebiete im Thüringer Wald um die Stadt Schmalkalden. Im Jahr 1866 fielen auch diese Gebiete an Preußen.
2.1 Überlebenskampf der Kleinstaaten – Zwischen Souveränität und Auflösung
Die sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts präsentierende Herrschaftsordnung musste sich großen Umformungsprozessen auf europäischer Ebene stellen. Die Napoleonischen Kriege waren hierbei von besonderer Tragweite.
Napoleonische Kriege und Restauration
Nach dem vorläufigen Ende der Monarchie in Frankreich, dem Siegeszug der Französischen Revolution und dem Scheitern ihrer Zurückweisung bzw. Eindämmung durch die europäischen Mächte, auch durch Sachsen-Weimar-Eisenach, das sich durch seinen Herzog Carl August118 am Krieg gegen die Revolutionäre beteiligte, breitete sich der Krieg unter Napoleon Bonaparte (1769-1821) weiter über Europa aus.119
Im Jahr 1802 erfolgte für Thüringen die erste territoriale Veränderung: Preußen schloss mit Frankreich einen Sondervertrag, der es für die Verluste linksrheinischer Gebiete mit geistlichen und reichseigenen Territorien in Deutschland entschädigen sollte.120 Die kurmainzischen Gebiete in Thüringen, die Stadt Erfurt und das Eichsfeld, wurden an Preußen übergeben, das am 21. August 1802 in Erfurt einrückte121 und eine über tausendjährige Zugehörigkeit der Stadt zu Mainz beendete.
Die Herrschaft Napoleons bedeutete Krieg und eine tiefgreifende Umformung der europäischen Machtverhältnisse. Militärisch und politisch hatten die Thüringer Staatsgebiete wenig der französischen Großmacht entgegen zu setzen, aber auch nichts im Interesse Frankreichs zu bieten, so dass eine Angliederung an andere deutsche Staaten als wahrscheinlich schien. Am 8. August 1805 warnte Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen (1763-1834, reg. 1787-1826)122 die Regenten in Meiningen und Coburg123 vor einer drohenden Angliederung an das napoleonische Großherzogtum Würzburg, was sich jedoch als reines Gerücht herausstellte.124 Die Empfindlichkeit mit welcher der Herzog jedoch reagierte, zeigt eindrücklich die Brisanz der damaligen Sachlage, welche die Regierungen der Kleinstaaten veranlasste, vom albertinischen Kurfürstentum Sachsen Beistand zu erbitten. Ein gemeinsames Auftreten gelang den Thüringer Souveränen jedoch nicht. Sachsen konnte letztendlich nicht am Vorabend des Krieges als Bündnispartner gefunden werden und auch eine Eingliederung in den zu gründenden Norddeutschen Bund scheiterte.125
Dem gegenüber baute sich ein französisches Bündnis auf, das den Untergang der alten Reichsordnung besiegeln sollte: die „Confédération de Rhin“, der Rheinbund.126 Am 1. August 1806 erklärten betreffende Staaten ihren Austritt aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und diktierten damit das Ende des Reiches.127 Am 6. August 1806 legte Kaiser Franz II. (1768-1835) die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation nieder.128
Die Suche der Thüringer Kleinstaaten nach einem starken Bündnispartner verlief nur für Sachsen-Weimar-Eisenach erfolgreich. Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach schloss am 4. Oktober 1806, demnach kurz vor der Schlacht bei Jena und Auerstedt, ein Bündnis mit Preußen und galt damit als offizieller Gegner der Franzosen.129
Der Krieg der Franzosen gegen Preußen verlagerte sich auf thüringischen Boden. Berühmt für den Einmarsch Napoleons ist die Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt geworden. Die Franzosen besetzten am 13. Oktober 1806 Jena. Am 14. Oktober 1806 erfolgte der für die Preußen überraschende und letztlich für Napoleon siegreiche Angriff.130
Nach der Schlacht von Jena und Auerstedt begann für Teile Thüringens eine Zeit französischer Herrschaft. Schon am 17. Oktober 1806 wurde Erfurt besetzt, das zwar eine preußische Verteidigung von etwa 10.000 Mann aufweisen konnte, sich aber nicht zum Kampf stellen wollte und am 16. Oktober 1806 kapitulierte.131 Erfurt wurde zum Zentrum der französischen Herrschaft in Thüringen auf Jahre hin. Am 4. August 1807 wurde ein französisches Fürstentum Erfurt errichtet, das am 29. August des gleichen Jahres offiziell von Preußen abgetrennt wurde.132 Die Thüringer Kleinstaaten wurden Mitglieder des Rheinbundes.133
In der Neuaufteilung Europas sollte zunächst Erfurt eine besondere Rolle einnehmen. Die Verhandlungen der beiden großen Kriegsgewinner Frankreich und Russland fanden in der thüringischen Metropole statt. Erfurt rückte für die Zeit vom 27. September bis 14. Oktober 1808 durch den Fürstenkongress in das Zentrum Europas.134
Nach dem Scheitern der Grande Armée auf ihrem Russlandfeldzug und der Niederlage Frankreichs in der Völkerschlacht bei Leipzig am 19. Oktober 1813 sank der Stern Napoleons: Am 31. März 1814 nahmen die alliierten Truppen Paris ein. Napoleons Herrschaft war kurzzeitig beendet. Nach dessen Rückkehr aus der Verbannung von Elba und seiner „Hundert Tage Herrschaft“ erlitt er bei Waterloo am 18. Juni 1815 seine letzte Niederlage.135
Der Sieg über die Franzosen konnte die bis dato vorhandenen Veränderungen in Europa allerdings nicht mehr vollständig revidieren. Ab September 1814 traten im Wiener Kongress die Kriegsgewinner Österreich, Russland, England und Preußen zusammen.136 Dazwischen versuchten die kleineren deutschen Einzelstaaten ihre Interessen zu wahren. Die restaurative Ausrichtung des Kongresses diente klar der Wiederherstellung der Macht der europäischen Monarchien und dem Verdrängen revolutionärer Ideen, doch schufen die Ereignisse zu Beginn des Jahrhunderts nicht umkehrbare Fakten, insbesondere für das Ende von Reich und Reichskirche.
Das allgemeine Erweiterungsstreben der Großmächte auf dem Wiener Kongress brachte auch die thüringischen Kleinstaaten in die Gefahr ihre Souveränität zu verlieren. Da sie Mitglieder des Rheinbundes waren, in diesen jedoch gezwungen worden waren und daher nicht als Verbündete der Franzosen galten, konnte ihre Unabhängigkeit bewahrt werden. Für Sachsen-Weimar-Eisenach waren sogar bedeutsame Gebietsgewinne zu verzeichnen und die Erhebung zum Großherzogtum.137 Preußen verpflichtete sich dabei, Gebiete des ehemaligen Fürstbistums Fulda an das neue Großherzogtum abzutreten.
Für die Kleinstaaten bedeutete der Kongress vielfach ein Abwarten von Entscheidungen, die bei den Großmächten lagen. Der Weimarer Minister Ernst Christian August von Gersdorff (1781-1852) äußerte sich diesbezüglich: „Die Sicherheit der kleineren Staaten beruht in Deutschland sowie überhaupt entweder auf der Begründung eines wahren, in sich selbst haltbaren, somit nach allen wesentlichen Erfordernissen eines guten Organismus erbauten deutschen Reiches […] oder sie gründet sich auf die Koexistenz der mehreren mächtigen Staaten in Deutschland, deren politische Eifersucht das Prinzip der Fortdauer der kleineren zwischen ihnen gelegenen Herzogtümer und Fürstentümer bildet. Jetzt, wenn ich nicht irre, sind wir in diesem letzteren Fall.“138
Diese Einschätzung traf zu. Die Vorschläge von österreichischer und preußischer Seite, vertreten durch Klemens Fürst von Metternich (1773-1859) und Karl August Fürst von Hardenberg (1750-1822), zielten auf eine überragende Rolle des je eigenen Staates in einem deutschen Staatenbund hin. Ein solcher Staatenbund ginge mit der Bedeutungslosigkeit der Klein- und Mittelstaaten, trotz ihres formalen Fortbestehens, einher. Allerdings scheiterten die Pläne insbesondere am Misstrauen der Österreicher gegenüber der deutschen Zweitmacht Preußen. Die deutschen Staaten schlossen sich daraufhin in einem nur lose orientierten, insbesondere auf den militärischen Verteidigungsfall ausgerichteten Deutschen Bund zusammen139, in dem Österreich durch seine Position als Präsidialmacht eine Sonderrolle einnahm. Eine gesamtdeutsche Verfassung war unerreichbar und musste in die Kompetenz der Einzelstaaten gelegt werden. Die Schaffung eines geeinten Deutschlands wurde durch die Schaffung des Bundes nicht gefördert, sondern letztlich unterbunden. Den Herzögen und Fürsten der Thüringer Kleinstaaten wurde somit Macht und Unabhängigkeit gesichert. Erst mit den revolutionären Ereignissen des Jahres 1848 wurde die Souveränität und politische Ordnung der Thüringer Herzog- und Fürstentümer in Frage gestellt.
Revolution von 1848
Die seit Anfang des Jahrhunderts bestimmende Restaurationspolitik der Staaten im Deutschen Bund erfuhr im März 1848 eine entscheidende Wende. Deutschland stand in einem gesamteuropäischen Prozess, ausgehend von Frankreich, wo im Februar 1848 die Monarchie abgelöst wurde.140 In Deutschland wuchsen trotz bzw. wegen der restriktiven offiziellen Politik, die Bestrebungen nach einem offeneren, bürgerlichen, demokratischeren Staat.141 Verbunden war dies mit dem Streben einer gesamtdeutschen Einigung der Einzelstaaten.142 Die staatliche Wirklichkeit blieb jedoch weit hinter diesen Forderungen zurück: Kaum ein deutscher Nationalstaat hat, wie beim Wiener Kongress beschlossen, eine Verfassung eingesetzt, viele Thüringer Staaten kamen dem jedoch recht früh nach.143
Von Baden ausgehend verbreitete sich die Revolution über Deutschland. Viele Landesherren setzten neue Regierungen ein, die dem Drängen der revoltierenden Bevölkerung besser entsprachen. Den Höhepunkt bildete die Frankfurter Nationalversammlung von 1848/1849. Die Ausarbeitung einer Reichsverfassung und Vorbereitung einer Einheit Deutschlands waren Hauptanliegen, der dabei in Gruppen Zerstrittenen.144
Auch in Thüringen waren Einheitsbestrebungen stark ausgeprägt145, zugleich aber mit einem der profiliertesten kleinstaatlichen Systeme in Deutschland konfrontiert. Dies zeigt sowohl den vorhandenen Missstand, als auch die zu erwartende Auseinandersetzung mit der bestehenden staatlichen Ordnung. Die meisten thüringischen Regenten vermochten jedoch zunächst geschickt die Situation zu meistern.146
Die Bevölkerung in Thüringen war stark, trotz allem Einheitsstrebens, ihren Dynastien verbunden. Insbesondere das liberal geprägte Bürgertum147, das sich durch eine recht offene Politik im Presse und Vereinswesen relativ frei entfaltete148, konnte schnell durch kleinere Veränderungen, so z.B. durch die Zensuraufhebung und die Bestellung neuer liberaler Minister, beruhigt werden.149 Bezüglich der Bildung von Landtagen sind jedoch große Unterschiede feststellbar. Teilweise wurden erst im Mai und Juni 1849 entsprechende konstituiert.150
Bei den anfänglichen fürstlichen Beschwichtigungsversuchen konnte es demnach nicht bleiben, da insbesondere an den sich bildenden Industriestandorten, hier insbesondere gefördert durch den wachsenden sozialen Notstand151, regelrechte Revolten von Einzelgruppen angezettelt wurden. Diese verlangten nicht nur eine Öffnung des Staates gegenüber ihren Forderungen, sondern wollten eine demokratischrepublikanische Ordnung durchsetzten.152 Eine republikanische Ordnung wurde von den meisten Thüringern von vornherein ablehnt. Die Schaffung einer Staatsverfassung mit Einflussmöglichkeit der Bevölkerung durch einen Landtag, unter dem Dach einer konstitutionellen Monarchie, war für die meisten hingegen eine realistischere Forderung. Die Abschaffung der Monarchie verlangte der Großteil der Bevölkerung nicht, sondern nach „deren solideren Umbau und die Sympathien für die Einheit und Freiheit des Vaterlandes, [und sie] […] wünschte Vertrauen zu haben und Vertrauen zu finden zwischen sich und den Steuermännern des Staatsschiffes.“153
Die mögliche Schaffung eines deutschen Einheitsstaates konnte den Verlust der Souveränität der Thüringer Staaten bedeuten. Die Regierungen von Sachsen-Meiningen und von Sachsen-Weimar-Eisenach forderten daher einen Bundestag, der die Mitsprache der Einzelstaaten und damit deren Eigenständigkeit sicherte und anerkannte.154 Dennoch konnten sich eben diese Staaten nicht auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen, sondern suchten im Einzelfall ihre je größeren Bündnispartner. Sachsen-Altenburg und die reußischen Länder orientierten sich dabei stark an Sachsen. Auch in den ernestinischen Staaten verbreitete sich die Auffassung, dass ein Anschluss an Sachsen besser sei, als im neuen Machtgefüge Deutschlands aufzugehen.155 Großherzog Carl Friedrich (1783-1853, reg. 1828-1853)156 von Sachsen-Weimar-Eisenach klagte darüber: „Wir laufen Gefahr, mit den kleinen Fürsten von Reuß, von Schwarzburg p.p. in eine Masse und bedeutungslose Kategorie, noch mehr als bisher geknetet zu werden.“157
Kleinstaaterei in ihrem überkommenen Sinne stellte in diesem Zusammenhang keine Zukunftsoption dar. Dass ein Anschluss an Sachsen jedoch deutlich die albertinische Linie bevorzugt hätte und somit keine Einheit der Wettiner bedeutete, sondern das Ende der ernestinischen Macht, wurde schnell deutlich und ließ solche Pläne wieder verschwinden.158 Verhandlungen zur Bildung eines größeren Staatenkomplexes159 bzw. der grundsätzlichen Zusammenarbeit, gingen jedoch zwischen den Thüringer Staaten weiter, insbesondere durch den Weimarer Minister Christian Bernhard von Watzdorf (1804-1870).160 Auf Ministerialkonferenzen der Thüringer Kleinstaaten vom 15./16. Dezember 1848 und vom 3. bis. 5. Januar 1849 wurde die Bildung eines größeren Staatengebildes debattiert, jedoch nicht zu einem erfolgreichen Abschluss geführt, denn letztlich waren die Staaten nicht bereit ihre Selbstständigkeit aufzugeben und eine sich abzeichnende übergroße Führungsstellung des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenachs zu akzeptieren.161
Zu den eher hypothetischen Verhandlungen der Nationalversammlung in Frankfurt über die Zukunft der Deutschen Kleinstaaterei, kamen, nach einer eher ruhigen „Frühphase“ der Revolution, konkrete revolutionäre Aufstände hinzu, die sich im Sommer 1848 auch in Thüringen manifestierten. Extreme demokratische Vereine versuchten eine republikanische Ordnung durchzusetzen und schufen damit auch im demokratischen Lager große Differenzen.162 Die Revolution kippte, indem eine neue restriktivere Haltung durch die Staatsorgane ausgeübt wurde und so gesamtdeutsche Verfassungs- und Einheitsfortschritte immer unwahrscheinlicher erschienen. So genannte Reichskommissare waren fortan für die Ordnung in Deutschland, auch in den Thüringer Kleinstaaten, verantwortlich.163
Letztlich entschieden wurden die Anliegen der Revolution zwischen der Frankfurter Nationalversammlung und der preußischen Regierung. Die Schaffung eines vereinten Deutschlands scheiterte an der Uneinigkeit der Nationalversammlung und an der ablehnenden Haltung König Friedrich Wilhelms IV. (1795-1861) von Preußen diesem neuen Deutschland vorzustehen.164
Die Bemühung, die deutschen Bundesstaaten zu einem vereinigten Deutschland zusammenzuführen, hielt in den nächsten Jahrzehnten an, wurde jedoch zunehmend von oben herab gelenkt. Preußen konnte sich in Folge des Deutschen Krieges nach 1866 als die bestimmende Macht in Deutschland herausstellen und damit selbst die Bedingungen eines vereinigten Deutschlands, ohne jeglichen Druck durch ein revolutionäres Volksbegehren, diktieren.165
Nach dem Sieg Preußens und dessen Bündnispartner166 im Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 nutzte Bismarck die aktuelle Stärke Preußens, um eine Reichsgründung unter preußischer Oberhoheit zu ermöglichen. Im Spiegelsaal von Versailles wurde am 18. Januar 1871 König Wilhelm I. zum Kaiser eines geeinten Deutschen Kaiserreiches, unter Ausschluss Österreichs, ausgerufen. Preußen erhielt eine herausragende Bedeutung im Reich und konnte diese bis 1918 halten.
2.2 Industrialisierung und Wirtschaftsreform
Neben den sich verändernden politischen Rahmenbedingungen waren insbesondere die wirtschaftlich-industriellen Umformungsprozesse sowohl für die gesellschaftliche Struktur Thüringens, als auch für die Entwicklung katholischer Gemeinden wichtig.
Die Thüringer Wirtschaftspolitik war bis ins frühe 19. Jahrhundert durch den Kameralismus geprägt, der vom Landesherrn und dessen Ministerien gelenkten Förderung von Landwirtschaft und Produktionsgewerbe. Allerdings konnte diese landesherrlich gelenkte Ordnungsform kaum den Anforderungen eines freien Wirtschaftswachstums, getragen durch Privatinitiativen, entsprechen.167 Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nahm die Erteilung von landesherrlichen Privilegien und Konzessionen an privat motivierte Geschäftsgründungen erheblich zu.168 Der Kameralismus kam damit an seine Grenzen.
Als hemmend für den wirtschaftlichen Aufschwung erwies sich die bestehende kleinstaatliche Landesstruktur.169 Nur die Schaffung eines größeren Wirtschaftsgebiets, das Zollgrenzen überwand, konnte dem abhelfen. Dies widersprach aber schon im Grundansatz der kleinstaatlichen Souveränitätspolitik, so dass 1818 ein Anschluss an den neu gebildeten preußischen Zollverband nicht erreicht wurde. Die Nachteile zeichneten sich schnell ab: Die bis dato durch Thüringen verlaufenden Handelsrouten wurden zu Jahrhundertbeginn ebenso gemieden wie der thüringische Absatzmarkt selbst, der sich für Außenstehende nur noch wenig rentierte.170
Die Notwendigkeit einen größeren Wirtschaftsraum als den eigenen, nur den Kleinstaat umfassenden zu schaffen, war drängendes Kriterium für die wirtschaftliche Weiterentwicklung im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Zunächst versuchte man einen eigenen Zollverein zu begründen, der, wenn auch kleiner, zumindest einen neuen größeren Wirtschaftsraum begründen konnte, der am 24. Oktober 1828 im „Mitteldeutschen Zollverein“ geschaffen wurde.171 Seine Funktion als wirtschaftliches Abwehrbündnis, gebildet nicht nur aus den Thüringer Kleinstaaten, sondern auch dem Königreich Sachsen, dem Königreich Hannover, dem Kurfürstentum Hessen, den Herzogtümern Hessen-Nassau und weiteren Staaten und Städten, gegenüber preußischer Überlegenheit, konnte letztlich nur hemmend auf Handel und Wirtschaft wirken.172 Erst eine Umgestaltung unter preußischer Diktion im 1833 gegründeten „Zoll und Handelsvereins der Thüringischen Staaten“ brachte den wirtschaftlichen Durchbruch, trotz der vorherigen politischen Vorbehalte, die jedoch den wirtschaftlichen Anforderungen zunehmend untergeordnet werden mussten.173 Der am 1. Januar 1834 gegründete Deutsche Zollverein war durchweg preußisch geprägt, brachte damit aber auch die Öffnung für zahlreiche auswärtige Handelsbeziehungen.174
Der erweiterte Absatzmarkt und die bessere Einbindung der Thüringer Produktionsstätten boten reichliches wirtschaftliches Wachstumspotential in der frühindustriellen Phase. Kleinere Handwerksbetriebe gingen immer mehr zu einer technisch orientierten Großproduktion über. Neue Herstellungsverfahren, insbesondere die Einführung von Großmaschinen und neue Arbeitseinteilungen ließen allmählich alte familieneigene Produktionsstätten eingehen und großgewerbliche Manufakturen bis hin zur technisierten Fabrikation entstehen. Diesen Endzustand einer industriellen Struktur zu erreichen gelang in Thüringen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts.
Die ländliche Struktur des Landes blieb grundsätzlich erhalten, obwohl sich insbesondere die Residenzstädte zu wachsenden Industriezentren entwickelten.175 Neben dem bedeutenden Textilgewerbe, das die mechanische Produktion von Wollkämmerei, Garnerzeugung, Weberei und Wirkerei zur Blüte brachte, etablierten sich weitere Produktionszweige. Die Glasherstellung wurde zu einem bedeutenden Industriezweig in den Regionen des Thüringer Waldes, insbesondere um Lauscha.176 Neben der Glasproduktion wurde die Porzellanherstellung etabliert.177
Nach den revolutionären Unruhen in Deutschland 1848/1849 begann die eigentliche Industrialisierung, die in ihrem Wachstum die Gesellschaft grundlegend veränderte. Auch in Thüringen wuchsen die Städte, die zum Anziehungspunkt für Arbeitssuchende wurden. Unternehmensgründungen mehrten sich und im Gegenzug sank die Bevölkerungszahl zahlreicher ländlicher Regionen.178 Zugleich veränderte sich die gesellschaftliche Zusammensetzung durch Zuzüge, eben auch katholischer Bevölkerungsteile.
Um 1870 trat auch Thüringen in die Phase der Hochindustrialisierung. So waren um 1880 nur noch etwa die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung in der Land- und Forstwirtschaft tätig.179 Gefördert durch die regionale Politik entwickelte sich ein reiches Wirtschaftsleben, das anderen Regionen im Reich weit voraus war. Insbesondere die Nähe zum wirtschaftlich starken Sachsen mag hierbei eine wichtige Rolle gespielt haben. Trotz der allgemeinen industriellen Entwicklung stellen sich in der staatlichen Politik interessante Gegensätze dar. Kleinstaatlichkeit ging einher mit wirtschaftlicher Offenheit und Industrieförderung und einem daraus hervorgehenden Bevölkerungswachstum.180
3. Katholische Kirche im 19. Jahrhundert – Strukturelle Veränderung, geistliche Prägung und politisch-gesellschaftlicher Konflikt
Das 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert der Umbrüche. Besonders für die katholische Kirche ergaben sich tiefgreifende Veränderungen. Die Ereignisse im Rahmen der Französischen Revolution, der Napoleonischen Kriege und der Säkularisation führten zum Ende der alten Reichskirche.181 Für Deutschland bedeutete dies vor allem, dass katholische Kirche aufhörte, eine staatsbildende Größe zu sein.
Säkularisation und Mediatisierung
Im Jahr 1802 begann die Aufhebung vieler Klöster und geistlicher Einrichtungen in den von Frankreich besetzten linksrheinischen Gebieten. Am 24. März 1803 beschloss der Reichstag den in Regensburg erarbeiteten Reichsdeputationshauptschluss, der vom Römisch-Deutschen Kaiser Franz II. am 27. April des Jahres ratifiziert wurde.182 Damit wurde das Ende der geistlichen Gebiete im Reich und auch vieler kleinerer weltlicher Territorien, insbesondere der meisten Reichsstädte, von denen nur Augsburg, Nürnberg, Frankfurt, Bremen, Lübeck und Hamburg erhalten blieben, beschlossen.183 Die entsprechenden Territorien wurden als Ausgleich für den Verlust linksrheinischer Gebiete weltlicher Fürsten deklariert. Insgesamt 19 Fürstbistümer und 44 Abteien wurden in Folge säkularisiert, 112 Reichsstände und 41 Reichsstädte mediatisiert.184
Die „angemessene“ Entschädigung für den Verlust linksrheinischer Gebiete weltlicher Herrscher ging weit über das entsprechende Maß hinaus und zeigt deutlich den tatsächlichen Charakter des Beschlusses: Die festgelegte Neugliederung des Reiches diente einzig der Machtsteigerung einiger weltlicher Regenten, denn die Gebietszuwächse entsprachen nicht den durch Frankreich erlittenen Gebietsverlusten. Als Beispiel hierfür kann Preußen herangezogen werden: Preußen verlor in den linksrheinischen Gebieten 48 Quadratmeilen mit der dortigen Bevölkerung von etwa 120.000 Personen, erhielt jedoch einen Ausgleich von 235 Quadratmeilen und damit einen Bevölkerungszuwachs von über einer halben Million Menschen.185 Die Säkularisation führte zum „…Zerfall des ganzen tausendjährigen katholischen Reichskirchenverbandes, der Bistums- und Provinzialorganisation, dem alsbald die Auflösung des Heil. Römischen Reiches selbst folgte“186.
Weit über Deutschland hinaus verlor die Kirche ihre bisherige machtpolitische Stellung. Auch in ihrer Kompetenz den Menschen ein schlüssiges Weltbild darzulegen, büßte sie stark ein, denn nicht Kirche und Evangelium, sondern Vernunft und das Gefüge eines aufgeklärten Staatensystems sollten fortan das gesellschaftliche Miteinander vermehrt prägen.187
Unter Napoleon wurden Kirche und Papst zum Spielball der weltlichen Politik.188 Zugleich wurde dem Papsttum der Raum geschaffen, eine neue Form der Einflusspolitik zu etablieren, denn durch das französische Konkordat aus dem Jahr 1801 konnte die Kirche eine Brücke bauen, „über die das päpstliche Recht in Europa, auch in Deutschland, von neuem Einzug hielt.“189
Der Verlust der alten bischöflichen Ordnung, die nicht mehr existierende Reichskirche und der entschiedene Souveränitätsanspruch der Territorialstaaten, ließen nicht nur eine deutsche Nationalkirche möglich erscheinen190, sondern hoben im Gegensatz dazu auch Rom und das Papsttum in eine neue Rolle als Verhandlungspartner den Staaten gegenüber. Diese waren es, die durch ihren Territorialismus letztlich die Bestrebungen zur Bildung einer deutschen Einheitskirche verhinderten.191 Das Papsttum wurde zum Neuordner der deutschen Kirche in Verhandlung mit den Einzelstaaten.192 Hinzu trat eine aufkommende Symphatisierung der deutschen Katholiken mit dem Papst gegenüber einem überzogenen Staatskirchensystem, das die meisten Einzelstaaten bis zur Mitte des Jahrhunderts vertraten. Sowohl in der katholischen Bevölkerung, als auch unter den Bischöfen kam es zu einem wachsenden „Schulterschluss“ mit Rom.193
Jurisdiktionelle Neuordnung der katholischen Kirche
Der Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und der Untergang der alten Reichskirche194 stellten einen Abbruch in der bisherigen kirchlichen Verwaltungsstruktur dar. Deren Neuordnung konnte durch den ausgeprägten Föderalismus der deutschen Einzelstaaten nicht einheitlich verlaufen, sondern machte Einzelregelungen zwischen Kirche und Territorialstaat erforderlich.195 Die bisherige Verwaltungsstruktur der katholischen Kirche in Thüringen war an das Erzbistum Mainz gebunden. Am 1. Mai 1805 verfügte Papst Pius VII. (1742-1823) die Translation des Erzbistums Mainz nach Regensburg, so dass Carl Theodor von Dalberg (1744-1817) künftig Erzbischof von Regensburg war und die Mainzer Gebiete entsprechend zugeordnet wurden.196 Für die Katholiken der Stadt Erfurt und des Eichsfelds blieb demnach grundsätzlich die Verbindung zu Mainz bestehen.197
Im Umstrukturierungsprozess der preußischen Bistümer198 ab 1821 wurden die Stadt Erfurt, das Eichsfeld und das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach einbezogen. Ein Konkordat, welches das Miteinander, die Rechte und Pflichten von Staat und Kirche regelte, konnte für Preußen nicht erreicht werden.199 Um dennoch dringende Fragen, insbesondere die der Diözesanzugehörigkeit zu klären, einigten sich die Verhandlungspartner auf die Erstellung einer Zirkumsskriptionsbulle.200
Am 16. Juli 1821 erging die Bulle „De salute animarum“, die betreffs Thüringen festlegte, dass die Gebiete „…von der Diözese Maynz […] sammt der Stadt Heiligenstadt mit ihrem Dekanate […] und der Stadt Erfurt mit den drey vorstädtischen Pfarreien, wie auch die Pfarreien des Großherzogtums Weimar…“201 dem Bistum Paderborn202 zugeordnet werden.203 Bereits einen Monat später, am 16. August 1821, wurde in der Bulle „Provida solersque“, welche die neue oberrheinische Kirchenprovinz umschrieb, eine andere Zuordnung der Weimarer Gemeinden vorgenommen.204 Die Bulle bezieht sich dabei auf die besondere Situation der Rhön: „Mit der nämlichen Fuldaer Diöcese lassen Wir noch neun Pfarreien im Großherzogthume Sachsen-Weimar vereinigt…“205. Diese erneute Übertragung fand ohne Rücksprache mit der Weimarer Regierung statt, was zu erheblichen Auseinandersetzungen führte, die im entsprechenden Abschnitt zu den Rhöner Gemeinden näher dargestellt werden.
Die Herzogtümer Coburg, Gotha und Meiningen, sowie die Fürstentümer zu Schwarzburg und Reuß wurden in die Bistumsneuumschreibungen nicht mit einbezogen. Eine entsprechende Zuordnung wurde durch die Staatsregierungen mit den Bischöfen von Paderborn, Würzburg und Bamberg ausgehandelt.206
Ultramontanismus
Das Papsttum wurde als legitime Instanz anerkannt und für den Abschluss von Konkordaten und Konventionen, in denen die Staaten so weit wie möglich ein ihnen genehmes Staatskirchentum zu etablieren suchten, umworben.207 Besonders der Anspruch deutscher Staaten am je eigenen Staatskirchensystem festzuhalten208 und somit Einfluss auf die katholische Kirche in ihren Territorien zu nehmen, stärkte den Zusammenhalt von Papst und deutschen Katholiken, die, auch bedingt durch eine neue Form der religiösen Begeisterung, für ihre Kirche eintraten.209
Die katholische Kirche in Deutschland wandelte sich nicht nur in ihren Strukturen, sondern auch in ihrer geistigen Grundauffassung. Die Suche nach Glaubenstiefe und Sinngebung führte zu einer verstärkten Rezeption der katholischen Lehre und dem Wiedererstarken katholischer Glaubenspraktiken, die die katholische Aufklärung zuvor verworfen hatte.210
Der zunehmende Einfluss des Papsttums in Deutschland machte sich besonders an der Erscheinung des Ultramontanismus fest.211 In einer eher distanzierten Haltung zu Welt, Gesellschaft und politischem Zeitgeist standen die Ultramontanen auch in einer gewissen Opposition zum Staat, insbesondere zum Preußen Bismarcks. Hierin zeichnet sich eine grundsätzliche Kluft zwischen den Gedankenwelten auf. Der im Lauf des Jahrhunderts immer stärker werdende Nationalismus212, der nationalspezifische Charakteristika extrem betonte und versuchte Religion in einem „völkischen Sinne“ zu verstehen, womit zumindest eine Unterordnung kirchlicher Verantwortung unter die staatliche verstanden wurde213, trat in scharfen Gegensatz zum übernationalen Anspruch des Papsttums auf Eigenständigkeit und Letztverantwortung für alle Katholiken.214 In Verbindung mit den Gedanken des Liberalismus, der im Kirchenstaat ein Antimodell zum idealen Staatswesen sah und durch die Kirche im „Syllabus errorum“ Papst Pius’ IX. (1792-1878) verworfen wurde215, wurde die Kirche im preußisch geprägten Deutschland als ein „Relikt des Volksbrauchtums“216 betrachtet, das sich der weltlichen Macht klar unterzuordnen habe. Der staatliche Machtanspruch, gestützt durch eine protestantische Staatsauffassung217, die zu großen Teilen jedoch nur eine vordergründige war218, führte nicht nur zur Opposition des Papstes, sondern auch zur Verweigerungshaltung großer katholischer Bevölkerungsteile.219
Die Katholiken vertraten dabei jedoch nicht eine „Anti-Haltung“, sondern brachten sich in das politische Geschehen ein. Dabei verbanden sich Papsttreue, Eigeninitiative katholischer Laien und politisches Tagesgeschehen miteinander. Durch die Etablierung eines ausgeprägten katholischen Vereinswesens schufen engagierte Katholiken einen Rahmen, der nicht nur für das katholische Gemeindeleben, sondern auch für das gesellschaftliche, soziale und politische Wirken der Kirche bedeutsam war.220 Im Revolutionsjahr 1848 wurde der „Katholische Verein Deutschlands“ gegründet, der die Interessen der Deutschen Katholiken, in Treue zu Rom und den Bischöfen, im sich entwickelnden Parlamentarismus vertreten sollte.221 In der Zweiten Preußischen Kammer entstand zunehmend ein katholischer „Block“, der als Zentrumspartei ab 1859 politischen Einfluss nahm.222 Die deutschen Bischöfe, versammelten sich erstmals vom 22. Oktober bis 16. November 1848 in Würzburg, um sich über die verändernde politische Lage auszutauschen.223 In einer Denkschrift setzten sie sich dabei für die Unabhängigkeit der Kirche gegenüber dem Staat ein, nicht jedoch für eine Trennung von Staat und Kirche, die davon zu unterscheiden ist.224
Die Beschlüsse des Ersten Vatikanums verschärften ab 1870 das spannungsvolle Miteinander von vielen deutschen Staaten und katholischer Kirche und sorgten für große Empörung, insbesondere auf politischer Ebene. Der „…nationalprotestantische Taumel im Gefolge des Sieges von Sedan…“225 traf auf universalen päpstlichen Anspruch. Größer konnte der Widerspruch zwischen Kirche und Staat kaum sein.
Ist vom Staat die Rede, so muss doch bemerkt werden, dass auch das 1871 gegründete Deutsche Reich föderalistisch geprägt war. Die Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche mussten demnach regional verschieden sein. Im Hinblick auf Mitteldeutschland sind daher insbesondere die preußischen Gebiete von Bedeutung.226 Die Interessen der Katholiken wurden auf politischer Ebene in besonderer Weise durch besagte Zentrumspartei vertreten.227 Katholiken, Ultramontanismus, päpstlicher Autoritätsanspruch, gekennzeichnet durch die Beschlüsse des Ersten Vatikanums und die Zentrumspartei, wirkten von außen wie ein einziger katholischer Block, der den nationalen Definitionen des preußisch-protestantischen Deutschlands228 widersprach und in das Staatssystem Bismarck nur schlecht zu integrieren war.229 Auch gegenüber dem sich ab 1860 immer stärker etablierenden politischen Liberalismus wirkten die Interessen und Auffassungen der Katholiken weiter distanzierend.230
Der Zentrumspartei und damit letztendlich den Katholiken wurde vorgeworfen, dass sich in ihrer Mitte separatistische-partikularistische Kräfte versammelten, die letztlich im Interesse ausländischer Mächte (Papst, Frankreich, Österreich) handelten. Die katholische Kirche war international geprägt und musste einen überzogenen Nationalismus deutscher Prägung ablehnen.231 Katholizismus, Zentrumspartei und Papsttum waren mit den politisch-gesellschaftlichen Erwartungen Bismarcks einfach inkompatibel.232
Kulturkampf
Der Entschluss Bismarcks zum Kulturkampf233 gegen die katholische Kirche in Deutschland lässt sich letztlich an fünf Punkten festmachen: Der Widerspruch zur geltenden nationalprotestantischen Staatsausrichtung, der skeptischen Haltung Bismarcks gegenüber allem Katholischem, den Beschlüssen des Ersten Vatikanums bezüglich päpstlicher Unfehlbarkeit und Jurisdiktionsprimat, der Gründung einer dezidiert katholischen Partei – dem Zentrum – und in einer, durch diese Faktoren bedingte Stigmatisierung der deutschen Katholiken als Reichfeinde, die, sicherlich auch geprägt durch den Ultramontanismus, damit letztlich unter einen Generalverdacht gestellt wurden.234
Als mehrere Theologieprofessoren in Preußen durch ihre Bischöfe gemaßregelt wurden, da sie den Konzilsbeschlüssen zur Unfehlbarkeit und zum Jurisdiktionsprimat ihre Zustimmung verweigerten, intervenierte die preußische Staatsregierung.235 Zunächst wurde am 8. Juli 1871 die katholische Abteilung des Kultusministeriums aufgehoben236, da diese eine Interessenvertretung der Katholiken, besonders aber des Zentrums, im Regierungs- und Verwaltungsapparat darstellte.237 Auf Regierungsaber auch auf der Schulverwaltungsebene wurde den katholischen Anliegen damit der Boden entzogen. Bildungspolitik sollte vollständig unter staatliche Kontrolle kommen. Zur weiteren Schwächung eines möglichen katholischen Widerstands bzw. einer katholischen Einflussnahme auf die Gesellschaft trat am 10. Dezember 1871, und dies auf Betreiben Bayerns, der so genannte Kanzelparagraph in Kraft, der es Geistlichen unter Androhung von Festungshaft verbot, in ihrer Wortverkündigung, insbesondere aber in ihrem Predigtdienst, zu politischen Themen Stellung zu beziehen.238
Ein wichtiger Einflussbereich der Kirche auf das gesellschaftliche Miteinander war deren Funktion im Bildungswesen. Die schulische Ausbildung war so zu großen Teilen eine kirchliche Erziehung. Mit dem „Gesetz betreffend die Beaufsichtigung des Unterrichts und Erziehungswesens“ vom 11. März 1872 beendete Bismarck diese herausragende Stellung der Kirche im Bereich Bildung.239
Besonders der Gesellschaft Jesu, den Jesuiten, wurde eine staatsgefährdende Tätigkeit vorgeworfen, letztlich um einen der etabliertesten Orden mit großer Bedeutung für den Katholizismus in Deutschland zu schwächen. Durch das so genannte Jesuitengesetz vom 4. Juli 1872 wurden alle Mitglieder des Ordens aus Deutschland iesen.240
Im „Kampf“ von Kirche und Staat ging es Bismarck zunehmend darum die deutsche Geistlichkeit enger an den Staat zu binden und sie aus ihrer kirchlichen Verknüpfung zu lösen. Sie sollten zu Dienern des staatlichen Systems werden. Die im Mai 1873 nach heftigen parlamentarischen Diskussionen erlassenen Maigesetze dienten dem Ziel den katholischen Klerus aus der kirchlichen Ordnungs- und Dienstgewalt mehr und mehr zu lösen, indem künftig der Staat über die Vorbildung der Kleriker und deren Anstellung, über die Rahmen von kirchlicher Disziplinargewalt und über die Grenzen der Verhängung kirchlicher Strafen befand.241 Den Katholiken an sich wurde es ermöglicht, auf einfache Weise aus der Kirche auszutreten. Eine entsprechende Erklärung vor den staatlichen Organen genügte fortan und bedeutet seither die Befreiung von der Kirchensteuer.242
Katholiken sollten vor allem Bürger des Staates sein und nicht Untertanen einer Kirche, die zudem noch päpstlich und ultramontan geprägt war.243 Der Staat wollte sich vom Einfluss der Kirche emanzipieren.244 Dies zu erreichen, wurde die Bedeutung der Kirche auf eine rein religiöse Ebene zurückgedrängt und ihr durch das „Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung“ vom 9. März 1874, ihre Bedeutung für das bürgerliche Rechtssystem genommen.245 Dadurch wurde es möglich, ein säkularisiertes, von der Kirche vollkommen unabhängiges Leben, das allein dem Staat verpflichtet ist, zu führen.
Auch die Gesetzesordnungen bzgl. der „Verwaltung erledigter katholischer Bistümer“ (20. Mai 1874)246, das „Gesetz betreffend die Einstellung der Leistungen aus Staatsmitteln für die römisch-katholischen Bistümer und ihre Geistlichen“ (22. April 1875)247, das Gesetz betreffend die geistlichen Orden und ordensähnlichen Kongregationen der katholischen Kirche“ (31. Mai 1875)248 und das „Gesetz über die Vermögensverwaltung in katholischen Kirchengemeinden“ (20. Juni 187 5)249 wirkten drastisch auf die kirchliche Selbstbestimmung und Freiheit und damit auf das kirchliche Leben an sich, auch auf die Pastoral.
Amtsenthebungen von Bischöfen, aber auch Haftstrafen für zahlreiche Geistliche, bildeten den Höhepunkt in der Auseinandersetzung, die letztlich jedoch das Ziel, das Band zwischen Gläubigen und ihrer Kirche zu lockern, verfehlte.250 Im Gegenteil bewirkte es eine neue Form von Solidarität und Zusammenhalt in der Kirche.251 Hinzukam, dass durch Bedrängnis der katholischen Kirche in Deutschland die Bedeutung des Papsttums als feststehende Instanz und Autorität weiter wuchs. Bismarcks Kulturkampf geriet in eine Pattsituation.252 Eine Annäherung der „Kontrahenten“ war für beide Seiten zwingend, jedoch unter dem Pontifikat Pius IX. (17921878) nicht möglich. Dessen Nachfolger auf dem Stuhl Petri, Papst Leo XIII. (18101903), kündigte durch seine erste Enzyklika „Inscrutabili Dei consilio“ (21. April 1878) eine Wende innerhalb des kirchlichen Umgangs mit der modernen Lebenswelt an.253 Es ging um eine Aussöhnung, ein Aufbrechen verhärteter Fronten, eine Öffnung der Kirche zu den herrschenden sozialen, gesellschaftlichen und politischen Realitäten.
Auch in der innerdeutschen Politik ergaben sich neue Anforderungen, die eine Konfrontation mit der Zentrumspartei zunehmend als hinderlich für die bismarcksche Politik erscheinen ließ.254 Die Politik des Reichskanzlers entfernte sich zunehmend vom liberalen Block und suchte neue Verbündete im konservativen Lager, das, mit ihm zusammen, in der wachsenden Sozialdemokratie den eigentlichen „Reichsfeind“ sah und für deren Einschränkung Bismarck neue Mehrheiten suchte.255
Die Verhandlungen mit der römischen Kurie und der neue politische Kurs in Preußen führten letztlich zum Ende des Kulturkampfes. Sukzessive wurden die Bestimmungen gelockert, zunächst in zwei Milderungsgesetzen, später in zwei Friedensgesetzen, so dass Leo XIII. am 23. Mai 188 7256 die Auseinandersetzung für beendet erklärte, auch wenn einige Kulturkampfverordnungen, wie etwa die Zivilehe und der Kanzelparagraph (erst 1953 abgeschafft), bestehen blieben.257
Katholische Kirche und Arbeiterschaft
Bis zum Ende der Monarchie fügte sich auch die katholische Kirche immer weiter in die Struktur des jungen, preußisch geprägten Deutschen Reiches ein, besonders gefördert durch ein positiv geprägtes Verhältnis vieler Bischöfe zu Kaiser Wilhelm II. (1859-1941, reg. 1888-1918) und der Sorge vor einem Wachsen „revolutionärer Kräfte“.258 Auf der anderen Seite kam es zu einer Öffnung, besonders junger Geistlicher, für die sozialen Fragen der Zeit und damit einhergehend zu einem erheblichen Konfliktpotential zwischen Kirchenleitung und „Arbeiterkaplänen“.259 Auch wenn dies die kirchliche Einheit nicht grundsätzlich gefährdete, so zeigte sich darin eine weitere Spannung, die über das Miteinander von Kirche und Staat hinausreichte. Die Kirche zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde mit den Fragen und Problemen der Arbeiter konfrontiert und rückte damit in ein Konkurrenzverhältnis zur Sozialdemokratie.260 Auf der anderen Seite zeichnet sich in der Frömmigkeitspraxis dieser Zeit ein klar kirchlich geprägtes Glaubensverständnis, d.h., dass Symbole, Riten und traditionelle Frömmigkeitsformen, wie z.B. Wallfahrten, die Befolgung der kirchlichen Lehren, verbunden mit einer starken Anhänglichkeit an die Autorität des Papstes und der Bischöfe, zunehmend Bedeutung erlangten.261 Die ultramontane Ausrichtung vieler Katholiken knüpfte sich oft an diese Alleinstellungsmerkmale katholischen Bekenntnisses und Frömmigkeit. Die katholische Kirche bot Orientierung und Festigkeit, eben nicht nur als Institution, sondern durch den Glauben selbst, der durch die Marien- und Herz-Jesu-Frömmigkeit eine besondere Prägung erhielt und besonders im Kulturkampf als religiöser Gegenpunkt diente.262
Ausdruck fand die neue Frömmigkeit der Menschen in der Gründung von Kongregationen, Bruderschaften und Vereinen, die Zusammenhalt durch ein verbindendes Anliegen schufen und letztlich auch die Einbindung der Katholiken in ihre Kirche förderten. Die katholische Kirche war in neuer Weise Heimat und Bekenntnis geworden. Die Kirchentreue in Arbeiterkreisen hingegen war weit weniger gesichert und konnte auch durch die Gesellen- und Kolpingvereine nur teilweise gefördert werden.263
Kennzeichnend für die Geschichte des Katholizismus des 19. Jahrhunderts in Deutschland ist ein tiefgreifender Wandel auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen bis hinein in die soziale Frage. In diesem Kontext entwickelten sich auch die katholischen Gemeinden der Thüringer Kleinstaaten, deren Entwicklung sich indes durch weitere, besondere Rahmenbedingungen auszeichnete. Dies bezieht sich nicht nur auf die außergewöhnliche politische Situation, die die Kleinstaaterei mit sich brachte und sich je nach Einzelstaat unterschiedlich darstellte, sondern auch darin, dass es um die Neubegründung von katholischer Glaubenspraxis an sich ging. Katholizismus war für die Thüringer Kleinstaaten des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts ein Novum.
Im Folgenden wird nun die Entwicklung des Katholizismus in den einzelnen Thüringer Kleinstaaten intensiver betrachtet.
21 Eine Beschreibung des frühmittelalterlichen einheimischen Adels ist schwierig: Grundlegend lässt sich sagen, dass sich in Thüringen eine Adelsschicht eine gewisse Unabhängigkeit vor den Franken bewahren konnte, aber selbst zu schwach war, um eine eigene Führungsrolle einzunehmen. Es blieb bei einem Gewirr von Edlen mit Titeln wie „dux“, „comes“ oder „marchio“. Vgl. dazu: H. Wittman, Im Schatten der Landgrafen. Studien zur adligen Herrschaftsbildung im hochmittelalterlichen Thüringen (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen, kleine Reihe 17), Köln-Weimar-Wien 2008, S. 478-486.
22 Vgl. H. Patze, Land, Volk und Geschichte, in: H. Patze/W. Schlesinger (Hg.), Geschichte Thüringens, Bd. 6: Kunstgeschichte und Numismatik der Neuzeit (Mitteldeutsche Forschungen 48/VI), Köln 1979, S. 217
23 Vgl. dazu weiterführend: S. Weigelt, Ludwig IV., der Heilige, Landgraf von Thüringen und Pfalzgraf von Sachsen, in: D. Ignasiak (Hg.), Herrscher und Mäzene. Thüringer Fürsten von Hermenefred bis Georg II, Rudolstadt-Jena 1994, S. 77-90. Die Angabe der Lebensdaten der Thüringer Landgrafen, Herzöge und Fürsten beziehen sich auf: D. Ignasiak, Regenten-Tafeln Thüringischer Fürstenhäuser. Mit einer Einführung in die Geschichte der Dynastien in Thüringen, Jena 1996.
24 Vgl. Ignasiak, Regenten-Tafeln, S. 27.
25 Vgl. S. Tebruck, Pacem confirmare – iusticiam exhibere – per amiciciam concordare. Fürstliche Herrschaft und politische Integration: Heinrich der Erlauchte, Thüringen und der Weißenfelser Vertrag von 1249, in: J. Rogge/U. Schirmer (Hg.), Hochadlige Herrschaft im mitteldeutschen Raum (1200-1600). Formen – Legitimation – Repräsentation (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 23) Stuttgart 2003, S. 243-303, hier S. 243. Verwiesen sei auch auf: H. Kunde/S. Tebruck/H. Wittmann, Der Weißenfelser Vertrag von 1249. Die Landgrafschaft Thüringen am Beginn des Spätmittelalters (Thüringen gestern & heute 8), Erfurt 2000; S. Raßloff, Geschichte Thüringens, München 2010, S. 30.
26 Vgl. B. Streich, Die Anfänge der Residenzbildung in Thüringen. Dynastische Verbindungen, Teilungen, Haupt- und Nebenresidenzen, in: K. Scheurmann/J. Frank (Hg.), Neu entdeckt. Thüringen – Land der Residenzen, Essays, Jena 2004, S. 27-42, hier S. 28. Zur sich ausbildenden Hegemonialmacht vgl. D. Stievermann, Die Wettiner als Hegemonen im mitteldeutschen Raum (um 1500), in: J. Rogge/U. Schirmer (Hg.), Hochadlige Herrschaft im mitteldeutschen Raum (1200-1600). Formen – Legitimation – Repräsentation (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 23), Stuttgart 2003, S. 379-393.
27 „bißher in bruderlicher loblichmir lieb und eynigkeit Ungetilit bey ainandir sitzende pliben [gemeinsam regiert haben]; Wir nur auß gutir bewegnus und redlichen ursachen [von] uns beiden, allen Unsern Landesn luten und undirthanen zcu gut Merung unnde bleiblicher enthaldung [Erhaltung] bruderlicher trew und fruntschafft allinthalbin ufs bequemest und nuzlichst betrachtet, Im Namen gotis retig worden sein, Uns Mit einandir auß gemalten, unser beider uffgeerbten und angefallen fürstentumen und landen, und anderm [das, wir] an uns bracht, doch hirinn das herzcogtum und kurfurstentum zu Sachssen Uns herzcogen Ernst als kurfürsten und unsern Nachvolgenden erben, die nach und kurfursten sein werden allein, zcustehinde, ußgeslossen, uffs bruderlichst, fruntlichst und allergleichst erblich zcu teilen, Und uns darauff bruderlich und beflißlich mit einandir undirrett, das solch Erblich teiilung und vertragen [Vertrag], [von] uns als dem Eldsten zu machen [ist], Und unserm lieben bruder als dem Jungsten nach gemachter und geoffinter [dargelegter] teilung solch frist […] unsers lieben bruders und unser Erbliche teylung zcu machen beladen angenomen.“ Hauptteilungsvergleich zwischen Ernst und Albrecht von Sachsen 1485, hier zit. nach: John, Quellen zur Geschichte Thüringens. Von der Reformation bis 1918, Erfurt 1995, S 37f. Vgl. dazu: K. Blaschke, Die Leipziger Teilung 1485 und die Wittenberger Kapitulation 1547 als grundlegende Ereignisse mitteldeutscher Territorialgeschichte, in: J. John, Kleinstaaten und Kultur in Thüringen vom 16. bis 20. Jahrhundert, Weimar-Köln-Wien 1994, S. 1-7, hier S. 3-5; V. Graupner, Die Leipziger Teilung von 1485, in: H. Hoffmeister/V. Wahl (Hg.), Die Wettiner in Thüringen. Geschichte und Kultur in Deutschlands Mitte (Schriften des Thüringer Hauptstaatsarchiv 2), Arnstadt-Weimar 1999, S. 87-94 und Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 39.
28 Vgl. Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 31f.
29 Die Kurgebiete lagen auf dem Gebiet des heutigen östlichen Sachsen-Anhalts und des nordwestlichen Sachsens um Wittenberg und Torgau und zogen sich in einem schmalen Band bis in die Gegend von Zwickau. Streitigkeiten und kämpferische Auseinandersetzungen gab es zwischen den verschiedenen Linien, die in sich auch weiter aufgeteilt wurden, immer wieder. Die einzelnen Herrschaften konzentrierten sich zunehmend auf den Ausbau des linieneigenen Herrschaftsgebietes und Einflusses; vgl. F. Boblenz, Albertiner und Ernestiner, in: H. Hoffmeister/V. Wahl (Hg.), Die Wettiner in Thüringen. Geschichte und Kultur in Deutschlands Mitte, Arnstadt-Weimar 1999, S. 95-100, hier S. 95.
30 Dem Vetter des Kurfürsten Johann Friedrichs (1503-1554), Moritz von Sachsen (1521-1553), selbst evangelisch, aus der albertinischen Linie der Wettiner, war als Verbündetem des katholischen Kaisers Karl V. die Vollstreckung der am 19. Juli 1546 angeordneten Reichsacht gegen Johann Friedrich aufgetragen worden. Vgl. Stievermann, Die Wettiner als Hegemonen, S. 391. Als am 24. April 1547 Johann Friedrich nach der verlorenen Schlacht bei Mühlberg in Gefangenschaft geriet, kam es durch die Wittenberger Kapitulation vom 19. Mai 1547 zur besagten Verschiebung der Machtverhältnisse. Vgl. dazu: Auszug aus der Wittenberger Kapitulation, 19. Mai 1547, in: John, Quellen zur Geschichte Thüringens, S. 69-71 und Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 40. Moritz von Sachsen wurde in protestantischen Kreisen als „Judas von Meißen“ bekannt, da er sich aus politischen Gründen gegen den Schmalkaldischen Bund der protestantischen Fürsten gestellt hatte.
31 Vgl. U. J. Wandel, Vom Passauer Vertrag zur Erfurter Teilung, in: H. Hoffmeister/V. Wahl (Hg.), Die Wettiner in Thüringen. Geschichte und Kultur in Deutschlands Mitte, Arnstadt-Weimar 1999, S. 175-180, hier S. 175.
32 Hingewiesen sei auf die große Erbteilung von 1680, in der die sieben Söhne Herzog Ernsts des Frommen von Sachsen-Gotha ihre eigenen Herrschaften etablierten. Vgl. Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 41 und T. Klein, Ernestinisches Sachsen, kleinere thüringische Gebiete, in: A. Schindling/W. Ziegler (Hg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500-1650, Bd. 4: Mittleres Deutschland (KLK 52), Münster 1992, S. 8-39, hier S. 8-14.
33 Die Ernestiner hatten durch den Verlust der Kurwürde und den dazugehörenden Ländereien zu wenig Macht im Reich, so dass sich ihre Politik zunehmen nach Innen, auch die eigenen Territorien richten musste. Die Zerplitterung ist eine indirekte Folge hiervon. Vgl. J. Bauer, Reformation und ernestinischer Territorialstaat in Thüringen, in: J. John (Hg.), Kleinstaaten und Kultur in Thüringen vom 16. bis 20. Jahrhundert, Weimar-Köln, 1994, S. 37-73, hier S. 37.
34 Im Thüringer Grafenkrieg (1342-1346) lehnten sich, unter Führung der Mainzer Erzbischöfe, die Thüringer Adelsfamilien gegen die Wettiner auf, unterlagen jedoch. Nur die Schwarzburger und Reußen etablierten sich dauerhaft. Vgl. Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 31f.
35 Vgl. J. Berger/J. Lengemann, Geschichte eines Aufstiegs: Die Schwarzburger, in: K. Scheurmann/J. Frank, Neu entdeckt. Thüringen – Land der Residenzen (Thüringer Landesausstellung, Schloss Sondershausen, 15. Mai-3. Oktober 2004, Katalog 1), Jena 2004, S. 49-63, hier S. 49 und weiterführend: H. Herz, Die Grafen von Schwarzburg von den Anfängen bis zur Bildung der Grafschaft Schwarzburg-Rudolstadt, in: Thüringer Landesmuseum Heidecksburg (Hg.), Die Grafen von Schwarzburg-Rudolstadt. Albrecht VII. bis Albert Anton (Kleine kulturgeschichtliche Reihe 3), Rudolstadt 22004, S. 9-34 und T. Klein, Die Grafen von Schwarzburg, in: H. Patze/W. Schlesinger (Hg.), Geschichte Thüringens, Bd. 5, Teilband 1 (Mitteldeutsche Forschungen 48/V/1/1), S. 266-275.
36 Vgl. Raßloff, Thüringer Geschichte, S. 35.
37 Vgl. Berger/Lengemann, Geschichte eines Aufstiegs, S. 49.
38 Hierin handelt es sich um das Recht einer Familie in den Reichstagen Sitz und Stimme zu haben. Dieses Recht wurde direkt vom Kaiser vergeben, war aber in der Neuzeit mit dem Vorhandensein von Reichslehen verbunden. Letztendlich klärte sich über diese Frage die Eigenständigkeit einer Familie und deren Zugehörigkeit zum unabhängigen Adel im Reich.
39 Vgl. Berger/Lengemann, Geschichte eines Aufstiegs, S. 49.
40 Vgl. Klein, Ernestinisches Sachsen, S. 30 und W. Huschke, Die Grafen von Schwarzburg, in: H. Patze/W. Schlesinger (Hg.), Geschichte Thüringens, Bd. 5, Teilband 1 (Mitteldeutsche Forschungen 48/V/1/1), Köln 1979, S. 554-561, hier S. 554. Die Ablehung der schwarzburgischen Selbstständigkeit durch die Wettiner war insbesondere am Weimarer Hof lange Zeit scharf geübt worden. Herzog Johann Ernst III. (1664-1707) bezeichnete demnach den (auch) reichsunmittelbaren Grafen Anton Günther II. (1653-1716) als seinen Vasallen, das an den faktischen politischen Zuständen vorbei ging und als Provokation verstanden werden musste. Konkret wollte er „… die Grafen von Schwarzburg in den Schranken gebührender Subjektion zu erhalten.“ Vgl. ebd. S. 556.
41 Vgl. Klein, Ernestinisches Sachsen, S. 30.
42 Vgl. Raßloff, Thüringer Geschichte, S. 35.
43 Vgl. ebd. S. 35f.
44 Vgl. Klein, Ernestinisches Sachsen, S. 32.
45 Vgl. S. Strucke, Die Reußen und ihr Land. Die Geschichte einer süddeutschen Dynastie, St. Michael 1984, S. 125 und Raßloff, Thüringer Geschichte, S. 42.
46 Vgl. dazu weiterführend: R. Jonscher, Thüringer Kulturlandschaft vom 16. bis zum 19. Jahrhundert – Konstanten und Wandel. Ergebnisse und Desiderate der landesgeschichtlichen Forschung seit 1990, in: R. Jacobsen (Hg.), Residenzkultur in Thüringen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert (Palmbaum-Texte Kulturgeschichte 8), Jena 1999, S. 11-28.
47 Vgl. dazu Raßloff, Thüringer Geschichte, S. 42f und F. Jürgensmeier, Kurmainz, in: A. Schindling/W. Ziegler (Hg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation un Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500-1650, Bd. 4: Mittleres Deutschland (KLK 52), Münster 1992, S. 60-97.
48 Die wettinischen Versuche die Erfurter Territorien unter sächsische Herrschaft zu stellen, waren durchaus vielfältig: Auch als das Haus Wettin zwei Mal den Mainzer Bischofsstuhl mit einem Familienmitglied besetzen konnte, so unter den Erzbischöfen Ludwig (1341-1382) und Albrecht (1467-1484), kamen die Einverleibungsversuche nicht über den 1483 verliehenen Schutzmachtstatus hinaus. Erst 1664 wurde Erfurt endgültig Kurmainzisch und die Schutzfunktion der Wettiner aufgehoben. Herzog Ernst der Fromme (1601-1675) von Sachsen-Gotha-Altenburg bemühte seinen Kanzler Veit Ludwig v. Seckendorff in zwei Abhandlungen, die Ansprüche der Wettiner durchzusetzen. Durch Rechtsexekutionstruppen wurde im genannten Jahr der Mainzer Anspruch letztlich durchgesetzt. Vgl. E. von Danckelmann, Die Politik der Wettiner in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Thüringisch-Sächsische Zeitschrift für Geschichte und Kunst 13 (1923/1924), S. 23-67, S. 30.
49 Vgl. zur Geschichte der katholischen Kirche in Thüringen weiterführend: J. Pilvousek, Die Christianisierung Mitteldeutschlands bis zur ersten Jahrtausendwende, in: B. Seyderhelm (Hg.), Tausend Jahre Taufen in Mitteldeutschland, Regensburg 2006, S. 43-51; Fernerhin: J. Pilvousek, Zur Geschichte des Bistums Erfurt. Ein Überblick, in: Jahrbuch für mitteldeutsche Kirchen und Ordensgeschichte 1 (2005), S. 147-150. Als besonderer Ausdruck der nachreformatorischen-kurmainzer Herrschaft sei beispielhaft auf die Darstellungen zur Erfurter Fronleichnamsprozession verwiesen: Ders., Fronleichnam in Erfurt 1674 bis 1802. Volksfest mit missionarischen Ambitionen?, in: B. Kranemann/J. Pilvousek/M. Wijlens (Hg.), Mission – Konzepte und Praxis der katholischen Kirche in Geschichte und Gegenwart (EThSchr 38), Würzburg 2009, S. 123-140.
50 Vgl. Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 47.
51 Vgl. zu den Grundlagen der Reformation in den Wettiner Gebieten weiterführend: K. Blaschke, Sächsische Landesgeschichte und Reformation. Ursachen, Ereignisse, Wirkungen, in: E. Bünz/S. Rhein/G. Wartenberg (Hg.), Glaube und Macht. Theologie, Politik und Kunst im Jahrhundert der Reformation (Schriften der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 5), Leipzig 2005, S. 111-132 und R. Herrmann, Thüringische Kirchengeschichte, Bd. 2., Weimar 1947 (Nachdruck 2000), bes. S. 5-16.
52 Vgl. Bauer, Reformation und Territorialstaat, S. 41.
53 Vgl. H. Kirchner, Reformationsgeschichte von 1532-1555/1566. Festigung der Reformation, Calvin, katholische Reform u. Konzil von Trient (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen 6) Berlin 1988, S. 33. Die Rahmenbedingungen waren hierfür günstig: Der Kaiser weilte zwischen 1532 und 1541 nicht im Reich, so dass die Fürsten selbstständig politisch aktiv sein konnte. Letztlich musste Kaiser Karl V., außenpolitisch bedrängt durch Frankreich und die Türken, im Inneren Kompromissbereitschaft zeigen. Die Reformation brachte den Ernestinern zunächst keine größere Hegemonialmacht ein. Dies mag zunächst verwundern, doch verhinderte die Politik anderer protestantischer Fürsten, allen voran des hessischen Adels, eine weitere ernestinische Etablierung. Vgl. dazu Stievermann, Die Wettiner als Hegemonen, S. 391. Nach Stievermann führte die Einführung des Reformation jedoch grundsätzlich zur verstärkten Entwicklung eines „territorialfürstlichen ‚Absolutismus‘“, D. Stievermann, Evangelische Territorien im Konfessionalisierungsprozeß, in: A. Schindling/W. Ziegler (Hg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land der Konfession 1500-1650. Bilanz – Forschungsperspektiven – Register (KLK 57), Münster 1997, S. 45-65, hier S. 62.
54 Vgl. dazu: U. Schirmer, Untersuchungen zur Herrschaftspraxis der Kurfürsten und Herzöge von Sachsen. Institutionen und Funktionseliten (1485-1513), in: J. Rogge/U. Schirmer (Hg.), Hochadlige Herrschaft im mitteldeutschen Raum (1200-1600). Formen – Legitimation – Repräsentation (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 23), Stuttgart 2003, S. 305-378 und Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 49.
55 Schon am 31. Oktober 1525 wandte sich Luther in einem Schreiben diesbezüglich an den Kurfürsten Johann. Dieser möge sich der Fragen der kirchlichen Verwaltung annehmen, da sie dringend gelöst werden müssten. Nicht aber allein der Notstand diene dazu als Legitimation, sondern es sei zumindest in Fragen der Verwaltung eine grundsätzliche Kompetenz des Landesherrn auch die Kirche des Landes zu lenken. Ein Eingreifen in den Kultus selbst billigte Luther im geringerem Maße ebenfalls, dies aber nur, um Notsituationen abzuwenden bzw. zu lösen. Vgl. dazu: I. Höß, Humanismus und Reformation, in: H. Patze/W. Schlesinger (Hg.), Geschichte Thüringens, Bd. 3: Das Zeitalter des Humanismus und der Reformation (Mitteldeutsche Forschungen 48/III), Köln 1967, S. 1-145, hier S. 73f.
56 Eine grundsätzliche Verhältnisbestimmung von Volk und Obrigkeit verfasste Luther bereits 1523 in seiner Schrift: „Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei“. Gewidmet war sie Herzog Johann dem Beständigen, Bruder des Kurfürsten, der in Weimar eine eigene Residenz unterhielt und entgegen der passiven Haltung Friedrichs des Weisen, aktiv Partei für Luther ergriff, insbesondere ab 1525 als Kurfürst, vgl. H. Jadatz, Wittenberger Reformation im Leipziger Land. Dorfgemeinden im Spiegel der evangelischen Kirchenvisitationen des 16. Jahrhunderts, in: Herbergen der Christenheit, Sonderband 10 (2007), S. 47; vgl. E. Müller, Luther in Weimar, in: Thüringer kirchliche Studien 5 (1987), S. 97-108. Vgl. zur Typologie des evangelischen Landesherrn weiterführend: M. Rudersdorf, Die Generation der lutherischen Landesväter im Reich. Bausteine zu einer Typologie des deutschen Reformationsfürsten, in: A. Schindling/W. Ziegler (Hg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land der Konfession 1500-1650. Bilanz – Forschungsperspektiven – Register (KLK 57), Münster 1997, S. 137-170.
57 Vgl. dazu: M. Schulze, Fürsten und Reformation. Geistliche Reformpolitik weltlicher Fürsten vor der Reformation (Spätmittelalter und Reformation, Neue Reihe 2), Tübingen 1991 und Klein, Ernestinisches Sachsen, S. 12.
58 Vgl. E. Bünz/C. Volkmar, Das landesherrliche Kirchenregiment in Sachsen vor der Reformation, in: E. Bünz/S. Rhein/G. Wartenberg (Hg.), Glaube und Macht. Theologie, Politik und Kunst im Jahrhundert der Reformation (Schriften der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 5), Leipzig 2005, S. 89-109. Zum machtpolitischen Aspekt vgl. außerdem Höß, Humanismus und Reformation, S. 72. Der Einfluss der Wettiner auf die Hochstifte Merseburg, Naumburg-Zeitz und Meißen war hoch. Die reichsunmittelbaren geistlichen Territorien verloren schon vorreformatorisch faktisch ihre Eigenständigkeit, die ihnen damit nur noch rein formal zukam.
59 Vgl. Bünz, Das landesherrliche Kirchenregiment, S. 10. Luther griff demnach bereits vorhandene Tendenzen auf und brachte für diese eine theologische Legitimation. Die Verdichtung der Territorien mit der Schaffung einer größeren Zentralgewalt und die Kommunalisierung der städtischen Kirchen waren Grundanliegen der frühneuzeitlichen Herrscher im Aufbau ihres Staatswesens. Vgl. V. Leppin, Die Wittenberger Reformation und der Prozess der Transformation kultureller zu institutionellen Polaritäten (Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologischhistorische Klasse 140/4), Leipzig 2008, S. 36. Berndt Hamm findet hierfür die passende Formulierung: „normative Zentrierung“, vgl. dazu: B. Hamm, Reformation als normative Zentrierung von Religion und Gesellschaft, in: JBTh 7 (1992), S. 241-279. Besonders das alte Klerikerbild, das den Geistlichen besondere Privilegien in der Gesellschaft einräumte, widersprach diesem Prozess. Die Kritik am Klerus schlug auf allen Ebenen durch, so dass sich ein ausgesprochen heftiger Antiklerikalismus entwickelte. Vgl. dazu: H. Goertz, Radikalität der Reformation. Aufsätze und Abhandlungen (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 93), Göttingen 2007, S. 41-48, bes. S. 44. Der Antiklerikalismus war insbesondere ein anti-römischer. Die Gedanken einer „Libertas Germaniae“ sind auch bei Luther zu finden, wenn auch in besonderer Ausformung; vgl. A. Schmidt, Konfession und nationales Vaterland. Katholische Reaktionen auf den protestantischen Patriotismus im Alten Reich (1520-1620), in: T. Kaufmann/A. Schubert/K. von Greverz (Hg.), Frühneuzeitliche Konfessionskulturen (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 207), Heidelberg 2008, S. 13-48, hier S. 14; Dieter Stievermann fasst für den Gesamtprozess treffend zusammen: „Verstärkung der fürstlichen Gewalt, raumübergreifende dynastische Verflechtungen, Königsnähe, verdichtete kuriale Beziehungen, Ausbildung von Behörden und Landständen, Finanzwesen, Wirtschaft und Kultur“, Stievermann, Evangelische Territorien im Konfessionalisierungsprozeß, S. 46.
60 Vgl. Höß, Humanismus und Reformation, S. 75.
61 Vgl. dazu: Auszug aus Georg Spalatins (1484-1545) Visitationsinstruktionen 1528, in: John, Quellen zur Geschichte Thüringens, S. 60-64. Visitationen fanden später in weiten Teilen Deutschlands auch im Bereich der Hochschulen statt. Die Kommissare waren von den Hochschulen unabhängig und kamen meist aus dem direkten Einflussbereich des Landesherrn, der durch sie in besonderem Maße landesherrliche Kontrolle ausüben konnte. Vgl. U. Ludwig, Philippismus und orthodoxes Luthertum an der Universität Wittenberg. Die Rolle Jakob Andreäs im lutherischen Konfessionalisierungsprozess Kursachsens (1576-1580) (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 153), Münster 2009, S. 328 und weiterführend: K. A. H. Burkhardt, Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen von 1524 bis 1545. Die Visitationen in den heutigen Gebietsteilen der Königreiche Preußen und Sachsen, des Großherzogtums Weimar, der Herzogtümer Gotha, Meiningen, Altenburg, des Herzogtums Braunschweig und der Fürstentümer schwarzburg-Rudolstadt, -Sonderhausen, Reuß jüngere Linie und Reuß ältere Linie, Neudruck der Ausgabe Leipzig 1879, Aalen 1981. Frühste Formen von Visitationen sind auch für Thüringen belegbar, vgl. dazu: R. Herrmann, Die Kirchenvisitationen im Ernestinischen Thüringen vor 1528 in: Beiträge zur Thüringischen Kirchengeschichte 1 (1930), S. 167-230 und Bauer, Reformation und Territorialstaat, S. 52-59.
62 Vgl. als knappe Zusammenfassung der klösterlichen Struktur Thüringens: Bünz, Martin Luthers Orden, S. 21-30.
63 Vgl. V. Leppin, Martin Luther (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance), Darmstadt 2006, S. 269. Vgl. zu den Verlaufsformen territorialer Reformation: Stievermann, Evangelische Territorien im Konfessionalisierungsprozeß, S. 45-65, bes. 48ff.
64 Vgl. Leppin, Martin Luther, S. 270 und zum vorreformatorischen sächsischen Gesetzesentwurf einer frühen Polizeyordnung, die auch die kirchlich-sittliche Ordnung thematisierte: Bünz/Volkmar, Das landesherrliche Kirchenregiment, S. 90.
65 Vgl. E. Schubert, Fürstenreformation. Die Realität hinter einem Vereinbarungsbegriff, in: E. Bünz/S. Rhein/G. Wartenberg (Hg.), Glaube und Macht. Theologie, Politik und Kunst im Jahrhundert der Reformation (Schriften der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 5), Leipzig 2005, S. 23-47. Der Wille zur Reform im Sinne Luthers ist ferner im Hinblick auf die Notwendigkeit einer stabilen kirchlichen Ordnung für das gesellschaftliche Leben zu sehen. Das häufig unbedachte und vorschnelle Vorgehen von Stadträten gegen etablierte kirchliche Einrichtungen, wie innerstädtische Stifte, brachte enorme Spannungen in die Bevölkerung, die so groß waren, dass die ordnende Hand des Landesherrn dringend notwendig wurde. Vgl. H. Klueting, Das Konfessionelle Zeitalter. Europa zwischen Mittelalter und Moderne, Darmstadt 2007, S. 205. Das Eingreifen des Landesherrn war unabdingbar geworden, doch stellt dies auch für Luther nur eine Notlösung dar, da die Kirche eigentlich von der Gemeinde her getragen sein soll. Das Eingreifen des Landesherrn war aber auch gegenüber immer radikaler werdenden Positionen innerhalb des reformatorischen Aufbruchs notwendig. Vgl. dazu Goertz, Radikalität der Reformation, hier bes. S. 52f.
66 Vgl. G. Seebaß, Geschichte des Christentums III. Spätmittelalter – Reformation – Konfessionalisierung (Theologische Wissenschaft 7), Stuttgart 2006, S. 128.
67 Vgl. Klueting, Das Konfessionelle Zeitalter, S. 205. Die Theologen Johanns des Beständigen verfassten 1528 eine Schrift unter dem Titel: „Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn im Kurfürstentum Sachsen“ und legten damit in kurzen Weise die Anforderungen und Grundsätze der neuen Lehre dar. Vgl. Jadatz, Wittenberger Reformation im Leipziger Land, S. 54. Hierin wird deutlich, dass es keinesfalls beabsichtig war, eine Alternative anzubieten. Ganz bewusst wurde so die Reformation staatlich verordnet. Die Konsequenz aus den erstellten Handreichungen war, dass diejenigen Geistlichen ihr Amt aufgeben mussten, die nicht die neue Lehre annehmen wollten bzw. die, die an ihnen befundenen Mängel nicht beseitigen konnten.
68 Bereits im August 1525 erließ Johann die Verordnung, dass die Geistlichkeit künftig das Wort Gottes „lauter und rein“ zu verkündigen habe und die Messe in Deutsch zu feiern sei. Vgl. E. Koch, Art. Thüringen, in: TRE 33, S. 497-523, hier S. 505.
69 Vgl. Höß, Humanismus und Reformation, S. 78.
70 Diese Kirchenordnungen ersetzten nicht nur die Formen des kanonischen Rechts, sondern verbanden in besonderer Weise das vorgelegte Bekenntnis (Katechismus) mit der kirchlichen Ordnung und Rechtsprechung. Vgl. dazu Klueting, Das Konfessionelle Zeitalter, S. 206. Diese grundlegende Umformung beeinflusste die Rechtsordnung und Rechtsprechung enorm. Vgl. dazu weiterführend: C. Strohm /H. de Wall (Hg.), Konfessionalität und Jurisprudenz in der frühen Neuzeit (Historische Forschungen 89), Berlin 2009.
71 Vgl. Koch, Art. Thüringen, S. 505 und Bauer, Reformation und Territorialstaat, S. 69-73.
72 Vgl. Höß, Humanismus und Reformation, S. 86.
73 Vgl. weiterführend: E. Iserloh, Luthers Kirchenbegriff und seine Zwei-Reiche-Lehre. Das landesherrliche Kirchenregiment, in: H. Jedin (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. IV: Reformation – Katholische Reform und Gegenreformation, Freiburg u.a. 1985, S. 229-233.
74 Vgl. Höß, Humanismus und Reformation, S. 98. Besonders in den ernestinischen Gebieten Thüringens konzentrierten sich die Herzöge nach dem Verlust der Kurwürde 1547 auf die Konfessionspolitik. Vgl. dazu: Gehrt, Die Anfänge einer konfessionell bestimmten Identität in Thüringen und den ernestinischen Landen, S. 54f und S. Westphal, Nach dem Verlust der Kurwürde. Die Ausbildung konfessioneller Identität anstelle politischer Macht bei den Ernestinern, in: M. Wrede/H. Carl (Hg.), Zwischen Schande und Ehre. Erinnerungsbruche und die Kontinuität des Hauses. Legitimationsmuster und Traditionsverständnis des frühneuzeitlichen Adels in Umbruch und Krise (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, Beiheft 73), Mainz 2007, S. 175-177.
75 Vgl. Iserloh, Luthers Kirchenbegriff, S. 233. Das Recht der Gemeinde ihre Vertreter zu bestimmen wurde demnach zunehmend auf den Landesherrn konzentriert.
76 Der Jurist Joachim Stephani fasste im 17. Jahrhundert die Kompetenz des Landesherrn über die Konfession seiner Untertanen zu entscheiden in den Worten „Cuius regio eius religio“ treffend zusammen. Vgl. A. Schindling, Wie entstand die deutsche Konfessionskarte der Jahre 1555 bis 1945? Die Territorien des Reichs und der baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Zur Reihe „Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung (KLK)“ der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum (CC), in: Holzbrecher, S./Müller, T. (Hg.), Kirchliches Leben im Wandel der Zeit. Perspektiven und Beiträge der (mittel)deutschen Kirchengeschichtsschreibung. Festschrift für Josef Pilvousek (EThSt 104), Würzburg 2013, S. 285-298, hier S. 285.
77 Vgl. Klueting, Das Konfessionelle Zeitalter, S. 198. Der Wille des Landesherrn entschied über das kirchliche Leben. Bereits Herzog Georg (der Bärtige) von Sachsen (1471-1500-1539), selbst noch strenger Verfechter des Katholizismus aus dem Hause der Albertiner, schrieb Kurfürst Friedrich dem Weisen am 2. Februar 1522: „das sulchs von a. l. gstat werd […] den leuten, welchen doch a. l. wol staweren kont, mit dem wenigisten, wo sy nur vormerkten, das es a. l. nicht haben wolt.“ Hier zit. nach: Bünz/Volkmar, Das landesherrliche Kirchenregiment, S. 109. Sein Vorgehen gegen die neuen Gebräuche war teilweise hart. So verwies er 80 Familien seines Landes, da sie im Kursächsischen auf lutherische Weise kommuniziert hatten, ließ den Entführer einer Nonne hinrichten, konfiszierte Lutherbibeln, die er später verbrennen ließ, und sorgte für die Einführung sogenannter Beichtzettel. Vgl. S. Seifert, Niedergang und Wiederaufstieg der katholischen Kirche in Sachsen 1517-1773 (Studien zur katholischen Bistums- und Klostergeschichte 6), Leipzig, ohne Jahr, S. 5f. „Georg soll gesagt haben: ‚Er wolle lieber mit seiner Gemahlin nackt und bloß, den Stab in der Hand, freiwillig ins Elend gehen, als seinen Untertanen erlauben, daß sie nur in dem kleinsten Teil von der katholischen Kirche abwichen, bevor nicht auf einem allgemeinen Konzil anders beschlossen wäre.‘“ Ebd., S. 5. Vgl. zudem: Klein, Ernestinisches Sachsen, S. 13.
78 Vgl. Klueting, Das Konfessionelle Zeitalter, S. 199.
79 Vgl. weiterführend: U. Heß, Geschichte der Behördenorganisation der thüringischen Staaten und des Landes Thüringen von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Jahr 1952 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen, Kleine Reihe 1), Jena-Stuttgart 1993.
80 Vgl. Freisen, Verfassungsgeschichte, S. 352.
81 Vgl. Herz, Die Grafen von Schwarzburg, S. 31.
82 Vgl. ebd.
83 Wie undifferenziert die damaligen „konfessionellen“ Verhältnisse waren, zeigt sich insbesondere da, wo weltliche Macht in Verbindung mit kirchlichem Amt auftrat. Beispiele sind das gemischte Domkapitel zu Halberstadt, oder Bischof Heinrich Julius von Braunschweig Wolfenbüttel (1564-1613), der als Protestant schon als Kleinkind (unter Vormundschaft) Administrator des Bistums Halberstadt im Jahre 1566 wurde, und damit den Beginn dieser merkwürdigen Verknüpfung, die vier seiner Nachfolger weiterführten, setzte. Zugleich ist auch dies Zeichen dafür, wie wenig eine Konfessionalisierung vorlag und wie eng die Verbindungen waren, so dass auch im evangelischen Bereich viele dem lutherischen Bekenntnis entgegenlaufende Praktiken und Ordnungen bestehen blieben. An der Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse änderte dies jedoch nichts. Erst zum Ende des 16. Jahrhunderts trat die Konfessionalisierung in eine Phase, die zunehmend Abgrenzungen ermöglichte und damit weitere Konfrontationen schuf. Vgl. dazu weiterführend: A. Odenthal, Die „Ordinatio cultus divini et caeremoniarium“ des Halberstädter Domes von 1591. Untersuchungen zur Liturgie eines gemischtkonfessionellen Domkapitels nach Einführung der Reformation (LQF 93), Münster 2005 und G. May, Die deutschen Bischöfe angesichts der Glaubensspaltung des 16. Jahrhunderts, Wien 1983. Hier bes.: Das Bistum Halberstadt, S. 279-287. Weiterhin: A. Schindling, Konfessionalisierung und Grenzen von Konfessionalisierbarkeit, in: Ders./W. Ziegler (Hg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land der Konfession 1500-1650. Bilanz – Forschungsperspektiven – Register (KLK 57), Münster 1997, S. 9-44 und G. Schmidt, Konfessionalisierung, Reich und deutsche Nation, in: A. Schindling/W. Ziegler (Hg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land der Konfession 1500-1650. Bilanz – Forschungsperspektiven – Register (KLK 57), Münster 1997, S. 171-199; W. H. Neuser, Die Konfessionalisierung des Protestantismus im 16. Jahrhundert, in: H. Baier (Hg.), Konfessionalisierung vom 16.-19. Jahrhundert. Kirche und Traditionspflege. Referate des 5. Internationalen Kirchenarchivtags Budapest 1987 (Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche 15), Neustadt an der Aisch 1989, S. 11-26; H.-W. Krumwiede, Lutherische „Konfessionalisierung“ von Kirche, Staat und Gesellschaft im 16. Jahrhundert, in: H. Baier (Hg.), Konfessionalisierung vom 16.-19. Jahrhundert. Kirche und Traditionspflege. Referate des 5. Internationalen Kirchenarchivtags Budapest 1987 (Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche 15), Neustadt an der Aisch 1989, S. 37-50. Vgl. weiterführend zum Thema Konfessionalisierung: A. Luttenberger (Hg.), Katholische Reform und Konfessionalisierung (Ausgewählte Quellen zur deutschen Neuzeit 17), Darmstadt 2006.
84 Vgl. Art. V, §2 Instrumentum Pacis Osnabrugensis [IPO]. Vgl. dazu: A. Reese, Pax sit Christiana. Die westfälischen Friedensverhandlungen als europäisches Ereignis (Historisches Seminar 9), Düsseldorf 1988, S. 134.
85 Vgl. Art. VII, §1 IPO. Vgl. dazu: Reese, Pax sit Christiana, S. 142.
86 Vgl. Art. V, §34 IPO. Vgl. dazu: Reese, Pax sit Christiana, S. 140.
87 Vgl. A. Holzem, Der Dreißigjährige Krieg und der Westfälische Friede, in: T. Kaufmann /R. Kottje (Hg.), Ökumenische Kirchengeschichte, Bd. 2.: Vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit, Darmstadt 2008, S. 430-448, hier S. 446 und Aschoff, Die Diaspora, S. 47f. Im Hinblick auf eine Bewertung der zu erteilenden Genehmigungen sollte jedoch bedacht werden, dass sowohl staatliche Stellen als auch katholische Bittsteller oft daran zweifelten, ob entsprechende Verordnungen des Friedensvertrags überhaupt Anwendung finden konnten.
88 Vgl. H. Schneider, Konfessionalität und Toleranz im protestantischen Deutschland des 18. Jahrhunderts, in: H. Baier (Hg.), Konfessionalisierung vom 16.-19. Jahrhundert. Kirche und Traditionspflege. Referate des 5. Internationalen Kirchenarchivtags Budapest 1987 (Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche 15), Neustadt an der Aisch 1989, S. 87-106, hier S. 89.
89 Vgl. Freisen, Staat und katholische Kirche, S. 148, vgl. dazu auch: Holzem, Der Dreißigjährige Krieg und der Westfälische Friede, S. 446.
90 Das Recht der „devotio domestica simplex“ musste den Katholiken, insofern der Landesherr sie im Land duldete, gewährt werden. Bürgerrechte blieben ihnen jedoch weitestgehend verwehrt, so dass eine grundsätzliche Differenz innerhalb der Bevölkerung bestehen blieb. Vgl. Aschoff, Die Diaspora, S. 48.
91 Vgl. Holzem, Der Dreißigjährige Krieg und der Westfälische Friede, S. 446; Klueting, Das Konfessionelle Zeitalter, S. 352.
92 Vgl. Art. V, §37 IPO.
93 Zum Begriff der konfessionellen Hybridität vgl.: A. Schunka, Konfessionelle Liminalität, Kryptokatholiken im lutherischen Territorialstaat des 17. Jahrhunderts, in: J. Bahlcke/R. Bendel (Hg.), Migration und kirchliche Praxis. Das religiöse Leben frühneuzeitlicher Glaubensflüchtlinge in alltagsgeschichtlicher Perspektive (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands 40), Köln u.a. 2008, S. 113-132, hier S. 116 und Schindling, Wie entstand die deutsche Konfessionskarte der Jahre 1555 bis 1945, S 289f.
94 Vgl. C. Zwierlein, „convertire tutta l’Alemagna“ – Fürstenkonversionen in den Strategiedenkrahmen der römischen Europapolitik um 1600: Zum Verhältnis von „Machiavellismus“ und Konfessionalismus, in: U. Lotz-Heumann/J.-F. Missfelder/M. Pohlig (Hg.), Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 205), Heidelberg 2007, S. 63-106, hier S. 64. Verwiesen sei besonders auf die für den mitteldeutschen Raum bedeutende Konversion August des Starken, vgl. dazu weiterführend: U. Rosseaux, Das bedrohte Zion: Lutheraner und Katholiken in Dresden nach der Konversion Augusts des Starken (1697-1751), in: U. Lotz-Heumann/J.-F. Missfelder /M. Pohlig (Hg.), Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 205), Heidelberg 2007, S. 212-235.
95 Diesbezügliche Hoffnungen der römischen Kurie mussten sich zerstreuen. Vgl. R. Reinhardt, Die Katholische Kirche (1648-1789), in: T. Kaufmann/R. Kottje (Hg.), Ökumenische Kirchengeschichte, Bd. 2.: Vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit, Darmstadt 2008, S. 451-484, hier S. 452. Vgl. weiterführend zur Tätigkeit der Propagandakongregation bezüglich Deutschlands: G. Denzler, Die Propagandakongregation in Rom und die Kirche in Deutschland im ersten Jahrzehnt nach dem Westfälischen Frieden, Paderborn 1969.
96 Vgl. Art. V, § 48 IPO. Vgl. dazu: Reese, Pax sit Christiana, S. 142.
97 Die Hochstifte Metz, Toul und Verdun, die Erzstifte Bremen, Magdeburg, sowie wie die Hochstifte Verden, Halberstadt, Minden, Kammin, Schwerin, Ratzeburg und die Reichsabteien Hersfeld und Walkenried wurden säkularisiert. Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg wurde für die Abtretung Vorpommerns an Schweden ausdrücklich mit den geistlichen Territorien von Halberstadt, Magdeburg, Minden und Kammin entschädigt. Der Begriff Säkularisation wurde allerdings erst später ausgeprägt. Vgl. K. Hausberger, Reichskirche, Staatskirche, „Papstkirche“. Der Weg der deutschen Kirche im 19. Jahrhundert, Regensburg 2008, S. 32f.
98 Vgl. Aschoff, Die Diaspora, S. 44. Der Nuntius in Köln erhielt die entsprechenden Fakultäten, um für die Katholiken Norddeutschlands Jurisdiktion ausüben zu können, vgl. dazu weiterführend: B. Roberg, Das Wirken der Kölner Nuntien in den protestantischen Territorien Norddeutschlands, in: RQ 84 (1989), S. 51-73.
99 Vgl. J. Metzler, Die Apostolischen Vikariate des Nordens. Ihre Entstehung. Ihre Entwicklung und ihre Verwalter. Ein Beitrag zur Geschichte der nordischen Missionen, Paderborn 1919; vgl. weiterhin: E. Gatz, Die deutschen Katholiken und die Nordische Missionen, in: Ders., Geschichte des Kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Die katholische Kirche, Bd. III: Katholiken in der Minderheit. Diaspora – Ökumenische Bewegung. Missionsgedanke, Freiburg 1994, S. 138-142, bes. 138f.
100 Im Jahr 1709 wurde das Vikariat geteilt. Neben dem bereits bestehenden Vikariat, welches zu diesem Zeitpunkt unter Verwaltung des in Osnabrück ansässigen Titularbischofs von Columbrica, Weihbischof Otto Wilhelm von Bronckhorst zu Gronsfeld (1640-1713) fiel, entstand das Vikariat des Nordens und von Ober- und Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Dieses wurde Titularbischof Agostino Steffani (1654-1728) zugewiesen, der auch als Komponist bekannt wurde. 1780 kam es unter dem Apostolischen Vikar, dem Fürstbischof von Paderborn und Hildesheim, Friedrich Wilhelm Freiherr von Westphalen (1727-1789), zur Wiedervereinigung, wobei die Stellung als Fürstbischof auf Reichsebene gegenüber den protestantischen Landesherren besondere Autorität verleihen sollte. Vgl. dazu Aschoff, Die Diaspora, S. 44f und Metzler, Die Apostolischen Vikariate des Nordens, S. 80-87, bes. S. 85.
101 Vgl. Aschoff, Die Diaspora, S. 49. Zum Apostolischen Vikariat Sachsen vgl. bes. H. Meier, Das Apostolische Vikariat in den Sächsischen Erblanden (Studien zur katholischen Bistums- und Klostergeschichte 24), Leipzig 1981.
102 Zur Periodisierung des „langen“ 19. Jahrhunderts vom Beginn der Französischen Revolution (1789) bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) vgl. W. Siemann, Das ‚lange’ 19. Jahrhundert. Alte Fragen neue Perspektiven, in: N. Freytag /D. Petzold (Hg.), Das ‚lange‘ 19. Jahrhundert. Alte Fragen und neue Perspektiven (Münchner Kontaktstudium Geschichte 10), München 2007, S. 9-26.
103 Vgl. Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 55.
104 Vgl. ebd., S. 51-55.
105 Vgl. weiterführend: Heß, Geschichte der Behördenorganisation.
106 Den Begriff des Absolutismus ist nicht einfach auf die Thüringer Kleinstaaten zu übertragen, auch wenn es sicher absolutistische Tendenzen gab, so war doch die Herrschaft des Fürsten durch viele Faktoren, wie ein ausgeprägtes Ständewesen oder eine einflussreiche lutherische Geistlichkeit eingeschränkt. Vgl. ebd., S. 20-22 und Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 44.
107 Vgl. Ignasiak, Regenten-Tafeln Thüringer Fürstenhäuser, S. 57.
108 Hier zit. nach: Patze, Land, Volk und Geschichte, S. 204.
109 Mit den Beschlüssen des Wiener Kongresses 1815 zum Großherzogtum erhoben.
110 Vgl. Herrmann, Thüringische Kirchengeschichte, S. 394.
111 Vgl. ebd. 394f.
112 Vgl. dazu weiterführend: U. Häder, Das gemeinschaftliche Oberappellationsgericht thüringischer Staaten in Jena. Ein Beitrag zur Geschichte des Gerichtswesens im 19. Jahrhundert (Rechtshistorische Reihe 142), Frankfurt a. M. 1996.
113 Vgl. dazu weiterführend: V. Wahl, Die Anfänge der ernestinischen Landesuniversität Jena, in: H. Hoffmeister/V. Wahl (Hg.), Die Wettiner in Thüringen. Geschichte und Kultur in Deutschlands Mitte, Arnstadt-Weimar 1999, S. 167-173 und Ders., Die Universität Jena in ihrer klassischen Zeit, in: H. Hoffmeister/V. Wahl (Hg.), Die Wettiner in Thüringen. Geschichte und Kultur in Deutschlands Mitte, Arnstadt-Weimar 1999, S. 303-308.
114 Reuß-Ebersdorf, Reuß-Lobenstein und Reuß-Schleiz.
115 Vgl. Aschoff, Die Diaspora, S. 50.
116 Vgl. dazu weiterführend: A. Wand, Reformation, katholische Reform und Gegenreformation im kurmainzischen Eichsfeld (1520-1648), Heilbad Heiligenstadt 1998 und Opfermann, B., Die kirchliche Verwaltung des Eichsfeldes in seiner Vergangenheit, Leipzig 1958.
117 Vgl. weiterführend: J. Pilvousek, Politischer Katholizismus im preußischen Thüringen (Zentrum-Eichsfeld), in: Thüringer Landtag (Hg.), Kirchen und kirchliche Aufgaben in der parlamentarischen Auseinandersetzung in Thüringen vom frühen 19. bis ins ausgehende 20. Jahrhundert (Schriften zur Geschichte des Parlamentarismus in Thüringen 23), Weimar 2005, S. 155-175.
118 Vgl. zu seiner Person weiterführend: V. Ebersbach, Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Goethes Herzog und Freund, Köln 1998; J. Klauß, Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach: Fürst und Mensch. Sieben Versuche einer Annäherung, Weimar 1991; H. Tümmler, Herzog/Großherzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Förderer und fürstlicher Mittelpunkt der deutschen Klassik, Bonn 1989; A. Pöthe/R. Jonscher, Carl August, Herzog bzw. Großherzog von Sachsen-Weimar und Eisenach, in: D. Ignasiak (Hg.), Herrscher du Mäzene. Thüringer Fürsten von Hermenefred bis Georg II, Rudolstadt-Jena 1994, S. 333-366.
119 Das Jahr 1793 bildete den Auftakt der Auseinandersetzung der thüringischen Staaten mit Frankreich an der Seite Preußens, für die Reußen an der Seite Österreichs. Ziel des europäischen Bündnisses war es die Revolution rückgängig zu machen und die alte politische Ordnung wieder herzustellen. Als Preußen 1795 einen Separatfrieden mit den sich behauptenden Franzosen in Basel anstrebte, erreichte Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach die Einbindung seines Staates und anderer ernestinischer Kleinstaaten in die Verhandlungen. Am 13. August 1796 schlossen sich Kursachsen, Sachsen-Gotha-Altenburg und die Schwarzburger Staaten dem Frieden an. Ein Jahr darauf folgten die reußischen Lande, die sich an Österreich hielten, das am 17. Oktober 1797 Frieden schloss. Vgl. W.-J. Schuster, Napoleon in Thüringen 1806. Man lädt uns ein zum Stelldichein, Jena 1993, S. 29.
120 Vgl. dazu weiterführend: H. Klueting (Hg.), 200 Jahre Reichsdeputationshauptschluss. Säkularisation, Mediatisierung und Modernisierung zwischen Altem Reich und neuer Staatlichkeit (Schriften der Historischen Kommission für Westfalen 19), Paderborn 2005; M. Martin, Staat, Recht und Kirche. Der Weg der katholischen Kirche in Mitteleuropa bis ins 19. Jahrhundert, Berlin 2000.
121 Vgl. R. Joscher/W. Schilling, Kleine thüringische Geschichte. Vom Thüringer Reich bis 1990, Jena 32001, 160. Zeitweise hat sich auch Kursachsen um die mainzischen Gebiete Thüringens bemüht, die als Entschädigung für die Auflösung des Kurfüstentums Trier an den Trierer Erzbischof Clemens Wenzeslaus, dem Onkel des Sächsischen Kurfürsten Friedrich August III. (1750-1827), zugesprochen werden sollten. Nach Tod des Erzbischofs sollten entsprechende Gebiete Kursachsen zugeschlagen werden. Vgl. H. Meier, Die katholische Kirche in Sachsen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Eine Untersuchung zur Rechts- und Verfassungsgeschichte (Studien zur katholischen Bistums- und Klostergeschichte 15), Leipzig 1974, S. 10.
122 Vgl. H. Herz, Regierende Fürsten in den thüringischen Territorialstaaten vom 16. Jahrhundert bis 1918, in: ZVThG 47 (1993), S. 17-31, hier S. 22.
123 In Meiningen regierte Herzogin Louise Elenore (1763-1803-1822) für ihren minderjährigen Sohn Bernhard II. und in Coburg Herzog Franz Friedrich (1750-1800-1806).
124 Vgl. Schuster, Napoleon in Thüringen 1806, S. 30.
125 Vgl. ebd.
126 In erster Linie brachte er Frankreich große Vorteile ein, das damit den Untergang des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation besiegelte und im Osten einen von ihm abhängigen Staatenbund begründete. In Art 1. der Akte ist demnach das Grundanliegen formuliert: „die Staaten […] werden auf ewig von dem Territorium des deutschen Reichs getrennt, und unter sich durch eine besondere Konföderation unter dem Namen: Rheinische Bundesstaaten vereinigt.“ Rheinbundakte Art. 1. Die Einzelstaaten wie Bayern, Württemberg und Baden erhielten größere Unabhängigkeit, gewährten einander militärischen Schutz und stiegen zu einem Großteil in ihrem Rang auf. Schon im Vorfeld wurde der Königstitel für Bayern und Württemberg durch die Franzosen im Reich erwirkt. Vgl. Rheinbundakte Art. 5. Eine Weigerung der größeren deutschen Mittelstaaten nun auch den Rheinbund zu begründen, hätte den Verlust jüngster Erwerbungen bedeutet. Vgl. W. Burgdorf, Ein Weltbild verliert seine Welt. Der Untergang des Alten Reiches und die Generation 1806 (baR 2), München 2006, S. 118.
127 Vgl. Martin, Staat, Recht und Kirche, S. 302.
128 „Wir erklären demnach durch Gegenwärtiges, daß Wir das Band, welches Uns bis jetzt an den Staatskörper des deutschen Reichs gebunden hat, als gelöst ansehen, daß Wir das reichsoberhauptliche Amt und Würde durch die Vereinigung der conföderierten rheinischen Stände als erloschen und Uns dadurch von allen übernommenen Pflichten gegen das deutsche Reich losgezählt betrachten und die von wegen desselben bis jetzt getragene Kaiserkrone und geführte kaiserliche Regierung, wie hiermit geschieht, niederlegen.“, Erklärung Kaiser Franz II. zur Niederlegung der Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, hier zit. nach: Martin, Staat, Recht und Kirche, S. 303.
129 Vgl. Schuster, Napoleon in Thüringen 1806, S. 31.
130 Vgl. P. Braun, Die Franzosen in Weimar, in: Thüringisch-Sächsische Zeitschrift für Geschichte und Kunst 10 (1920), S. 1-64, bes. S. 2-15, und allgemein: Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 57.
131 Vgl. H. Moritz/M. Moritz, Das Fürstentum Erfurt und die Herrschaft des großen Kaisers. Leben und Sterben in bewegter Zeit. 1806-1814 (Schriften des Museums für Thüringer Volkskunde 26), Erfurt 22008, S. 48. Ein Fortbestehen der Kleinstaaten war keinenfalls gesichert, brachte aber auch Vorteile für die Franzosen, etwa durch die dynastischen Verwandschaftsverhältnisse zum russischen Zarenhaus, wie sie in Weimar und Coburg gegeben waren. Vgl. A. Schmidt, Prestige, Kultur und Außendarstellung, Überlegungen zur Politik Sachsen-Weimar-Eisenachs im Rheinbund (1806-1813), in: ZVThG 59/60 (2005/06), S. 153-192, hier, S. 153.
132 Vgl. Moritz, Das Fürstentum Erfurt, S. 49 und Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 58
133 Vgl. F. Boblenz, Die Wettiner in der napoleonischen Ära, in: H. Hoffmeister/V. Wahl (Hg.), Die Wettiner in Thüringen. Geschichte und Kultur in Deutschlands Mitte, Arnstadt-Weimar 1999, S. 335-341, hier S. 336f.
134 Vgl. K.-D. Kaiser, Erfurt, Napoleon und Preußen 1802 bis 1816 (Kleine Schriften des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt e.V. 6), Erfurt 2002, S. 207. Vgl. dazu den Bericht des Ignaz Ferdinand Arnold über das am 27. September 1808 illuminierte Erfurt: „Noch bemerkte ich folgende Inschriften. […] Gäb’s jetzt noch einen Götter-Sohn So wär’s gewiß Napoleon. […] Unter einem Bilde, auf welchem sich über einem Opferaltar die beiden Kaiser die Hände geben: Vivat Napoleon Maximus! Heil diesen Tagen! Heil allen in Erfurts Ringmauern! Der Nährstand leidet, der Wehrstand streitet. Gott, gib Frieden allen Landen! Möchte doch Napoleon Unsre Sehnsucht stillen! Dann lasset uns mit Jubelton Tal und Berg erfüllen!“ Hier zit. nach: John, Quellen zur Geschichte Thüringens, S. 139f. Im Erfurter Fürstenkongress trafen Napoleon und Zar Alexander zu entsprechenden Verhandlungen zusammen. Das Treffen entwickelte sich zu einer der größten Zusammenkünfte des europäischen Adels auf mitteldeutschem Boden. Dabei stand nicht die Notwendigkeit einer Verhandlungsteilhabe, sondern die zu erreichende Aufmerksamkeit im Zentrum des fürstlichen Aufgebots. Viele versprachen sich einen wachsenden Einfluss, wenn sie dem Kaiser in Erfurt als treue Bündnispartner huldigten. Vgl. Kaiser, Erfurt, Napoleon und Preußen 1802 bis 1816, S. 207. Der Erfurter Fürstenkongress zeichnet sich demnach durch seine Symbolkraft aus. Vgl. dazu weiterführend: G. Mai, Das Erfurter Kaisertreffen 1808. Höfisches Zeremoniell – symbolische Ordnung – inszenierte Macht, in: ZThG 64 (2010), S. 269-300. Die Verhandlungen selbst werden in ihrer Tragweite unterschiedlich bewertet. Mai verweist auf diesen Umstand, wonach bei Franz Schnabel, Heinrich von Srbik und Thomas Nipperday der Kongress keine Erwähnung fand, im Gegensatz zu Heinrich von Treitschke, der große politische Folgen für Preußen durch eine Verschärfung der Tilsiter Friedensbeschlüsse sah. Vgl. ebd. S. 269. Zu Tilsiter Friedensbeschlüssen im Speziellen vgl. ebd. S. 279-285.
135 Vgl. E. Zeeden, Europa im Umbruch. Von 1776 bis zum Wiener Kongreß (Studienbuch Geschichte Darstellung und Quellen 7), Stuttgart 1982, S. 76f.
136 Zwischen den Mächten wurde eine „Heilige Allianz“ proklamiert, die eine undefinierbare Form eines allgemeinen Christentums schuf, das den Gegensatz zum Gedankengut der Revolution unterstrich. Vgl. Besier, Kirche, Politik und Gesellschaft, S. 3 und G. Maron, Das 19. Jahrhundert. Gesellschaft – Staat – Kirche, in: H. Baier (Hg.), Kirche in Staat und Gesellschaft im 19. Jahrhundert (Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche 17), Neustadt an der Aisch 1992, S. 21-47, hier S. 30.
137 Vgl. zur angestrebten Rolle Sachsen-Weimar-Eisenachs weiterführend: H. Philippi, Die Wettiner in Sachsen und Thüringen (Aus dem Deutschen Adelsarchiv 9), Limburg 1989, S. 59f.
138 Brief des Weimarer Ministers Ernst Christian August von Gersdorff vom Wiener Kongress an den Herzog Carl August, 26. März 1815, hier zit. nach: John, Quellen zur Geschichte Thüringens, S. 147.
139 Am 23. Mai 1815 wurden die grundlegenden Vereinbarungen zwischen Preußen und Österreich getroffen, woraufhin die „Deutsche Bundesakte“ erarbeitet, am 8. Juni 1815 paraphiert und am 10. Juni 1815 besiegelt wurde; vgl. J. Müller, Der Deutsche Bund 1815-1866 (Enzyklopädie Deutscher Geschichte 78), München 2006, S. 4.
140 Vgl. T. Nipperdey, Deutsche Geschichte, 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat, München 1983, S. 595.
141 Den Revolutionären ging es um grundlegende politisch-gesellschaftliche Änderungen mit Forderungen wie: Aufhebung des Parteiverbotes, d.h. gleichzeitig Freigabe der politischen Öffentlichkeit, Pressefreiheit, Demokratisierung der Justiz, Bauernbefreiung und die Schaffung eines deutschen Nationalparlamentes, Punkte, die für die bestehende staatliche Ordnung geradezu revolutionär waren. Vgl. Nipperdey, Deutsche Geschichte, S. 595.
142 Schon 1817 forderten Studenten auf dem Wartburgfest eine demokratischere Verfassung und die Vereinigung der deutschen Staaten. Auf dem Hambacher Fest von 1832 wurde gleiches propagiert. Vgl. weiterführend: K. Luys, Die Anfänge der deutschen Nationalbewegung von 1815 bis 1819, Münster 1992, S. 218-222. Am 18. Oktober 1818 fand ein zweiter Burschenschaftstag in Jena statt. In einem politischen Programm, den „Grundsätzen und Beschlüssen des 18. Oktober“, wurden Forderungen klar ausformuliert, am deutlichsten die, die nach der Einheit Deutschlands verlangte und einen eigenen Willen des Volkes propagierte: „1. Ein Deutschland ist und ein Deutschland soll sein und bleiben. Je mehr die Deutschen durch verschiedene Staaten getrennt sind, desto heiliger ist die Pflicht für jeden frommen und edlen deutschen Mann und Jüngling, dahin zu streben, daß die Einheit nicht verloren gehe und das Vaterland nicht verschwinde. […] 16. Der Wille des Fürsten ist nicht das Gesetz des Volkes sondern das Gesetz des Volkes soll der Wille des Fürsten sein.“ Hier zit. nach: John, Quellen zur Geschichte Thüringens, S. 155f. Trotz des Einheitsstrebens blieb auch eine gewisse Anhänglichkeit an die föderative Ordnung Deutschlands bestehen. So forderte die Frankfurter Nationalverfassung eine Bundesstaatenlösung, vgl. H.-W. Hahn, Region und Integration: Landesbewußtsein, Nationalität und europäische Einigung in der hessischen und thüringischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Hessische Landeszentrale für politische Bildung (Hg.), Region und Integration. Hessen und Thüringen im 19. und 20. Jahrhundert (Kleine Schriftenreihe zur hessischen Landeskunde 1) Wiesbaden o.J., S. 5-23, S. 10.
143 Sachsen-Weimar-Eisenach nahm mit dem sachsen-weimarischen Grundgesetz 1816 eine Vorreiterrolle diesbezüglich ein. Vgl. dazu John, Quellen zur Thüringer Geschichte, S. 148-150 und H. Hürten, Restauration und Revolution im 19. Jahrhundert (Studienbuch Geschichte Darstellung und Quellen 8) Stuttgart 1981, S. 13. Auch Schwarzburg-Rudolstadt schuf ebenfalls bereist 1816 eine Verfassung, die jedoch erst 1821 in Kraft trat. Vgl. D. Blaha, Verdienste um Verfassung und Verwaltung, in: H. Hoffmeister/V. Wahl (Hg.), Die Wettiner in Thüringen. Geschichte und Kultur in Deutschlands Mitte, Arnstadt-Weimar 1999, S. 367-373, bes. S. 370; Heß, Geschichte der Behördenorganisation, S. 55 und Hahn, Region und Integration, S. 7 und Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 64: Auch in Sachsen-Hildburghausen (1818), Sachsen-Coburg-Saalfeld (1821) und Sachsen-Meiningen (1824) wurden Verfassungen eingesetzt.
144 Die Neukonzeptionierung einer gesamtstaatlichen Ordnung brachte starke Zerwürfnisse hervor. Eine Minderheit wollte die Errichtung eines republikanischen Staates. Die Mehrheit plädierte für eine konstitutive Monarchie, debattierte allerdings lange über die Frage, ob der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn zum vereinten Deutschland hinzugehören sollte. Die sich in der Frankfurter Paulskirche durchsetzende Konzeption einer konstitutiven Monarchie für Deutschland, mit Ausschluss Österreichs, unter Führung eines Erbkaisertums scheiterte. Die Widerstände unter den Monarchen waren sehr groß. Als Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861), König von Preußen, die ihm angebotene Kaiserkrone ablehnte, da er keine Krone aus der Hand des Volkes annehmen und an seiner alten Herrschaftslegitimation festhalten wollte, war die Nationalversammlung der Paulskirche in ihrem Anliegen zunächst gescheitert. Vgl. Nipperdey, Deutsche Geschichte, S. 616.
145 Thüringen war schon vor 1848 zu einer Kernregion der nationalen und liberalen Bewegung geworden. Allerdings fehlt eine aggressive Gegenbewegung zu den kleinstaatlichen Dynastien. Vgl. dazu: H.-W. Hahn, Die „Selbstregierung“ des „freien Bürgers“: Thüringen und die Revolution von 1848/49, in: Thüringer Landtag (Hg.), Parlamente und Parlamentarier Thüringens in der Revolution von 1848/49 (Schriften zur Geschichte des Parlamentarismus in Thüringen 11), Weimar 1998, S. 1123, hier S. 23. Darüber hinaus verstand man sich zunehmend aus einer regionalen Definition heraus, die den einzelnen Kleinstaat überformte und den Blick auf die Region Mitteldeutschland/Thüringen lenkte. Ein „überstaatlich“ geprägtes Vereinswesen trug dazu entscheidend bei. Vgl. Hahn, Region und Integration, S. 10f.; Vgl. weiterführend: F. Burkhardt, Revolution von 1848/1849 und thüringische Identität, in: Comparativ 13 (2003), S. 116-150. Verwiesen sei auch auf den Bereich der Kircheneinigungsbestrebungen in den Jahren 1848/1849, vgl. dazu weiterführend: E. Koch, Kircheneinigungsbestrebungen in den Jahren 1848/1849 in Thüringen und ihre Nachwirkungen bis zur Landesgründung 1920, in: H.-W. Hahn/W. Greiling (Hg.), Die Revolution von 1848/1849 in Thüringen. Aktionsräume, Handlungsebenen, Wirkungen. Jena-Rudolstadt 1998, S. 303-321.
146 In Reuß ä. L. gab es Auseinandersetzungen, die unter militärischer Beteiligung beendet wurden.
147 Vgl. dazu weiterführend: H.-W. Hahn/W. Greiling/K. Ries (Hg.), Bürgertum in Thüringen, Lebenswelt und Lebenswege im frühen 19. Jahrhundert, Rudolstadt-Jena 2001; und im Speziellen zum Großherzogtum Sachsen: J. Grass, Sachsen-Weimar-Eisenach Verwaltungsreform nach der Revolution von 1848/49 als liberales Lehrstück im reaktionären Umfeld, in: ZVThG 54 (2000), S. 205-231, bes. S. 209f.
148 Vgl. Hahn, Die „Selbstregierung“ des „freien Bürgers“, S. 26.
149 Vgl. P. Wentzcke, Thüringische Einigungsbestrebungen im Jahre 1848. Ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen Einheitsbewegung, in: ZVThGA, 7. Beiheft (1917), S. 15 und F. Boblenz, Die Revolution von 1848/49, H. Hoffmeister/V. Wahl (Hg.), Die Wettiner in Thüringen. Geschichte und Kultur in Deutschlands Mitte, Arnstadt-Weimar 1999, S. 383-389, hier S. 384.
150 Vgl. G. Müller, Die thüringischen Landtage in der Revolution von 1848/49, in: Thüringer Landtag (Hg.), Parlamente und Parlamentarier Thüringens in der Revolution von 1848/49 (Schriften zur Geschichte des Parlamentarismus in Thüringen 11), Weimar 1998, S. 34-124, hier S. 34.
151 Missernten und Wirtschaftskrise in den Jahren 1846 und 1847 verschärften die Lage in Thüringen. Vgl. Boblenz, Die Revolution vom 1848/49, S. 383.
152 Vgl. Wentzcke, Thüringische Einigungsbestrebungen im Jahre 1848, S. 16.
153 Rückblick eines Thüringers, in: Das Handwerk. Organ der verbundenen Vereine Thüringens Nr. 52, 10. Oktober 1849, hier zit. nach: Hahn, Die „Selbstregierung“ des „freien Bürgers“, S. 18.
154 Vgl. Wentzcke, Thüringische Einigungsbestrebungen im Jahre 1848, S. 25.
155 Vgl. ebd., S. 35.
156 Vgl. Herz, Regierende Fürsten, S. 23.
157 Wentzcke, Thüringische Einigungsbestrebungen im Jahre 1848, S. 36.
158 Vgl. Boblenz, Die Revolution vom 1848/49, S. 388.
159 Erste Pläne gingen dahin die ernestinischen Herzogtümer zu vereinigen, später sogar ein einheitlichen Thüringen mit den schwarzburgischen und reußischen Staaten zu bilden. Vgl. Boblenz, Die Revolution vom 1848/49, S. 385.
160 Vgl. dazu den Entwurf über eine engere Verbindung der Thüringer Kleinstaaten vom 15. Dezember 1848, in John, Quellen zur Geschichte Thüringens, S. 178f.
161 Vgl. Boblenz, Die Revolution vom 1848/49, S. 387. Das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach hatte demnach ein verständliches Interesse am Gelingen der Verhandlungen. Vgl. dazu auch Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 67.
162 Diese waren so groß, dass gemäßigte Demokraten begannen den militärischen Interventionskurs der Regierungen mit zu tragen. Vgl. dazu: Hahn, Die „Selbstregierung“ des „freien Bürgers“, S. 22.
163 „Die Bewegungen, welche in der jüngst verflossenen Zeit in den verschiedenen Staaten von Thüringen stattgefunden und die gesetzliche Ordnung daselbst soweit gestört haben, daß mehrere Staatsregierungen sich außer Stande sehen, durch ihre eigene Macht die Herrschaft der Gesetze aufrecht zu halten, haben die provisorische Centralgewalt für Deutschland veranlaßt, den k. preußischen Appellations-Gerichtsrath Ludwig von Mühlenfels als Reichscommissar für den Umfang der sämmtlichen großherzogl. und herzogl. sächsischen, dann der fürstlich reußischen und schwarzburgischen Länder zu ernennen und denselben zu beauftragen, im Namen der Reichsgewalt alle zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung und der Herrschaft der Gesetze in diesen Ländern erforderlichen Maßregeln zu ergreifen […] Sämmtliche Civil- und Militärbehörden in den genannten thüringischen Ländern werden hiermit angewiesen, den Verfügungen des Reichscommissars unweigerlich und ungesäumt Folge zu leisten und denselben in der Durchführung aller von ihm getroffenen Maßregeln kräftigst zu unterstützen. Die k. preußische, k. baiersche und k. sächsische Staats-Regierungen werden unter Einem ersucht, dem genannten Reichscommissar bei allen seinen Anordnungen die vollste Unterstützung zu leihen.“ Vollmacht für den Reichskommissar für Thüringen, hier zit. nach: John, Quellen zur Geschichte Thüringens, S. 174f. Straßenkämpfe und auswärtige Militärhoheit gab es auch in diesen. Allerdings muss gesagt werden, dass grundsätzlich eine Kompromissbereitschaft zwischen gemäßigten Demokraten und konstitutionell geprägten Reformern festzustellen ist. Thüringen galt als eine „Enklave des Friedens inmitten des Bürgerkrieges“. Hahn, Die „Selbstregierung“ des „freien Bürgers“, S. 23. Einzig in Sachsen-Altenburg dankte ein regierender Herzog in Folge der Revolution ab. Herzog Joseph (1789-1868) von Sachsen-Altenburg trat zu Gunsten seines Bruders Georg (1796-1853) am 30. November 1848 von den Regentschaft zurück.
164 Interessant erscheint dennoch, dass trotz aller Sorge der Thüringer Landesherren um die Zukunft ihrer Staaten durchaus eine gewisse Offenheit gegenüber der Schaffung eines neuen Staatenkomplexes bestand, wenn auch dies mit Abstrichen in der eigenen Machtfülle verbunden gewesen wäre. Die Herzöge waren durchaus selbst von Ideen, wie der Schaffung eines nach außen hin geeinten Deutschlands, unter Wahrung der Monarchie, angetan. Die Rolle, die sie selbst in einem solchen Staat einnahmen, bedurfte freilich der Klärung. Als Erbgroßherzog Carl Alexander (1818-1853-1901) in Weimar, zur Beruhigung der Massen, selbst die Fahne der Revolution, schwarz-rot-gold, ergriff, stellte er sich selbst auf die Seite eines vereinigten Deutschlands, in dem aber der Einzelstaat Sachsen-Weimar-Eisenach seine Daseinsberechtigung behalten sollte, was durch die weimarischen Fahnenbänder symbolisch angezeigt wurde. Vgl. Wentzcke, Thüringische Einigungsbestrebungen im Jahre 1848, S. 15. Grundsätzlich wurde die Schaffung eines einheitlichen Thüringens ernsthaft in Erwägung gezogen. Das Scheitern der Revolutionsbewegung von 1848 und der heftige Widerstand der Meininger Regierung gegenüber Abstrichen in der Staatssouveränität verhinderten ein entsprechendes Staatenbündnis aus Thüringer Staaten. Der abfällige Kommentar Heinrich von Treitschkes über das politische Vermögen und die politische Bedeutung Thüringens ist demnach stark zu relativieren und tut letztlich den idealisierten Staatsbegriff von Treitschkes kund: „Fast alle anderen deutschen Stämme nahmen doch irgend einmal einen Anlauf nach dem Ziele politischer Macht, die Thüringer niemals. Unsere Cultur verdankt ihnen unsäglich viel, unser Staat gar nichts.“ H. v. Treitschke, Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert, 2. Teil: Bis zu den Karlsbader Beschlüssen (Staatengeschichte der neuesten Zeit 25), Leipzig 1893, S. 395.
165 Kriegshandlungen fanden auch auf Thüringer Boden statt. Am 27. Juni 1866 siegten preußische und sachsen-coburg-gothaische Truppen über die Armee des Königreichs Hannover. Sachsen-Weimar-Eisenach, Schwarzburg-Rudolstadt und Reuß j.L. schlossen sich im Zuge des preußischen Sieges in Königgrätz dem preußischen Bündnis an. Vgl. Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 70. Sachsen-Meiningen und Reuß ä.L. hielten bis dahin am Bündnis mit Osterreich fest, entgingen durch Abdankungen und Reparationszahlungen allerdings der politischen Auflösung. Ihre Politik blieb gegenüber Preußen jedoch noch lange reserviert. Vgl. ebd., S. 70 und 72.
166 Nicht nur der Norddeutsche Bund, sondern auch süddeutschen Staaten wie Bayern, Baden und Württemberg schlossen sich den Kriegshandlungen auf Seiten der Preußen an.
167 Vgl. H.-J. Ruge, Gewerbepolitik und Industrialisierung in der Neuzeit, in: H. Hoffmeister/V. Wahl (Hg.), Die Wettiner in Thüringen. Geschichte und Kultur in Deutschlands Mitte, Arnstadt-Weimar 1999, S. 287-292, hier S. 287.
168 Vgl. ebd. S. 287f.
169 Der Geraer Kaufmann Ernst Weber und der Gothaer Versicherungspionier Ernst Wilhelm Arnoldi zählen zu den Wortführern in Thüringen, die eine Umstrukturierung des Handels- und Zollwesen proklamierten. Vgl. H.-W. Hahn, Region und Integration, S. 7.
170 Vgl. Ruge, Gewerbepolitik und Industrialisierung, S. 288 und D. Blaha, Der Anschluss an den preußischen Zollverein, in: H. Hoffmeister/V. Wahl (Hg.), Die Wettiner in Thüringen. Geschichte und Kultur in Deutschlands Mitte, Arnstadt-Weimar 1999, S. 367-373, hier S. 343. Insbesondere die Preußischen Gebiete in Thüringen, allen voran Erfurt, stellten für die Händler eine teure Zollbarriere dar. Zum Teil waren einzelne Kleinstaaten regelrecht eingekesselt vom neuen preußischen Zollverein, so etwa Schwarzburg-Sondershausen, das nur durch den Anschluss an diesen, am 25. Oktober 1819, aus seiner wirtschaftlichen Stagnation kommen konnte. Vgl. W. Mühlfriedel, Die Industrialisierung in Thüringen. Grundzüge der gewerblichen Entwicklung in Thüringen von 1800 bis 1945, Erfurt 2001, S. 21; und dazu weiterführend: Hahn, Warum trat Schwarzburg-Sondershausen zuerst dem preußischen Zollverein bei?, in: ZVThGA neue Folge 24 (1920), S. 165-171.
171 Vgl. Ruge, Gewerbepolitik und Industrialisierung, S. 288. Einzelverhandlungen zwischen Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Gotha und dem Königreich Sachsen scheiterten, da Sachsen versuchte die wirtschaftliche Situation der Thüringer Verhandlungspartner auszunutzen. Vgl. Blaha, Der Anschluss an den preußischen Zollverein, S. 344.
172 Vgl. Hahn, Region und Integration, S. 8. Mitglieder waren: Königreich Sachsen, Königreich Hannover, Kurfürstentum Hessen-Kassel, die Großherzogtümer Oldenburg und Sachsen-Weimar-Eisenach, die Herzogtümer Braunschweig, Nassau, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha, die Landgrafschaft Hessen-Homburg, die Fürstentümer Schwarzburg-Rudolstadt, Reuß ältere Linie (Reuß-Greiz), Reuß-Schleiz, Reuß-Lobenstein und Ebersdorf, die freien Städte Bremen und Frankfurt.
173 Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg und Gotha, gefolgt von Schwarzburg-Rudolstadt und den reußischen Fürstentümern nahmen gesonderte Verhandlungen mit Preußen auf und schwächten somit den Mitteldeutschen Zollverein. Vgl. Blaha, Der Anschluss an den preußischen Zollverein, S. 346.
174 Vgl. Mühlfriedel, Die Industrialisierung in Thüringen, S. 23. Die ernestinischen Herzogtümer erklärten bereits am 11. Mai 1833 ihre Beitrittsabsicht, die am 1. Januar 1834 mit der Zollvereinsgründung in Kraft trat. Vgl. Ruge, Gewerbepolitik und Industrialisierung, S. 288; Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 73.
175 Die Vielzahl an Residenzstädten bedingte, dass Betriebe gleicher Branchen geografisch eng zusammenlagen und damit früh in eine wirtschaftliche Konkurrenz eintraten. Damit etablierte sich in Thüringen indirekt eine Form von Gewerbefreiheit, vgl. P. Lange, Kleinstaatlichkeit und Wirtschaftsentwicklung in Thüringen, in: J. John (Hg.), Kleinstaaten und Kultur in Thüringen vom 16. bis 20. Jahrhundert, Weimar-Köln-Wien, S. 187-203, hier S. 195.
176 Vgl. Mühlfriedel, Die Industrialisierung in Thüringen, S. 34.
177 Vgl. Lange, Kleinstaatlichkeit und Wirtschaftsentwicklung, S. 192-195.
178 Vgl. U. Hess, Geschichte Thüringens. 1866 bis 1914, Weimar 1991, S. 132-135 und Ruge, Gewerbepolitik und Industrialisierung, S. 290.
179 Vgl. Mühlfriedel, Die Industrialisierung in Thüringen, S. 137.
180 Vgl. Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 73.
181 Vgl. D. Burkard, Staatskirche – Papstkirche – Bischofskirche. Die „Frankfurter Konferenzen“ und die Neuordnung der Kirche in Deutschland nach der Säkularisation (Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 53) Rom-Freiburg-Wien, 2000, S. 111.
182 Vgl. ebd., S. 114f. Kaiser Franz II. stimmte jedoch nur unter Vorbehalt zu. Er war politisch dazu gezwungen, schädigte damit aber seine Stellung im Reich.
183 Vgl. H.-J. Becker, Umbruch in Mitteleuropa. Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803, in: P. Schmid/K. Unger (Hg.), 1803 Wende in Europas Mitte. Vom feudalen zum bürgerlichen Zeitalter, Regensburg 2003, S. 17-34, hier S. 29 und weiterführend: H. Maier, Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 und die Folgen (Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche 38), Münster 2004.
184 Vgl. M. Martin, Staat, Recht und Kirche. Der Weg der katholischen Kirche in Mitteleuropa bis ins 19. Jahrhundert, Berlin 2000, S. 298.
185 Die Erscheinung der Säkularisation ist älter, doch gerade im Zuge der Aufklärung wurden Stimmen immer lauter, die eine Trennung von weltlicher Herrschaft und geistlichem Amt forderten. Die geistlichen Territorien galten als rückständig gegenüber einem Staatsaufbau im Sinne der Aufklärung. Hinzukam die starke territoriale Zerstückelung des Reiches und letztlich der Wille weltlicher Herrscher, sich kirchlichen Besitz anzueignen. Teilsäkularisierungen, wie z.B. in Bayern und Österreich, in denen Klöster aufgehoben wurden, gab es bereits im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Vgl. dazu: M. Martin, Staat, Recht und Kirche, 293-301, bes. S. 293ff.; Hausberger, Reichskirche, S. 69120, bes. S. 70-84.
186 H. E. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, auf der Grundlage des Kirchenrechts von Ulrich Stutz, Bd. I: Die Katholische Kirche, Weimar 1950, S. 504.
187 Vgl. H. Hürten, Kirche auf dem Weg in eine veränderte Welt. Ein Versuch über die Auseinandersetzung der Katholiken mit der Gesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts (Beiträge zu Theologie, Kirche und Gesellschaft im 20. Jahrhundert 6), Münster u.a. 2003, S. 10-13; und Ders. Kurze Geschichte des deutschen Katholizismus, 1800-1960, Mainz 1986, S. 11ff. Obwohl sich auch in geistlichen Territorien die politische Tagesordnung zunehmend der Aufklärung zuwandte, galten diese als rückständig, wohl zu Unrecht. Vgl. Hausberger, Reichskirche, S. 40f.
188 Vgl. M. Fleischer, Katholische und lutherische Ireniker. Unter besonderer Berücksichtigung des 19. Jahrhunderts (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geistesgeschichte 4), Göttingen u.a. 1998, S. 90.
189 Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, S. 508. Vgl. weiterführend: R. Aubert, Die katholische Kirche und die Revolution, in: H. Jedin (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. VI. Die Kirche in der Gegenwart, I. Teil: Zwischen Revolution und Restauration, Freiburg u.a. 1985, S. 3-104, hier S. 67-73 und H. Wolf, Katholische Kirchengeschichte im „langen“ 19. Jahrhundert, in: Ders./T. Bremer/R. Kottje (Hg.), Ökumenische Kirchengeschichte, Bd. 3: Von der Französischen Revolution bis 1989, Darmstadt 2007, S. 91-177, bes. S. 97-99.
190 Vgl. Fleischer, Katholische und lutherische Ireniker, S. 91.
191 Vgl. ebd. S. 91f und Burkard, Staatskirche – Papstkirche – Bischofskirche, S. 117-119.
192 Vgl. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, S. 509. Besonderen Einfluss erlangte Rom bei der Besetzung der Bischofssitze.
193 „Papst und Bischöfe wurden mehr und mehr Bundesgenossen gegen staatskirchlich-josephinisch eingestellte Regierungen. Die Überwindung des Staatskirchentums einerseits, der episkopalistischen Strömungen anderseits haben so eine Kampfgenossenschaft von Papsttum und Episkopat heraufgeführt, die vor allem dem primatialen Gedanken zugute kam.“, Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, S. 509.
194 Die Hoffnung vieler in der römischen Kurie, dass eine Wiederherstellung der alten reichskirchlichen Verhältnisse herbeigeführt werden könnte, zerschlug sich. Die kirchliche Ordnung konnte demnach keine Wiederherstellung sein, sondern eine Neuordnung. Vgl. R. Joppen, Das Erzbischöfliche Kommissariat Magdeburg Teil 10 (Studien zur katholischen Bistums- und Klostergeschichte 21), Leipzig 1978, S. 14.
195 Die Bemühungen Metternichs scheiterten an der ausgeprägt föderalistischen Haltung des Staates Preußens, aber auch der Staaten Württembergs und Bayerns, die dadurch ihre eigene Position behaupteten, vgl. Joppen, Das Erzbischöfliche Kommissariat Magdeburg, S. 17f. Auch für die römische Kurie stellte Abschluss von einzelnen Länderkonkordaten einen Vorteil dar. Tendenzen zur Ausprägung einer starken dt. Nationalkirche konnte so entgegen gewirkt werden. Zudem stellte die Verhandlung mit Einzelstaaten einen Vorteil dar, da diese gegeneinander ausgespielt werden konnten. Vgl. Burkard, Staatskirche – Papstkirche – Bischofskirche, S. 120.
196 Vgl. Bulle Papst Pius VII. über die Translation des Erzbistum Mainz nach Regensburg, 1. Februar 1805, in: E. Huber/W. Huber, Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert. Dokumente zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts, Bd. I: Staat und Kirche vom Ausgang des alten Reichs bis zum Vorabend der bürgerlichen Revolution, Berlin 1973, S. 29f.
197 Josef Freisen urteilt, dass auch andere Thüringer Staatsgebiete in der bisherigen Bistumsstruktur verblieben: „Der Apostolische Stuhl hält das Prinzip fest, dass der Abfall zum Unglauben oder zum Protestantismus die einmal dort angeordnete Diözesanjurisdiktion aufzuheben nicht im stande sei. Für die Diözesen der zum Unglauben abgefallenen Gebiete ernennt Rom bis auf den heutigen Tag die sogen. Titularbischöfe, für die zum Protestantismus abgefallenen Gebiete werden derartige Titularbischöfe nicht ernannt, es wird aber daran festgehalten, dass diesselben nach wie vor dem früheren Diözesangebiet und deren Vorstehens bezw. deren Nachfolgern unterstehen.“ Freisen, Die Bischöfliche Jurisdiktion, S. 7.
198 Barthold Georg Niebuhr (1776-1831) vertrat die preußische Regierung in den Verhandlungen mit Ercole Kardinal Consalvi (1757-1824). Preußen strebte zunächst ein Konkordat mit dem Heiligen Stuhl an, ein Unternehmen das jedoch scheiterte. Die preußischen Maßstäbe in der Kirchenpolitik waren denen ähnlich, die gegenüber der evangelischen Landeskirche angewandt wurden. Demnach galt das Staatsregiment auch für Fragen der katholischen Kirche „…in gleicher territorialistischstaatskirchlicher Weise […], seit 1815 durch die Konsistorien, seit 1817 zum Teil auch durch die Oberpräsidenten…“, Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, S. 523. Ein Konkordat war unter diesen Präferenzen für beide Seiten nur schwer aushandelbar, so dass Niebuhr, eingehend auf die Bedenken der Gegenseite, für den Staat Preußen nur noch eine leichter zu erreichende Zirkumskriptionsbulle erstrebte. Vgl. ebd. Die Sanktionen, die die territorialistisch-staatskirchliche Verwaltung Preußens mit sich brachten, bestanden fort, wie das Plazet in Fragen von bischöflichen Anordnungen und Stellenbesetzungen und die Überwachung der Korrespondenz mit der römischen Kurie. Vgl. ebd., S. 524.
199 Besonders die Forderung nach Anerkennung des Summepiskopats machte ein Konkordat unmöglich, vgl. Joppen, Das Erzbischöfliche Kommissariat Magdeburg, S. 24, „Denn die seit dem Westfälischen Frieden tradierten jura könne man unter keinen Umständen preisgeben. Die katholische Kirche mußte daher eine unversöhnliche Gegnerin der preußischen Kirchenpolitik bleiben und konnte nicht eher ruhen, bis dieselbe – d. h. die obwaltende Staatsräson selbst – zu Grabe getragen war.“ Ebd., S. 22.
200 Vgl. ebd., S. 18-21. Allein in Bayern war der Abschluss eines Konkordats möglich. Zu den Frankfurter Verhandlungen von 1818 zur Neuordnung der Kath. Kirche in Deutschland vgl. Burkard, Staatskirche – Papstkirche – Bischofskirche, S. 161-260.
201 Bulle Papst VII. „De salute animarum“, 16. Juli 1821. in: Huber/Huber, Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, S. 212. Vgl. hierzu auch H. Brück, Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert, Bd. II: Vom Abschlusse der Concordate bis zur Bischofsversammlung in Würzburg im März 1848, Münster 21903, S. 71-74. Nach Brück wurde die Bulle bereits am 14. Juli unterzeichnet, vgl. ebd., S. 71.
202 Der Bestand des Bistums Paderborn wurde erst mit den Entscheidungen des Jahres 1821 sichergestellt. Nach der Aufhebung des alten Fürstbistums 1802 durch Preußen bestand es in rein kirchlicher Struktur weiter. Ab 1806 gehörte der Bischofsitz zum neugegründeten Königreich Westphalen, das ein französisches Staatskonstrukt darstellte und mit König Jérôme den Bruder Napoleons als Staatsoberhaupt hatte. Dieser plante, den Bischofssitz an seine Residenz in Kassel zu verlegen, scheiterte jedoch diesbezüglich. Auch nach dem Ende der französischen Herrschaft war ein Fortbestehen des Bistums fraglich. In Fragen der Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse erschien ein selbstständiges Bistum Paderborn nicht mehr in den Verhandlungen zwischen Preußen und dem Heiligen Stuhl. Ein Entwurf sah die Einverleibung der Diözese in das Bistum Münster vor, ein anderer in das Erzbistum Köln. Erst die Bulle „De salute animarum“ sprach den Fortbestand des Bistums aus und sorgte für eine Umschreibung der Diözesangrenzen. Vgl. Brandt/Hengst, Geschichte des Erzbistums Paderborn, Bd. 3: Das Bistum Paderborn im Industriezeitalter 1821-1930 (Veröffentlichungen zur Geschichte der Mitteldeutschen Kirchenprovinz 14), Paderborn 1997, S. 21. Vgl. weiterführend: Hausberger, Reichskirche, S. 168-178.
203 Die Bistumszugehörigkeit der Stadt Erfurt und des Eichsfelds zu Paderborn wurde später nicht in Abrede gestellt. In Weimar entwickelte sich jedoch ein heftiger Streit über die Diözesanzugehörigkeit der katholischen Untertanen: konkret handelte es sich um das Gebiet der Rhön. Es gehörte als katholische Enklave seit Jahrhunderten zur Fürstabtei bzw. zum Fürstbistum Fulda, das auch geographisch am Nächsten lag. „De salute animarum“ unterscheidet jedoch dieses neue weimarische Staatsgebiet nicht vom protestantischen Stammland, so dass nach Wortlaut des Schreibens die Rhöner Pfarreien ab sofort zum Bistum Paderborn gehörten.
204 Vgl. Burkard, Staatskirche – Papstkirche – Bischofskirche, S. 506.
205 Bulle Papst VII. „Provida solersque“, 16. August 1821. in: Huber/Huber, Staat und Kirche, S. 249f. Die Regierung in Weimar ging jedoch von der bis dato im Juli getroffenen Bestimmung aus. Dies führte zu erheblichen Auseinandersetzungen.
206 Eine solche unterschied sich jedoch zunächst von einer wirklichen Aufnahme der Territorien in die Bistümer, sondern beschränkte sich auf eine von Rom anerkannte Jurisdiktionsausübung, um die Seelsorge an den Katholiken abzusichern. Die Territorien der Fürsten zu Reuß und die Gebiete des 1826 neu umschriebenen Herzogtums Altenburg gehörten in vorreformatorischer Zeit zum Bistum Naumburg. Nach Untergang des Bistums durch Einführung der Reformation erlosch katholischerseits eine konkrete Zuordnung der Gebiete, die folglich damit direkt dem Papst unterstanden bzw. ab 1667 dem Apostolisches Vikariat für die Nordische Mission. Konkrete Auswirkungen hatte dies jedoch nicht. Erst mit Entstehung katholischer Gemeindestrukturen wurden jurisdiktionelle Zuordnungen mit den Erzbischöfen von Prag (für Reuß ä. L.) und den Apostolischen Vikaren in Dresden ausgehandelt.
207 Vgl. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, S. 517; R. Aubert, Die katholische Kirche und die Restauration. Die erneuerte Stellung des Heiligen Stuhles in der Kirche, in: H. Jedin (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. VI, Die Kirche in der Gegenwart, I. Teil: Zwischen Revolution und Restauration, Freiburg u.a. 1985, S. 127-139, hier S. 130-132 und R. Lill, Kirchliche Reorganisation und Staatskirchentum in den Ländern des Deutschen Bundes und in der Schweiz, in: H. Jedin (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. VI, Die Kirche in der Gegenwart, I. Teil: Zwischen Revolution und Restauration, Freiburg u.a. 1985, S. 160-173, hier S. 163, sowie: Fleischer, Katholische und lutherische Ireniker, S. 91 und Wolf, Katholische Kirchengeschichte, S. 101-106.
208 Vgl. M. Ebertz, „Ein Haus voll Glorie, schauet…“ Modernisierungsprozesse der römischkatholischen Kirche im 19. Jahrhundert, in: W. Schieder (Hg.), Religion und Gesellschaft im 19. Jahrhundert (Industrielle Welt 54), Stuttgart 1993, S. 62-85, hier S. 62f.
209 Die ultramontane Perspektive auf die Verhandlungen der Staats-Kirchenverträge war sehr kritisch ausgeprägt. Den kirchlichen Verhandlungspartnern wurde ein „antikirchlicher Geist“ nachgesagt, der die Vorrangstellung des Papsttums untergraben würde. Dieser Vorwurf ist sehr interessengeleitet und muss widersprochen werden. Ein Ausschluss der päpstlichen Autorität lag nicht im Sinne der kirchlischen Würdenträger und auch der Einsatz für die Kirche in Deutschland widerspricht nicht zwangsläufig der Zugehörigkeit zur römischen Kirche. Vgl. Burkard, Staatskirche – Papstkirche – Bischofskirche, S. 726f.
210 Vgl. Besier, Kirche, Politik und Gesellschaft, S. 9 und R. Aubert, Die Anfänge der katholischen Bewegung in Deutschland und in der Schweiz, in: H. Jedin (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. VI; Die Kirche in der Gegenwart, I. Teil: Zwischen Revolution und Restauration, Freiburg u.a. 1985, S. 259-271, hier 261f. Fernerhin: K. Rivinius, Der Weg des deutschen Katholizismus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: ThGl 72 (1982), S. 216-225, hier S. 219f und Wolf, Katholische Kirchengeschichte, S. 112-114.
211 Der ultramontane Katholizismus war stark konservativ, antimodern und zentralistisch geprägt. Der Universalepiskopat und die Unfehlbarkeit des Papstes wurden ins Zentrum des katholischen Bekenntnisses gerückt. Kirchliches Leben an sich, aber auch Theologie (stark neuscholastisch geprägt) und Philosophie wurden stark an die Autorität des Lehramtes gebunden. Vgl. J. Strötz, Der Fels der Kirche. Ultramontane Kirchenlehre im 19. Jahrhundert dargestellt am Beispiel des Eichstätter Bischofs Franz Leopold Freiherr von Leonrod (1827-1905) (Studien zu Religionspädagogik und Pastoralgeschichte 6), Hamburg 2003, S. 65-97, hier S. 66f. und dazu weiterführend: Hürten, Kurze Geschichte des deutschen Katholizismus, S. 109-135; Brandt/Hengst, Geschichte des Erzbistums Paderborn, S. 89; Wolf, Katholische Kirchengeschichte, S. 115-117; K. Schatz, Aufklärung, Staatskirchentum und Ultramontanismus im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts, in: K.-H. Braun (Hg.), Kirche und Aufklärung – Ignaz Heinrich von Wessenberg (1774-1869) (Schriftenreihe der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg 38), München-Zürich 1989, S. 9-27, hier S. 11.
212 Vgl. Hürten, Kirche auf dem Weg, S. 99. Und dazu weiterführend: B. Schreyer, Die „Nation“ als Zauberwort der Moderne. Nationales Denken im Liberalismus, Konservatismus und bei den Völkischen im 19. Jahrhundert (Spektrum Philosophie 32), Würzburg 2008.
213 Vgl. J. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich 1871 bis 1918. Strukturen eines problematischen Verhältnisses zwischen Widerstand und Integration. Teil 1: Reichsgründung und Kulturkampf (1871-1890) (Studien zu Religionspädagogik und Pastoralgeschichte 6), Hamburg 2005, S. 115.
214 Es ist darauf hinzuweisen, dass die Rolle der katholischen Kirche in den europäischen Staaten diesbezüglich unterschiedlich war. Kirche konnte demnach als Hindernis für die nationale Bewegung bewertet werden, oder zur Identitätsbildung eines Volkes im Kampf um seine Unabhängigkeit und Nationalstaatlichkeit, entscheidende Punkte setzen (z.B. Polen). Vgl. Altermatt, Katholizismus und Nation. Vier Modelle in europäisch vergleichender Perspektive, in: Ders./F. Metzger (Hg.), Religion und Nation. Katholizismen in Europa des 19. und 20. Jahrhunderts (Religionsforum 3), Stuttgart 2007, S. 15-33, hier S. 21.
215 Vgl. weiterführend: Wolf, Katholische Kirchengeschichte, S. 143-146.
216 Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, Teil 1, S. 116. Trotz dieses Gegensatzes galt Deutschland für die römische Kurie vor dem Kulturkampf als verlässlicher Verhandlungspartner und wurde 1870 noch angefragt, ob ein mögliches Asyl des Papstes in Deutschland denkbar wäre: „Er (der Papst) hat bei uns schon gebeten, wir möchten bei Italien vermittelnd anfragen, ob man reisen lassen würde, und ob dies mit der ihm gebührenden Würde geschehen könnte. Wohin aber? Nach Frankreich kann er nicht, da ist Garibaldi. Nach Österreich mag er nicht. Nach Spanien?–Ich habe ihm Bayern vorgeschlagen […] Er hat in der Tat schon angefragt, ob wir ihm ein Asyl gewähren können. Ich habe nichts dagegen einzuwenden–Köln oder Fulda […] aber der König will nicht.“ Erklärung Bismarcks gegenüber einer Anfrage Kardinalstaatssekretärs Antonelli, Oktober 1870, hier zit. nach: W. Löhde, Das päpstliche Rom und das Deutsche Reich. Eine Dokumentation (Hintergrundanalysen 12), Hannover 1991, S. 26.
217 Vgl. zur Evangelischen Kirche im 19. Jahrhundert vgl. weiterführend: K. Nowak, Evangelische Kirchengeschichte von der Französischen Revolution bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, in: H. Wolf (Hg.), Ökumenische Kirchengeschichte, Bd. 3: Von der Französischen Revolution bis 1989, Darmstadt 2007, S. 19-90, bes. zum Thema Reich und Kulturkampf, S. 63-70.
218 Vgl. Besier, Kirche, Politik und Gesellschaft, S. 17.
219 Vgl. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, Teil 1, S. 154f. Zwar verstärkt diese protestantische Staatsauffassung den Gegensatz zum katholischen Anspruch, doch hatte der Liberalismus besonders in katholischen Ländern (Österreich) ein Staatskirchentum entstehen lassen, das weit schärfer war; „in katholischen Staaten hatte der kulturkämpferische und kirchenfeindliche Liberalismus seine eigentliche Heimstätte.“ G. Franz, Kulturkampf. Staat und katholische Kirche in Mitteleuropa von der Säkularisation bis zum Abschluss des preussischen Kulturkampfes, München 1954, S. 187. Zur inneren und äußeren Haltung der Deutschen Katholiken vgl. auch weiterführend: R. Schmidt, Gegen den Reiz der Neuheit. Katholische Restauration im 19. Jahrhundert: Heinrich Bone, Joseph Mohr, Guido Maria Dreves (Mainzer Hymnologische Studien 15), Tübingen 2005.
220 Vgl. Hürten, Kurze Geschichte des deutschen Katholizismus, S. 104-108; Besier, Kirche, Politik und Gesellschaft, S. 14 und Altermatt, Katholizismus und Nation, S. 20. Vgl. zum Vereinswesen weiterführend: O. Köhler, Die Ausbildung der Katholizismen in der modernen Gesellschaft, in: H. Jedin (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. VI, Die Kirche in der Gegenwart, II. Teil: Die Kirche zwischen Anpassung und Widerstand (1878 bis 1914), Freiburg u.a. 1985, S. 195-264, hier S. 220222.
221 Vgl. Besier, Kirche, Politik und Gesellschaft, S. 14.
222 Vgl. Hürten, Kirche auf dem Weg, S. 124-127.
223 Vgl. Rivinius, Der Weg des deutschen Katholizismus, S. 224. Diese erste Zusammenkunft bildet die Grundlage für die spätere Fuldaer Bischofskonferenz.
224 Vgl. Rivinius, Der Weg des deutschen Katholizismus, S. 224.
225 Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, Teil 1, S. 176. Zum I. Vatikanum vgl. weiterführend: K. Schatz, Vaticanum I. Bd. 1-3 (Konziliengeschichte A), Paderborn 1992-1994.
226 Verwiesen sein soll explizit auf das katholisch geprägte Eichsfeld und die Stadt Erfurt. Vgl. weiterführend zu Eichsfeld: A. Dölle, Der Kulturkampf und seine Auswirkungen auf dem Eichsfeld und im Fuldaer Land von 1872 bis 1887. Dargestellt vornehmlich beim Obereichsfeld auf archivalischer Grundlage, Duderstadt 1987.
227 Vgl. weiterführend: Hürten, Kurze Geschichte des deutschen Katholizismus, S. 136-159.
228 Vgl. M. H. Jung, Der Protestantismus in Deutschland von 1870 bis 1945 (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen III/5), Leipzig 2002, S. 45f.
229 Die Politik des Zentrums richtete sich konkret auch auf Fragen der Auslandspolitik. Das Zentrum wurde in gewissem Sinne zu einer päpstlichen Interessenspartei innerhalb des Reiches, da sie sich für eine Einmischung Deutschlands in Fragen der Wiederherstellung des 1870 in Italien aufgegangenen Kirchenstaates einsetzte. Vgl. Martin, Der katholische Weg ins Reich, S. 84. Einer der bedeutendsten Zentrumspolitiker und Gegenspieler Bismarcks im Kulturkampf war Ludwig Windthorst (1812-1891). Er selbst jedoch kämpfte bis zu seinem Lebensende gegen eine katholische Etikettierung des Zentrums, vgl. M. L. Anderson, Windthorst. Zentrumspolitiker und Gegenspieler Bismarcks (Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte 14), Düsseldorf 1988, S. 140.
230 Vgl. Besier, Kirche, Politik und Gesellschaft, S. 16.
231 Vgl. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, Teil 1, S. 198.
232 Der Sieg Preußens über Österreich im Krieg von 1866 wurde als Überlegenheit des protestantischliberalen Prinzips über einen überholten und rückständigen Katholizismus gewertet. Vgl. Hürten, Kirche auf dem Weg, S. 115f; Ders. Kurze Geschichte des deutschen Katholizismus, S. 152f; Besier, Kirche, Politik und Gesellschaft, S. 17 und R. Lill, Der Kulturkampf in Preußen und im Deutschen Reich (bis 1878), in: H. Jedin (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. VI, Die Kirche in der Gegenwart, II. Teil: Die Kirche zwischen Anpassung und Widerstand (1878 bis 1914), Freiburg u. a. 1985, S. 28-48, hier S. 29f.
233 Das Phänomen Kulturkampf ist dabei nicht ein allein preußisches, sondern ein kontinentaleuropäisches, in dem Weltanschauungsfragen, konfessionelle Abgrenzungen und politische Interessen ineinander greifen. Vgl. W. Becker, Religiös-politische Aspekte des Kulturkampfs im 19. Jahrhundert: Kontroversen um die staatliche Ordnung, in: A. Rauscher (Hg.), Probleme des Konfessionalismus in Deutschland seit 1800 (Beiträge zur Katholizismusforschung, Reihe B), Paderborn u.a. 1984, S. 49-69, hier S. 49.
234 Vgl. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, Teil 1, S. 206. Einen einheitlichen Kulturkampf in Deutschland gab es nicht, obschon Gesetze auch auf Reichsebene erlassen wurden. Vielmehr fiel Kirchenpolitik in den Zuständigkeitsbereich der einzelnen deutschen Staaten. Zu unterscheiden sind demnach ein preußischer, bayrischer und ein badischer Kulturkampf. Um die Erscheinung Kulturkampf an sich darzustellen, wird insbesondere auf den preußischen Kulturkampf Bezug genommen, da er für einen größten Teil des Reiches Geltung hatte und direkten Einfluss auf die preußischen Teile Thüringens, und indirekt auf die Thüringer Kleinstaaten hatte, insbesondere über die vom Kulturkampf betroffenen Bischöfe von Paderborn. Vgl. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, Teil 1, S. 211.
235 „Bereits am 24. October und wiederholt am 22. v. M. habe ich dem Herrn Erzbischof von Köln zu erkennen gegeben, daß seine Verhandlung mit den betheiligten Professoren das rein kirchliche Gebiet insofern überschirtten haben, als denselben, unter Androhung von Maßregeln, welche ihre lehramtliche Thätigkeit berühren, das Versprechen abgefordert worden ist, bei Ausübung ihres Lehramtes den auf dem Cocil zu Rom jüngst gefassten Beschlüssen treue Folge zu leisten. Dem gegenüber habe ich daran erinnert, daß durch den §26 der nach vorgängigem Benehmen mit der Kirche erlassenen Statuten der katholisch-theologischen Facultät der Universität Bonn, und durch die demgemäß von den Lehrern dieser Facultät geleistete professio fidei eine Norm für die Ausübung ihres Lehramtes gegeben ist, welche ohne Zustimmung des Staates nicht verändert werden kann. Ebenso habe ich erklärt, daran festhalten zu müssen, daß […] eine bischöfliche Zurechtweisung […] nur mit Vorwissen des Staates eintreten darf.“ Antwort des Ministers v. Mühler vom 30. Dezember 1870 auf eine Beschwerde des Senats der Universität Bonn betreffend die Bestrafung der dortigen Professoren von Seiten der kirchlichen Obern, zit. nach: N. Siegfried, Actenstücke betreffend den preußischen Culturkampf nebst einer geschichtlichen Einleitung, Freiburg 1882, S. 38. Der entsprechende Konflikt breitete sich über die universitäre Ebene auf die schulische aus. Beispielhaft sei dabei auf den Braunsberger Schulstreit verwiesen. Vgl dazu die Korrespondenz in: ebd., Nr. 16-33 und H. Brück, Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert, Bd. IV/1: Vom Vatikanischen Konzil 1870 bis zur Gegenwart, Münster 21907, S. 158-174. Der kompromissbereite Kulturminister Mühler, der dem Kurs Bismarcks im Wege stand, wurde am 22. Januar 1872 entlassen und durch Kultusminister Falk ersetzt, der die Positionen Bismarcks noch an Schärfe übertraf. Vgl. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, Teil 1, S. 226f. Nicht nur in Preußen kam es zu staatlichen Interventionen zum Schutz der Hochschulprofessoren. Nachdem am 17. April 1871 der Münchner Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger (1799-1890) exkommuniziert worden war, da er die Beschlüsse des Konzils zum Jurisdiktionsprimat und der päpstlichen Unfehlbarkeit entschieden ablehnte, hielt der Staat dennoch an ihm fest, da Döllinger im öffentlichen Dienst stehe. Das Königreich Bayern zeigte deutlich, dass es von kirchlicher Einflussnahme unabhängig war. 1872 wurde Döllinger Universitätspräsident in München und 1873 zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften ernannt. Er war Staatsdiener. Vgl. Martin, Der katholische Weg ins Reich, S. 85f. Vgl. zu seiner Person weiterführend: H. Fuhrmann, Ignaz von Döllinger. Ein exkommunizierter Theologe als Akademiepräsident und Historiker (Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-Historische Klasse 137/1), Stuttgart 1999; F. X. Bischof, Theologie und Geschichte, Ignaz von Döllinger (1799-1890) in der zweiten Hälfte seines Lebens. Ein Beitrag zu seiner Biographie (Münchener kirchenhistorische Studien 9), Stuttgart 1997.
236 „Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 30. d. Mts. will Ich genehmigen, daß die im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten jetzt bestehenden gesonderten Abtheilungen für die evangelischen Kirchen-Angelegenheiten und für die katholischen Kirchen-Angelengenheiten aufgehoben und deren Geschäfte Einer Abtheilung für die geistlichen Angelegenheiten übertragen werden.“ Allerhöchster Erlaß, betreffend die Aufhebung der katholischen Abtheilung im Cultusministerium, vom 8. Juli 1871, hier zit nach. Siegfried, Actenstücke, S. 92. Vgl. weiterhin Brück, Geschichte der katholischen Kirche, Bd. IV/1., S. 88-100 und Lill, Der Kulturkampf in Preußen, S. 35.
237 Vgl. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, Teil 1, S. 220f. Als offizielle Begründung wurde hingegen angeführt, dass die katholische Abteilung des Kulturministeriums in der Frage des Infallibilitätsdogmas nicht neutral geblieben wäre.
238 Vgl. Siegfried, Actenstücke, S. 93; Brück, Geschichte der katholischen Kirche, Bd. IV/1, S. 100-114 und Lill, Der Kulturkampf in Preußen, S. 36.
239 Der Religionsunterricht unterstand damit der staatlichen Aufsicht. Kirche wurde zum Ausführungsorgan staatlicher Anordnungen. „Unter Aufhebung aller in einzelnen Landestheilen entgegenstehenden Bestimmungen steht die Aufsicht über alle öffentlichen und Privat-Unterrichts- und Erziehungs-Anstalten dem Staate zu.“ Gesetz, betreffend die Beaufsichtigung des Unterrichts- und Erziehungswesens, vom 11. März 1872, hier zit. nach: Siegfried, Actenstücke, S. 94f. Durch ein Ministerialerlass vom 15. Juni 1872 wurde das Gesetz dahingehend verschärft, dass es künftig Ordensgeistlichen oder Mitgliedern geistlicher Kongregationen untersagt blieb, an staatlichen Schulen Religionsunterricht zu erteilen; vgl. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, Teil 1, S. 233.
240 Vgl. Siegfried, Actenstücke, S. 104. Durch ein Ergänzungsgesetz wurde entsprechender Beschluss am 22. Februar 1873 auch auf die Redemptoristen, Lazaristen, die Priester vom Heiligen Geist und die Gesellschaft vom Heiligen Herzen Jesu erweitert. Vgl. umfassend zum Thema Verbot des Jesuitenordens: K. Schatz, Geschichte der deutschen Jesuiten (1814-1983), Bd. I: 1814-1872, Münster 2013, bes. S. 259-274.
241 11. Mai 1873: Gesetz über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen, 12. Mai 1873: Gesetz über die kirchliche Disziplinargewalt und die Errichtung des königlichen Gerichtshofes für kirchliche Angelegenheiten, 13. Mai 1873: Gesetz über die Grenzen des Rechts zum Gebrauch kirchlicher Straf- und Zuchtmittel, 14. Mai 1873: Gesetz betreffend den Austritt aus der Kirche. Vgl. Brück, Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland, Bd. IV/1, S. 253. Zum Wortlaut der Gesetzestexte vgl. weiterführend: Siegfried, Actenstücke, Nrn. 90-93, S. 177-188. Die Gesetze trafen auf heftigen Widerstand der Katholiken. Pius IX. machte diesen gleichsam zu einer religiösen Pflicht, vgl. Anderson, Windthorst, S. 176-183, hier S. 179.
242 Vgl. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, Teil 1, S. 253.
243 Zudem lehnten viele Katholiken eine kleindeutsche Einigung unter preußischer Führung ab. Ihnen wurde deshalb Reichsfeindschaft vorgeworfen. Vgl. Hürten, Kurze Geschichte des deutschen Katholizismus, S. 153.
244 Vgl. R. Morsey, Der Kulturkampf – Bismarcks Präventivkrieg gegen das Zentrum und die katholische Kirche, in: Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche 34 (2000), S. 5-28, hier S. 5.
245 Vgl. Siegfried, Actenstücke, S. 214; vgl. weiterführend Brück, Geschichte der katholischen Kirche, Bd. IV/1, S. 399-415.
246 Vgl. Siegfried, Actenstücke, Nr. 127, S. 240-243.
247 Vgl. ebd., Nr. 142, S. 277-279.
248 Vgl. ebd., Nr. 152, S. 298f.
249 Vgl. ebd., Nr. 144, S. 281-290.
250 Zwölf Diözesen befanden sich auf preußischem Staatsgebiet, wovon 1873 eine, das Bistum Fulda, vakant war. Demnach waren 11 Bischofsstühle besetzt. Von diesen wurden fünf Bischöfe zeitweise abgesetzt, angeklagt oder inhaftiert: Der Bischof von Posen-Gnesen, Mieczysław Halka v. Ledóchowski (2 Jahre); der Bischof von Paderborn, Konrad Martin (Exil in Belgien); der Fürstbischof von Breslau, Heinrich Förster (floh in den österreichischen Diözesanteil Breslaus); der Bischof von Limburg, Peter Joseph Blum (Exil in Böhmen); der Trierer Bischof Matthias Eberhard (starb bereits 1876, während der Prozess gegen ihn lief), vgl. Morsey, Der Kulturkampf, S. 14; zur Geschichte des Kulturkampfes im Bistum Trier vgl. weiterführend: Siegfried, Actenstücke, S. 408-428 und zur Beilegung des Kulturkampfes in Trier: C. Weber, Kirchliche Politik zwischen Rom, Berlin und Trier 1876-1888. Die Beilegung des preußischen Kulturkampfes (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B 7), Mainz 1970. Zum Kulturkampf im für Mitteldeutschland entscheidenden Bistum Paderborn vgl.: Brandt/Hengst, Geschichte des Erzbistums Paderborn, S. 94-105; bes. S. 99-105; und zur Haft Bischof Konrad Martins, S. 101f.
251 Neugegründete Vereine machten es sich zur Aufgabe katholische Geistliche zu schützen und zu unterstützen. Auch die Unterschiede innerhalb der katholischen Strömungen wurden sekundär, so dass liberaler und konservative Flügel des Katholizismus in Deutschland enger zusammen rückten. Vgl. ebd., S. 15. Gemeinden, die während des Kulturkampfes ohne Priester sein mussten, erhielten oftmals ihre Vitalität durch das Laienengagement, geprägt durch priesterlose Gottesdienste und Kinderkatechesen. Vgl. E. Gatz/H. Schmitz, Tendenzen der Pfarreientwicklung von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, in: E. Gatz (Hg.), Geschichte des Kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Die katholische Kirche, Bd. I: Die Bistümer und ihre Pfarreien, Freiburg 1991, S. 89-104, hier S. 96.
252 Vgl. dazu Brück, Geschichte der katholischen Kirche, Bd. IV/1, S. 521-545.
253 Vgl. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, Teil 1, S. 344. Ein erster Kontakt und zugleich ein Zeichen guten Willens zwischen Rom und Berlin setzte der neugewählte Papst durch die Anzeige seiner Thronbesteigung gegenüber dem Deutschen Kaiser am 20. Februar 1878: „Da Wir zu Unserem Bedauern die Beziehungen, welche in früherer Zeit so glücklich zwischen dem Heiligen Stuhl und Ew. Majestät bestanden, nicht mehr vorfinden, so wenden Wir Uns an Ihre Hochherzigkeit, um zu erlangen, daß der Friede und die Ruhe des Gewissens diesem beträchtlichen Theile Ihrer Unterthanen wiedergegeben werde. Und die katholischen Unterthanen Ew. Majestät werden nicht verfehlen, wie es ihnen ja auch der Glaube vorschreibt, zu dem sie sich bekennen, sich mit der gewissenshaftesten Ergebenheit achtungsvoll und treu gegen Ew. Majestät zu zeigen.“ Hier zit. nach: Siegfried, Actenstücke, S. 353. Der Kaiser griff die Initiative auf, wenn er auch der Kirche zunächst keinerlei Zusagen machte: „Gern entnehme Ich den freundlichen Worten Ew. Heiligkeit die Hoffnung, daß Sie geneigt sein werden, mit dem mächtigen Einfluß, welchen die Verfassung Ihrer Kirche Ew. Heiligkeit auf alle Diener derselben gewährt, dahin zu wirken, daß auch diejenigen unter den Letzteren, welche es bisher unterließen, nunmehr dem Beispiel der ihrer geistlichen Pflege befohlenen Bevölkerung folgend, den Gesetzen des Landes, in dem sie wohnen, sich fügen werden.“ Antwortbrief Kaiser Wilhelms I. vom 24. März 1878 an Leo XIII., hier zit. nach: ebd., S. 354. Vgl. dazu weiterhin H. Brück, Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert, Bd. IV/2: Vom Vatikanischen Conzil bis zur Gegenwart, Münster 21908, S. 3f.; vgl. weiterhin: Freisen, Verfassungsgeschichte, S. 108-112.
254 Vgl. zu den politischen Entwicklungen ab 1877: Anderson, Windthorst, S. 206-226. Dazu zählen eine Umstrukturierung des Staatsministeriums und Verschiebungen innerhalb der Parteienbündnisse, aber auch eine Öffnung des Zentrums selbst, das nach dem Tod Pius’ IX. auch die eigenen Positionen öffnete. Die politischen und diplomatischen Zusammenhänge sind sehr komplex und bezogen das Zentrum und Windthorst nicht immer ein. So trug das Zentrum die Sozialistengesetze nicht mit, was den diplomatischen Bestrebungen des Vatikans nicht förderlich war; vgl. Anderson, Windthorst, S. 215 und 218.
255 Vgl. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, Teil 1, S. 353. Unter dem Titel: „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“, trat am 22. Oktober 1878 ein Gesetz in Kraft, dass de facto sozialistische und sozialdemokratische Organisationen im Reich bis 1890 verbat. Vgl. dazu auch: H. Hürten, Vierter Teil: 19. und 20. Jahrhundert, in: R. Elze/K. Repgen, Studienbuch Geschichte. Eine europäische Weltgeschichte. Überarbeitete und ergänzte Auflage, Bd. 2: Frühe Neuzeit, 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 51999, S. 405.
256 Vgl. Brück, Geschichte der katholischen Kirche, Bd. IV/2, S. 176.
257 Vgl. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, Teil 1, S. 452; vgl. weiterführend den Entwurf eines Gesetzes betreffend Abänderung der kirchenpolitischen Gesetze vom Mai 1880, Nr. 195: Siegfried, Actenstücke, , S. 384-394 und Gesetz vom 14. Juli 1880, betreffend die Abänderungen der kirchenpolitischen Gesetze, Nr. 197 in ebd., S. 405-407.
258 Vgl. J. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich 1871 bis 1918. Strukturen eines problematischen Verhältnisses zwischen Widerstand und Integration. Teil 2: Wilhelminische Epoche und Erster Weltkrieg (1890-1918) (Studien zu Religionspädagogik und Pastoralgeschichte 6), Hamburg 2005, S. 44.
259 Vgl. ebd., S. 45f.
260 Vgl. Wolf, Katholische Kirchengeschichte, S. 159f. Papst Leo XIII. stellte sich mit seiner Enzyklika „Rerum Novarum“ (1891) zum ersten Mal dem Thema, der sich durch die Industrialisierung verändernden Gesellschaft und der Verantwortung der Kirche gegenüber den Arbeitern und der sozialen Frage. Besonders Thüringen bildete ein Zentrum der Sozialdemokratie, was auch die Gründung des Sozialdemokratischenarbeitervereins 1869 in Eisenach und der Erfurter Parteitag von 1890 belegen. Vgl. Raßloff, Geschichte Thüringens, S. 74.
261 Vgl. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich, S. 47f.
262 Vgl. N. Busch, Katholische Frömmigkeit und Moderne. Die Sozial- und Mentalitätsgeschichte des Herz-Jesu-Kultes in Deutschland zwischen Kulturkampf und Erstem Weltkrieg (Religiöse Kulturen der Moderne 6), Gütersloh 1997, bes. S. 63-104, hier S. 72; zur Herz-Marien-Frömmigkeit, vgl. ebd., S. 105- 129. Und vgl. fernerhin: Wolf, Katholische Kirchengeschichte, S. 169f.
263 Vgl. Störtz, Der Katholizismus im deutschen Kaiserreich 1871 bis 1918, Teil 2, S. 52.