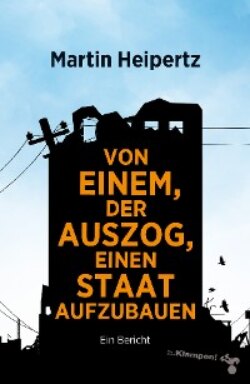Читать книгу Von einem, der auszog, einen Staat aufzubauen - Martin Heipertz - Страница 11
3 Staatsgeburt
ОглавлениеPristina lautet im Lateinischen »die Frühe«, und pristine bedeutet im Englischen gar »makellos«. Das war angesichts der sich mir nun darbietenden Stadt nicht wenig erheiternd, als wir an einem gigantischen Poster von Bill Clinton vorbei durch ihre Hauptstraße einfuhren. God’s own shithole wurde Priština schon mal zu später, berauschter Stunde unter uns Internationalen genannt: Gottes Drecksloch. Zwar gab es hier und da noch ein sehenswertes Gebäude der osmanischen Epoche aus weiß verputztem Stein und mit hölzernen Türen und Fenstern, aber die allenthalben ins Auge springende Häßlichkeit der sozialistischen Bauweise aus der jüngeren, jugoslawischen Vergangenheit und die hilflosen Versuche zeitgenössischer Konstruktion in ihrer vielfachen Geschmacksverirrung dominierten den Eindruck vollkommen. Auch die Hochsicherheitskomplexe der internationalen Präsenz im Stadtzentrum waren nicht auf Ästhetik, sondern allein auf Schutz ausgerichtet und folglich hinter unansehnlichen Betonelementen und waffenstarrenden Sicherheitsschleusen verschanzt. Mehrere große Bauruinen aus den 1970er Jahren waren wie zu Stein gewordene Anklagen im Stadtkern versammelt: Ein gräßliches Hochhaus mit hohlen Fensteröffnungen, das zu nichts anderem mehr taugte als der Aufhängung eines gewaltigen Werbeplakates mit einer Flasche Peja-Beer, das im übrigen gut trinkbar war und damit beworben wurde, daß man es in einer aus Deutschland importierten Anlage gemäß dem deutschen Reinheitsgebot braue. Neben diesem hohläugigen Betonquader stand ein bei Regen sogleich im Schlamm versinkendes, ehemaliges Fußballstadion, dessen durchfurchtes Gelände bei Trockenheit als wilder, verstaubter Parkplatz und Flohmarkt genutzt wurde. Ende März 1999 hatte der damalige Bundesverteidigungsminister Scharping suggeriert, aber nie belegt, daß die Serben in diesem Fußballstadion ein Konzentrationslager betrieben.
Neben dem KZ-Stadion stand eine Art Kulturzentrum in gewagter Betonkonstruktion, die als Kulisse für einen apokalyptischen Weltraumfilm getaugt hätte. Ein unglaubliches Violinkonzert sollte ich wenig später in diesem Gebäude erleben: Die Geiger des Zürcher Opernhauses spielten gratis vor einheimischem Publikum, das ganz überwiegend jung und noch nie im Leben in direkte Berührung mit klassischer Musik gekommen war. Spätestens als das Programm bei Paganini angelangt war, brach sich Begeisterung bei den einfachen, unschuldigen Jungen und Mädchen Bahn. Bei einer abschließenden Fuge von Bartók schließlich fiedelte der Erste Geiger mit einem derartigen Engagement, daß er einen Krampf in seiner Hand erlitt. Der Schmerz verzerrte sein Gesicht, als die Musik schlagartig abbrach und seine Finger zuckten wie die Scheren einer sterbenden Krabbe. Das Publikum war schockiert, aber explodierte nach einigen Augenblicken voller Sympathie und verzweifelter Begeisterung über den verwundeten Musiker und seine geradezu überirdische Kunst. Der Krampf ließ nach, die Fuge wurde grandios vollendet, und es gab niemandem im Saal, dessen Augen vor Beseelung nicht tränenerfüllt waren. Wie ein Mann riß es alle von ihren Sitzen, und der Saal brach in Toben und Stampfen aus – dies in einem der häßlichsten Gebäude Europas, dessen Betonstelen gleich dem bleichen Gerippe eines Tierkadavers im Zentrum Prištinas verwesten. Daraufhin spielten die Schweizer noch in herzrührender Seligkeit Guten Abend, Gute Nacht von Johannes Brahms, und spätestens da wurde auch mir, dem am liebsten unbeteiligten Beobachter, blümerant zumute.
Vor dem Hintergrund dieser Betonrippen richtete die deutsche Botschaft dann im Sommer unter freiem Himmel das obligatorische Public Viewing der Fußballeuropameisterschaft aus. Dem bierseligen, von Stromausfällen durchbrochenen deutschen Sieg im Halbfinale ausgerechnet über die Türkei war die dankbare Jugend Prištinas nicht minder gewogen als zuvor den Geigern aus der Schweiz.
Die Straße, der Aidan folgte, eröffnete zum ersten Mal diese drei Höhepunkte architektonischer Augenweide in ihrer ganzen Scheußlichkeit: das Hochhaus mit dem Peja-Bier, das Stadion und das Kulturzentrum. Ich war über mich selbst überrascht, daß dieser beklagenswerte Anblick meiner hervorragenden Stimmung mitnichten abträglich war. Im Gegenteil, ich fand ihn kurios und auf besondere Weise anziehend.
Rasch und unbewußt nahm ich von diesem Moment an angesichts des noch im Vergleich mit der traurigsten mitteldeutschen Plattenbausiedlung beklagenswerten Anblicks Prištinas gleichsam instinktiv die Haltung des Zynismus ein. Dieser Zynismus wurde mir und vielen meiner Kollegen über die Monate hinweg zur zweiten Natur und erlaubte es mir, auch noch den größten staatspolitischen Unfug, den zu verhindern ich die Macht nicht hatte, hinzunehmen, ohne darüber sogleich in Verzweiflung zu geraten. Es ist eine Haltung, für die ich mich im nachhinein schäme, und nur das Schreiben ermöglicht mir, den Aufenthalt im Kosovo ohne Verhärmung zu überstehen. Es ist ja nicht mein Land, sagte der Zynismus in mir, als ich zum ersten Mal auf Priština blickte, und dann hörte ich es immer wieder, wenn mir etwas im Grunde Unerträgliches unterkam: Es ist ja nicht mein Land. Und so entschloß ich mich, auch traurige und aufwühlende Umstände in einem Lichte zu betrachten, das sie einfach nur unterhaltsam, kurios oder intellektuell anregend erscheinen ließ.
Aidan steuerte den Wagen einen Hügel hinan. Das war Dragodan, das Diplomatenviertel. Der Weg war weniger befahren als die Straßen im Zentrum, hieß Street Ahmed Krasniqi und führte über einen kurzen, erst spärlich bebauten Höhenzug zu dem sogenannten Blue Building, meiner zukünftigen Wirkungsstätte, Heimstatt des International Civilian Office, kurz ICO. Die Erhebung erlaubte wiederum, diesmal aus entgegengesetzter Richtung, einen weiten Blick über die gesamte Stadt und – gottlob – bis in die Ferne zu den schneebedeckten Bergen der Šar Planina weit im Süden. Der höchste von hier aus zu sehende Gipfel hieß Ljuboten. Dies war der Blick aus meinem Büro. Da ich die Berge liebe, erfreuten mich die Leichtigkeit und der Kontrast immer wieder, wenn ich mit einer winzigen Bewegung meiner Augen den Blick von meinem Rechner hinweg über die Ebene und ihre steinerne Unwürde kläglichen Menschentums über das Amselfeld hinweg in die unberührte, zeitlose Erhabenheit des Ljuboten erheben konnte. Er war gleichmäßig wie eine Pyramide geformt und ragte mit seinen knapp zweitausendfünfhundert Metern ehrfurchtgebietend in den Himmel. Gut war die horizontal wie mit Lineal gezogene Baumgrenze zu erkennen, oberhalb derer nur noch das Grau des Gesteins und das Weiß von Eis und Schnee zu sehen waren.
Auf der meinem Büro gegenüberliegenden Straßenseite jedoch sollte im Frühsommer ein Bauvorhaben beginnen, das in der ortsüblichen Vorgehensweise als Betonskelett gegossen und dann stockweise mit Ziegelsteinen ausgefüllt wurde. Es versprach, ein weiteres Monstrum an Geschmacklosigkeit zu werden, wuchs langsam Stock um Stock. Mit auf dem Gebäude errichteten Seilwinden wurden per Hand immer neue Paletten der importierten roten Backsteine auf die jeweils oberste Betonplattform gehievt. Anstelle von Baukränen gab es nur diese mittelalterliche Methode. Gelegentlich fielen einige dieser Steine, etwas Schutt oder auch einmal ein Balken hinab, und bei einer solchen Gelegenheit wurde ein Bauarbeiter vor meinen Augen erschlagen. Das Gebäude aber wuchs unbeirrt weiter, und bald schon war dank der anschwellenden Sichtbarriere nur mehr die entfernter gelegene Hälfte der Stadt zu erblicken. Ich beschloß in diesem Sommer, meine Zeit im Kosovo exakt dann als beendet zu betrachten, wenn schließlich der Ljuboten hinter diesem monströsen Blickfang versunken sein würde. Dann, spätestens, wäre es Zeit zu gehen.
Bis dahin aber war es noch lange hin, denn soeben betrat ich das blaue Bürohaus zum allerersten Mal. Wir erreichten die Sicherheitsschleuse, die als Öffnung mitsamt einem kleinen Wachhäuschen zwischen die Betonelemente eingelassen war. Die Sicherheitsleute waren Ortskräfte und begrüßten Aidan auf Skip, der Sprache der Albaner. Shqip bedeutet deutlich oder klar, und der Skipetar ist im Albanischen derjenige, der – ursprünglich im Unterschied zu dem türkischen Fremdling – verständlich spricht, also nicht gänzlich verschieden von der Wortbedeutung des althochdeutschen diutisc, aus dem das verständliche teutsch und schließlich eben deutsch wurde. Immer und überall ist der Fremdsprachige der Barbar.
Interessiert und freundlich blickten die Wachmänner durch die herabgelassenen Autofenster hindurch auf mich, den wie jeden Neuankömmling mit gewisser Spannung Erwarteten. Die erste der beiden Schranken schloß sich hinter dem Wagen. Bevor die zweite sich vor dem Kühlergrill hob, um uns passieren zu lassen, vollzog sich ein Ritual, das vor jedem geschützten Gebäude im Kosovo an jedem einfahrenden Fahrzeug immer in derselben Manier vorgenommen wurde: Ein Sicherheitsmann umrundete das zu untersuchende Gefährt mit einem an einer Art Besenstil auf Rollen angebrachten Spiegel. Den Spiegel rollte er an mehreren Stellen unter den Fahrzeugboden, um nachzusehen, ob dort etwa ein Sprengkörper angebracht sei. Der Sinn dieser Maßnahme stand außer Zweifel, derartige Sprengstoffanschläge waren aus sämtlichen Krisenregionen bekannt. Jedoch wie immer, wenn Routine ins Spiel kommt, wurde die Überprüfung mit einer gewissen Nonchalance ausgeführt. Später einmal fuhr ich mit einem Freund zum Spaß an einem Sonntagmorgen mit zwei Bananen, die wir recht gut sichtbar am Fahrzeugboden angebracht hatten, sämtliche Objekte in Priština an, die mit einer solchen Schleuse versehen waren. Erst an der Einfahrt zum Hauptquartier der Nato fiel den Kontrolleuren auf, daß da Obst ungehörig am Chassis des EU-Dienstwagens hing.
Da meine Ankunft an einem Samstag geschah, lag das Blue Building still und verwaist in der niedrig stehenden Februarsonne. Seine Bezeichnung war treffend gewählt, denn die gesamte Fassade bestand aus blau getöntem Glas, wie es damals im Kosovo Mode war und man es an Sportwagen, Restaurants und sogar Privathäusern sehen konnte. Da das Gebäude schon in wenigen Wochen mit dem noch nicht im Lande befindlichen International Civil Representative (ICR) auch den European Union Special Representative in Personalunion beherbergen sollte, wurde die blaue Farbe von den Insassen wie der Bevölkerung als politisches Signal europäischer Präsenz gedeutet. Es hieß, das Blue Building sei ohne Baugenehmigung errichtet worden, aber das war im Kosovo ohnehin Normalität, und dank seiner blauen Farbe, die bald auch auf die zu seinem Schutz errichtete Betonmauer aufgetragen wurde, war es seinem Mieter – meinem Arbeitgeber – wohl über jeden Zweifel erhaben. Bei dem Gebäude handelte es sich um eine in der bereits beschriebenen, ortsüblichen Bauweise mit Ziegelsteinen angefüllte Betonkonstruktion aus sechs geräumigen Stockwerken. In diesem Fall jedoch ausnahmsweise verputzt. Dieser schon anhand seiner Farbe prätentiöse Neubau wäre auf den ersten Blick auch als mittelmäßiges Bürogebäude im Industriegebiet einer deutschen Vorstadt durchgegangen. Erst in seinem Inneren entdeckte man nach und nach Baumängel, die man andernorts vermutlich dann doch nicht akzeptiert hätte: Abfließendes Regenwasser trat bei Wind durch die blaugetönten Fenster ein, tragende Betonsäulen standen inmitten vieler der jeweils von zwei oder gar mehr Personen genutzten Bürozimmer als auch der größeren Besprechungsräume und erschwerten darin die Kommunikation. Viele Türen waren verzogen, weil die Böden eine gewisse Neigung aufwiesen, und die Stufen der Haupttreppe waren von unterschiedlicher Höhe, so daß man unversehens auf ihr ins Stolpern geriet. Aber alles in allem war das Gebäude erträglich; schließlich war ich nicht des Komforts wegen ins Kosovo gekommen.
Als großen Vorzug verfügte das Blue Building über einen wuchtigen Dieselgenerator, der die häufigen Stromausfälle zu jeder Tages- und Nachtzeit zuverlässig brummend überbrückte. Damit während der bei einem Stromausfall bis zum Anspringen des Generators unvermeidlichen Spannungsschwankung nicht sämtliche Rechner abstürzten, waren sie alle einzeln an Akkumulatoren angeschlossen, die permanent aufluden, bis es zum nächsten Stromausfall kam, um dann übergangslos den Netzstrom so lange zu ersetzen, bis die vom Generator gelieferte Spannung ausreichend und gleichmäßig war. Das Blue Building beherbergte außerdem eine wochentags gut besuchte Cafeteria. Sie konnte mit vorzüglichem Espresso-Macchiato und einem in aller Regel wohlschmeckenden Mittagessen aufwarten, das von einem Restaurant aus dem Stadtzentrum geliefert wurde. In den ersten Wochen nach meiner Ankunft war das Rauchen im ICO noch nicht verboten, so daß die Kollegen ihre Zigaretten und ich meine Zigarillos einvernehmlich am Arbeitsplatz genießen konnten – eine der bürgerlichen Freiheiten, derer ich in Frankfurt schon vor Jahren verlustig gegangen war. Doch es dauerte nicht lange, bis die pädagogische Segnung des in Mode gekommenen Rauchverbots den Balkan erreicht hatte und auch bei uns Einzug hielt und jeden Raucher aus der Behaglichkeit seines Büros vertrieb. Allerdings verfügte das Gebäude an seiner rückwärtigen Front über zahlreiche, verwinkelte Feuerleitern mit Plattformen, die an jedem Stockwerk angebracht waren und jeweils bis zu drei oder vier Personen erlaubten, den Tabakkonsum einigermaßen geschützt an frischer Luft fortzuführen, oftmals mit besagtem Espresso-Macchiato und einem dienstlichen Schriftstück in der Hand und die letzten Neuigkeiten austauschend. Der Macchiato war nicht nur in der Cafeteria des Blue Building köstlich, sondern im ganzen Land. Das osmanische Erbe hatte auch sein Gutes. Und hier, auf dieser Feuertreppe, entstand auch der Begriff für unser Tun: Macchiato Diplomacy.
Mein erster Arbeitstag als Macchiato-Diplomat sollte der folgende Montag sein, der 18. Februar 2008. Aidan hatte mich bereits an diesem Samstag ins Blue Building gebracht, damit ich ohne Verzug in allen Sicherheitsbelangen instruiert und ausgerüstet werden konnte. Ich wartete einige Augenblicke gegenüber einem Pförtner hinter blaugetönter Panzerglasscheibe, der mich ebenso freundlich und interessiert musterte wie zuvor die Wache an der Sicherheitsschleuse. Dann erschien der Chef der Sicherheitsabteilung, die sich wie alle anderen Einheiten des ICO noch im Aufbau befand. Der hochgewachsene, schlanke Mann hieß Peter Kaminek und hatte ein freundliches, klares Gesicht und professionelles Auftreten. Als wir uns miteinander bekannt machten, stellte sich schnell heraus, daß er Tscheche und ehemaliger Infanterieoffizier war. Sein graumeliertes Haar stand ihm gut zu den blauen Augen, und er war angezogen wie ein Ranger: Stiefel aus GoreTex, olivgrüne Trekkinghose mit großen, von Multifunktionstaschenmesser und anderen Utensilien prall gefüllten Beintaschen, graues Flanellhemd mit Schulterklappen und hochgerollten Ärmeln, die stark behaarte, muskulöse Unterarme und eine Uhr samt Kompaß am Armband freigaben. Kamineks Büro war angefüllt mit Funkgeräten, Nato-Landkarten, einer großen, mit Notizen gespickten Wandtafel, einem mit Listen, Tabellen und sonstigen Unterlagen überhäuften Besprechungstisch, vier weiß bepinselten Stahlhelmen auf einem Metallregal an der Wand, daneben Schutzwesten und weitere Gegenstände wie Handlampen, Ladestationen und Verbandsmaterial, mit dem sich der Raum im Handumdrehen in einen paramilitärischen Gefechtsstand verwandeln ließ.
Kaminek entnahm meinen Unterlagen, daß ich ebenfalls Infanterist und Offizier der Reserve war. Das erfreute ihn, und er meinte, daß er sich die Hälfte seiner nun folgenden Ausführungen sparen könne, da ich das Metier ja kenne. Ich erhielt zusätzlich zu einem dienstlichen Mobiltelephon ein weitreichendes Motorola-Handfunkgerät, wie ich es von der Bundeswehr her tatsächlich kannte, und eine kurze Einweisung in die Aufteilung der Frequenzen sowie die verschiedenen Funkkreise, die zwischen Nato, Uno und unseren neuen ICO-Einheiten in Betrieb waren, außerdem Verhaltensregeln für die unterschiedlichen Sicherheitsstufen und Angaben zu dem Sammelplatz einer möglichen Evakuierung durch Luftlandetruppen. Im Vorfeld der für den nächsten Tag vorgesehenen Unabhängigkeitserklärung war die Sicherheitsstufe erhöht worden, so daß wir in einer festgelegten Reihenfolge mehrmals täglich einen Funkappell durchführten und uns in ständiger Rufbereitschaft befanden. Ich unterschrieb eine Vielzahl von Belehrungen, Erklärungen und Belegen, die den Umgang mit sicherheitsrelevanten Informationen, Nachrichtendiensten, Sicherheitsbestimmungen usw. betrafen, und bemühte mich, alle Anweisungen mit einem Gesichtsausdruck von Routine und Vorverständnis aufzufassen. Das schien mir zu gelingen, denn in kurzer Zeit war die Prozedur beendet, und ich erhielt abschließend eine elektronische Marke zum Eintritt in das Gebäude, einen Schlüssel für mein Büro und zum Abschied einen kameradschaftlichen Schulterklaps von Kaminek, dessen Wucht mich leicht in die Knie gehen ließ.
Aidan brachte mich, dermaßen ausgestattet, zu einem zentral gelegenen Hotel und lud mein Gepäck aus, während ich mich am Tresen anmeldete. Dann war ich mir selbst überlassen. Für fünf Tage würde die Unterkunft im Hotel vom ICO bezahlt werden; in dieser Frist mußte ich eine Wohnung finden. Diese und alle anderen Ungewißheiten schob ich beiseite, richtete mich rasch ein und verließ das enge Zimmer wieder, um auf eigene Faust die Stadt zu erkunden. Mit dem Funkgerät im Holster unter meiner Jacke trat ich vor die Tür. Es war der Vorabend der Unabhängigkeitserklärung, und schnell war die Dunkelheit hereingebrochen. Da wir uns am äußeren Rand der mitteleuropäischen Winterzeitzone befanden, war der Himmel bereits am frühen Abend finster wie in tiefer Nacht, dazu sternenklar. Die Straßen waren noch belebter als zuvor, und die meisten Fahrzeuge promenierten in Vorfreude auf den Moment der Unabhängigkeit. Viele der Automobile waren mit Menschen überladen, die trotz der niedrigen Temperatur aus den Fenstern lehnten oder auf den Dächern und Motorhauben hockten. Sie streckten ihre Arme mit dem Victory-Zeichen empor und ließen große, blutrote, albanische Fahnen über ihren Köpfen wehen. Lautes Hupen und schrille Rufe erschollen durch die Nacht, eine verhaltene Spannung schien über Priština zu liegen.
So fühlt es sich an, wenn Geschichte geschieht, dachte ich zufrieden und sah mich ein wenig an die Zeit der Wende und meine Eindrücke des Jahres 1989 erinnert. Zwischen dem hin und her brandenden Verkehr und einer dichten Menge von Fußgängern erreichte ich einen kleinen Platz. Fast ausschließlich Männer waren unterwegs, mit dunklen Haaren und Augen, die meisten auch dunkel gekleidet. Doch einige Grüppchen von Jugendlichen rannten zwischen den Männern kreuz und quer, schwenkten ihre Fahnen, lärmten in die Nacht hinein und ließen gelegentlich eine Silvesterrakete in den schwarzen Himmel steigen. In der Menge bewegte sich außerdem ein besonderes Völkchen, das mit Photoapparaten, Kameras und Mikrophonen auf der Jagd nach schönen Bildern umherlief: Reporter der internationalen Nachrichtenagenturen, Fernsehsender und Zeitschriften. Ihre Übertragungswagen und Antennenschüsseln waren am Rande des Platzes versammelt und versicherten allen Anwesenden nochmals eindrücklich, daß sie einen historischen Moment zu erleben im Begriffe standen und die Augen der Welt sich für einen kurzen Wimpernschlag auf das richteten, was gerade jetzt in Priština geschah. Mir jedoch zerstörte die Anwesenheit der Reporter den Eindruck des Besonderen. Immer wenn eine Kamera auftauchte, wurden die Menschen schlagartig zu schlechten Schauspielern. Sie versammelten sich vor der Linse, und ihre Ekstase war nur mehr gespielt. Sie vollzogen ihre Veitstänze nicht nur vor dem Objektiv, sondern für das Objektiv. Genauso gut hätte sich ihr Verhalten auf den glücklichen Ausgang eines Fußball-Länderspiels beziehen können, fand ich und war enttäuscht ob der plötzlich greifbar gewordenen gekünstelten Banalität der gesamten Situation. Es war wie bei Heisenberg: Die Beobachtung eines Gegenstands verändert die Eigenschaft desselben.
Gerade, als ich Überlegungen zum Abendessen anstellen wollte, erhielt ich eine Kurznachricht von Veronika Winzmann. Sie kam vom Ratssekretariat der EU und war für unser Aufbauteam so etwas wie die Mutter der Kompanie. Über eine persönliche Empfehlung hatte sie maßgeblich meine Rekrutierung für diese Aufgabe betrieben. Zuletzt hatten wir uns in Brüssel bei meinen Einstellungsgesprächen gesehen, seither standen wir per E-Mail zu allen vorbereitenden Fragen in Kontakt. Nun erkundigte sie sich, ob ich gut eingetroffen sei und Lust auf ein gemeinsames Abendessen habe. Sogleich sagte ich zu, erhielt eine Wegbeschreibung als Antwort und fand mich kurz darauf in einem gemütlichen Restaurant inmitten einer kleinen, munteren Tischrunde wieder.
In Priština konnte man als Macchiato-Diplomat zu meiner freudigen Überraschung vielerorts vorzüglich und dazu preiswert essen. Die Gastwirte waren findungsreiche Improvisationskünstler und offen für kulinarische Einflüsse aus ganz Europa – nicht zuletzt, weil viele von ihnen als Flüchtlinge oder Gastarbeiter in den Küchen aller Herren Länder gearbeitet hatten. Die Gastronomie ist einer der für Flüchtlinge am ehesten zugänglichen Bereiche unseres überregulierten Arbeitsmarktes, und sie bedarf nur geringer Sprachkenntnisse. Die dort empfangenen Anregungen verquickten die Wirte, zurück in der Heimat, mit der kulinarischen Tradition des Balkans, die vor allem für frisches, herzhaftes und reichhaltiges Essen mit gegrilltem Fleisch stand. Dazu floß das gute, kühle Peja-Beer aus der deutschen Brauanlage in Strömen, für gewöhnlich gefolgt vom ortsüblichen Raki, wie die Albaner den Slibowitz nennen.
Zwischen Serben und Albanern herrschte die gleiche große Nähe in den Bereichen der Gaumenfreuden und der Musik wie zwischen Griechen und Türken oder zwischen Iren und Engländern, Bayern und Tirolern, Israelis und Libanesen. Natürlich würde jede Seite diesen Schluß weit von sich weisen, aber nach einem ausgiebigen Gastmahl in einem serbischen Restaurant und tags darauf einem ähnlichen Erlebnis in einem traditionellen albanischen Betrieb mit Tanz und Musik wären Verwandtschaft und Freundschaft dieser Völker jedem Außenstehenden plausibler erschienen als ihre erbitterte Feindschaft. Nur Schweinefleisch gab es bei den Albanern keines. In der Regel waren sie keine strengen Moslems, aber zumindest diese Vorschrift des Propheten befolgten sie penibel.
Später fuhren wir daher manchmal in die neben Priština gelegene serbische Enklave Gračanica. Dort konnte man erstens das bedeutende Frauenkloster besuchen, das mitsamt seinen Fresken von einer Handvoll junger, blonder, schwedischer KFOR-Hünen mit Knabengesichtern bewacht wurde. Zweitens konnte man in einem der wenigen, aber grundsoliden Straßenlokale Schweinefleisch essen und beim Metzger eine Wurst kaufen.
In dem Kloster war auf einem der bis über das sechzehnte Jahrhundert hinaus zurückzudatierenden Fresken die Höllenfahrt der Sünder dargestellt, und diese waren anhand ihrer Tracht gut als Türken zu erkennen. Den Abbildern der Heiligen hatten die Nachfahren der türkischen Gefolgsleute in einem späteren Zeitalter die Augen ausgekratzt, und ich war erzürnt über die zahlreichen Spuren des Vandalismus auch aus jüngster Zeit, die in der Kirche zu sehen waren.
Zu unserer Tischrunde an jenem Anfangsabend in Priština, da ich noch unvoreingenommen war, gehörten neben einem farblosen Herrn von der Kommission eine Europa-Abgeordnete der deutschen Grünen sowie ihr Lebensgefährte, ein pensionierter Oberstleutnant der Bundeswehr, Panzertruppe. Beide verfügten über Balkan-Erfahrung zuhauf und erzählten mir als Neuling gerne davon.
»Ich war damals im Krieg die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen«, hub die Abgeordnete an. »Das heißt, ich durfte für Joschka Fischer die Kastanien aus dem Feuer holen. Stellen Sie sich vor – die Partei der Friedensbewegung zieht in den Krieg! Nein, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was ich zu hören bekam. Aber wir sahen, daß die Serben 1999 drauf und dran waren, hier im Kosovo einen Völkermord an den Albanern zu begehen. Hunderttausende Flüchtlinge …«
»Die meisten von ihnen aber erst in der Zuspitzung durch das Bombardement«, warf ich ein. »Und diese Operation Hufeisen der Serben sei ja bis heute fraglich, habe ich gelesen. Jedenfalls war ich für die deutsche Innenpolitik seinerzeit froh, daß es die Grünen traf und im nachhinein fast erleichtert, daß wir Konservativen im Jahr zuvor die Wahl verloren hatten. Denn dieser Krieg mit deutscher Beteiligung unter einer bürgerlichen Regierung – da wären Sie doch über uns hergefallen, das hätte Lichterketten von Flensburg bis München gegeben. Die Ostermärsche und das alles, Nato-Doppelbeschluß inklusive, wären wie ein laues Lüftchen erschienen im Vergleich zu dem Budenzauber, den Sie entfacht hätten, wenn wir das an Ihrer Stelle hätten machen müssen.«
»Allerdings«, bestätigte sie. »So aber hatten wir den Schlamassel am Hals. ›Nie wieder Auschwitz‹, hat der Joschka immer gesagt. Wir mußten Milošević stoppen. Ich sage Ihnen, der war drauf und dran, einen Genozid zu begehen. Vor unseren Augen. An der Schwelle zum neuen Jahrtausend! Und das nach diesem fürchterlichen Jahrhundert, dessen Lektionen wir doch gelernt zu haben glaubten. Nein, wir mußten das tun; es gab überhaupt keine Alternative damals.«
»Sehen Sie mal«, warf der ehemalige Oberstleutnant ein, ein drahtiger Bartträger, wie ich sie bei der Panzertruppe öfter erlebt habe. »Ich lag mit meinen Leopard-Panzern damals bei Tetovo. Das halbe Bataillon hatten wir im Einsatz, um die Serben von den Mazedoniern fernzuhalten. Freischärler auf beiden Seiten. Die haben sich über unsere Köpfe hinweg mit Mörsern beschossen, und zwar ordentlich. Ich kann nur bestätigen, das war eine Situation damals, die hätte in Nullkommanichts zum Flächenbrand geführt. Es ging um alles oder nichts, und die Serben haben gesagt, jetzt machen wir ein für allemal Schluß und räumen hier auf, daß eine Ruhe ist mit dem ganzen Gesocks. So haben die gedacht, und die hätten hier überall ein Blutbad angerichtet, das können Sie mir glauben, wenn wir sie gelassen hätten.«
»Auschwitz ist ja auch nicht durch den Pazifismus beendet worden«, räumte ich ein. »Aber damals wie heute radikalisieren sich Kriegsparteien gegenseitig. Wir sind uns einig, daß die ganze Friedensduselei von solchen Gewalttätern nur ausgelacht wird, und ich bin froh, daß das sogar die Grünen dann erkannt haben. Aber ich interpretiere die damalige Lage unvoreingenommen so, daß wir gegen die Serben zu Felde gezogen sind, weil sie die Oberhand hatten, und nicht, weil die anderen sonderlich bessere Ziele verfolgt hätten.«
»Ich weiß nicht«, meinte die Abgeordnete. »Die Serben, das waren schon ganz klar die Bösen.«
»So wie wir früher«, lachte der Panzermann. »Einer ist doch immer an allem schuld.«
»Aber genau deshalb finde ich das zu einfach«, hielt ich dagegen. »Wie hat man sich das denn vorgestellt – die Serben aus der Luft mit Bomben zum Halten zu bringen – und dann?«
»Dann sind wir mit Bodentruppen eingerückt, von allen Seiten, und haben sie aus dem Kosovo herausgeworfen«, bestätigte der Panzermann.
»Ja, aber dann? Das, was wir jetzt hier erleben, diese Staatsgründung eines unabhängigen Kosovos – war das die Idee? Wie hat man sich das denn vorgestellt? Mit welchem Ziel und mit welcher Strategie ist man denn hier überhaupt hineingegangen?«
»Das war nicht das Ziel«, sagte die Abgeordnete. »Ich würde sagen, wir hatten überhaupt keine Strategie. Wenn Sie jetzt sagen, daß die Loslösung des Kosovos eine Folge des Krieges von 1999 sei, dann würde ich widersprechen. Das hätte alles auch ganz anders kommen können. Wir wollten einen Genozid verhindern, und das ist uns gelungen, und die Serben zurück an den Verhandlungstisch zwingen, und das ist uns auch gelungen. Und was regen Sie sich überhaupt auf. Das waren doch Ihr Kohl und Ihr Genscher, die ein paar Jahre zuvor die Sezession von Kroatien und Slowenien betrieben haben. Da können wir ja auch einmal darüber sprechen – wer ist denn schuld daran, daß das gute, alte Jugoslawien zerfallen ist wie ein fauler Apfel, wenn der Herbstwind kommt? Die alten Bundesgenossen und Waffenbrüder, die nimmt man gegen die Serben in Schutz, aber den Rest, die Moslems und Kümmeltürken, die überläßt man ihnen, damit man sich nicht selber damit herumschlagen muß. Das war doch die Haltung in Bonn die ganzen neunziger Jahre hindurch! Die Leute hier wurden jahrelang unterdrückt und unterjocht und gequält, und das hat überhaupt niemanden von euch interessiert! Bis es dann geknallt hat und die UÇK mal losgelegt hat.«
»Ich will keine Partei ergreifen. Keiner hat recht. Aber zurück zur Gegenwart. Das, was da morgen stattfindet, die Gründung der sogenannten Republik Kosova, das war vielleicht nicht die zwingende Folge von 1999 – aber umgekehrt stimmen Sie mir zu, daß unser kleiner Krieg von 1999 die notwendige Voraussetzung war, oder nicht? Ich denke allerdings, daß diese Weichenstellung ziemlich direkt auf die Sezession zulief, denn die Verhandlungen wurden doch von den Albanern in dem Wissen geführt, daß sie im Falle des Scheiterns die volle Unabhängigkeit erlangen könnten. Die Serben haben Krieg geführt, weil sie doch faktisch mit dem Rücken zur Wand standen. Da haben sie alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Und alles, was ich eigentlich sagen will, ist, daß die Politik jedenfalls völlig im Dunkeln tappt, wenn sie solche weitreichenden Entscheidungen trifft wie 1999. Man kann es ja den Willen der Geschichte nennen, der sich hier vollzieht und von deren vorbeiziehenden Mantel Ihr Parteivorsitzender ja damals auch so theatralisch gesprochen hat. Aber wenn das stimmt, dann müssen Sie mir doch zugestehen, daß die Steuerleute in der Regierung praktisch im Blindflug von einer Entscheidung in die nächste stolpern, und am Ende das herauskommt, was sich im Rückblick mit gewisser Notwendigkeit einfach vollzogen hat, weil es so kommen mußte und nicht, weil irgendein Stratege es als die bessere Option erkannt und planmäßig verfolgt hat. Es war schlichtweg die einzige von Tausenden Alternativen, die vor der Geschichte Bestand hatte, und alles andere ist mit zwingender Logik im Sande verlaufen. Und wenn das so ist, dann können Sie Ihren Joschka in der Pfeife rauchen, denn dann waren er und auch Sie nur Erfüllungsgehilfen von etwas, das sich mit der Gesetzlichkeit eines Naturereignisses vollzogen hat. Jeder kleine Panzerschütze vor Tetovo hat mehr Anteil an dem morgigen Ergebnis als Sie mit Ihren Pressemeldungen und Sonntagsreden von Auschwitz und Völkerverständigung, Demokratie und dem ganzen Zinnober. Bewahrt er die Nerven oder nicht; schießt er zurück oder nicht, wenn eine Mörsergranate zu kurz gezielt ist und bei ihm niedergeht – das sind die entscheidenden Fragen, nicht die morgendliche Lagebesprechung da bei Ihnen in Bonn oder Berlin.«
»Was für ein Unfug! Wir hätten doch damals auch entscheiden können, nichts zu tun, so wie wir beim zweiten Irak-Krieg ja auch nicht mitgemacht haben. Wir hatten die Wahl, das heißt die freie Entscheidung, und damit die Verantwortung, diese Entscheidung möglichst richtig zu treffen. Deswegen geht man doch überhaupt in die Politik!«
»Sehen Sie«, meinte ich. »Genau das halte ich für eine Illusion. Überhaupt keine Wahl hatten Sie. Ihr Joschka und Sie, sie kamen an jeweils Ihre Stelle, und Sie auch mit Ihren Leos da in Tetovo, Herr Oberstleutnant, weil Sie mit Ihrer Einstellung und Ihren Ressourcen in just diesem Moment dahin gehörten, um den Willen der Geschichte zu erfüllen. Oder wenn man religiös ist, dann gar den Willen der göttlichen Vorsehung, die ja vielleicht doch einen Plan hat, wohin das alles laufen soll mit den Menschen und Europa und dem neuen Jahrtausend. Nennen Sie das schizophren, aber ich bin im Tagesgeschäft schon immer sozusagen vorsichtig pessimistisch und gleichzeitig voller Zuversicht aufs Große, Ganze. Ich rechne mit dem Schlimmsten und hoffe auf das Beste. Aber der freie Willen in der Politik, wenn ich das zusammenfassen darf, ist doch wohl auf die Ergründung und möglichst zielgenaue Umsetzung dessen beschränkt, was von höherer Warte aus richtig und wahr ist und oftmals ohnehin vorbestimmt ist. Und wer sich dem entgegenstellt, geht unter. Punkt. Wie der Kommunismus in den 1980er Jahren, angefangen in Polen. Oder wie Milošević dann zehn Jahre später.«
Die Abgeordnete und ihr Oberstleutnant schüttelten fassungslos die Köpfe. Eine peinliche Stille entstand. Da hatte ich mich ja schön in die Nesseln gesetzt an meinem ersten Abend in neuer Umgebung. Warum konnte ich auch nie meinen Mund halten.
»Na, darauf prost«, warf lachend die gute Veronika Winzmann ein. »Wir wollen uns doch der Illusion nicht ganz begeben, daß der morgige Tag das Ergebnis einer bewußt gewollten und begrüßten Entwicklung sei. Sonst gäbe es doch gar nichts zu feiern, gar nichts, worauf man stolz sein könnte. Dann müßte man sich ja darauf beschränken, das alles nur zu beobachten und tiefschürfend zu ergründen.«
»Eben«, quittierte ich, »ich fürchte, so sehe ich das. Und trotzdem prost. Bei Tageslicht nimmt es sich gewiß wieder anders aus.«
»Na, das hoffe ich«, schloß die gute Veronika. »Sonst könnten wir ja gleich einpacken mit unserem ICO und später auch mit Eulex.«
»Aber nein«, sagte ich, bevor ich ging. »Die Schauspieler sind wichtig für das Stück. Jede einzelne Rolle muß gut gespielt werden. Auch in einer Farce. Aber man sollte sich nicht für den Regisseur halten, wenn man in Wahrheit doch nur seine vorgegebenen Sätze aufsagt. Gute Nacht allerseits.«
Der Ablauf der feierlichen Unabhängigkeitserklärung am nächsten Tag war von der amerikanischen Botschafterin kontrolliert und von ihrem Stab minutiös geplant worden. Diese resolute Person wurde von allen nur mit ihrem Vornamen Tina genannt und war zweifelsohne die mächtigste Instanz in dem an Instanzen nicht armen Kosovo. Das, was Tina wollte oder nicht wollte, wurde flüsternd und mit Ehrfurcht zitiert und galt im Zweifel mehr als geschriebenes Recht. Als Statthalterin Amerikas nahm sie im Kosovo den Platz ein, den ihr die osmanische Tradition mit dem Beylerbey geschaffen hatte, dem Herrn der Herren, Provinzgouverneur des Großwesirs.
Jene berühmte Tina lernte ich bereits einige Wochen nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovos bei einem Empfang kennen. Sie war in den späten Vierzigern, ihre Statur klein und untersetzt. Alles an ihr trug einen Ton von Grau; vor allem die Haut, die militärisch kurz geschorenen Haare und die Augen mit dem Blick eines Greifvogels. Ihr Händedruck war kräftig, und ihre ruhige, aber in besonderen Momenten auch zu lauter Dosierung fähige Stimme hatte ein männliches Timbre. Alles an ihr strahlte Schnelligkeit und Härte aus. Als Ehefrau und Mutter konnte ich sie mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Tina erzählte mir bei dem Empfang, als wir rückblickend über den kosovarischen Unabhängigkeitstag sprachen, daß der von den Amerikanern unterstützte Regierungschef und ehemalige Rebellenführer Hashim Thaci, den alle nur die Schlange nannten, seine eigenen Vorstellungen zum Ablauf der Feierlichkeiten gehegt hatte: Ein pathetisches Volksbekunden unter freiem Himmel und martialische Elemente waren vorgesehen, Siegesparade der ehemaligen UÇK und so weiter. Das Parlament sollte dabei eine untergeordnete Rolle spielen und die nicht hinter Thacis Partei PDK (Demokratische Partei des Kosovo) stehenden Clans gar nicht erst eingeladen werden. Dies betraf insbesondere den Rugova-Stamm, der mit dem auch noch nach seinem Tode in weiten Teilen der Bevölkerung verehrten Ibrahim Rugova die gemäßigte, zivile Strömung der LDK (Demokratische Liga des Kosovo) unter den Kosovo-Albanern repräsentierte, während der aus der Guerillatruppe UÇK hervorgegangene Thaci für die radikale, militärische Freiheitsbewegung stand. Schnell hatte Tina jedoch der Schlange klargemacht, wie die Unabhängigkeitsfeier vonstatten zu gehen habe: zivil, mitsamt der Familie Rugova und ausschließlich im Parlament – und exakt so vollzog sie sich auch.
Der Vormittag des 17. Februar 2008 begann für mich mit einem ausgiebigen Spaziergang durch die von freundlichem Sonnenschein erhellten Straßen Prištinas. Die Stadt war für den großen Moment der Freiheit bereit und voller Erwartung. In der zentralen Fußgängerzone, die erst vor kurzem von der Uno-Verwaltung und gegen erhebliche Widerstände auf einer vormals stark frequentierten Verkehrsstraße eingerichtet worden war, begegnete ich einem großen Marsch von UÇK-Veteranen. Ich war beeindruckt von der ruhigen Gefaßtheit, mit der die Männer, darunter viele Ältere, überwiegend schweigsam und in Räuberzivil in ungeordneten Sechserreihen über den Boulevard schritten. Das waren herbe Gesichter, zerfurcht von tiefen Falten, doch mit kleinen, schwarzen Augen, die wie Kohlenstücke glühten. Viele der Männer hatten sich untergehakt, und manchmal hob ein Sprechchor an, der verhalten aber nachdrücklich skandierte: »UÇK! UÇK!«.
Einige trugen ihre Barette aus der Kriegszeit, Waffen jedoch waren nicht zu sehen. Das fast wie ein Schweigemarsch anmutende Gedenken an die unerhörten Opfer, die für diesen Tag hatten gebracht werden müssen, stand in feierlichem und erhabenem Gegensatz zu dem überbordenden und bisweilen wenig authentischen Enthusiasmus der Jugend vom Vorabend. Auch die nicht dem Marsch zugehörigen Passanten befanden sich in gehobener, aber nur verhalten fröhlicher Stimmung. Lärm und Trubel wären deplaziert gewesen; nur an einigen Stellen und in Cafés, die schon zu Geselligkeit luden, war die Atmosphäre eher ausgelassen.
Konnte ich nun als Befreier durch die Stadt flanieren und mir hübsche Mädchen unterhaken wie ein Amerikaner im Herbst 1944 in Paris? Das konnte ich nicht. Die Albaner feierten für sich, und meine Rolle war die eines Beobachters. Einer Verabredung vom Vorabend folgend, fand ich mich in der Vertretung der EU-Kommission ein, die den modernsten und repräsentativsten Hochbau im Zentrum Prištinas belegt hatte. Wir waren einige Internationale und Ortskräfte und verfolgten gemeinsam im Fernsehen die Debatte und Abstimmungen, die im Plenum des Parlaments stattfanden. Als sich schließlich ausnahmslos alle dort anwesenden Abgeordneten erhoben und applaudierten, denn die Vertreter der serbischen Minderheit boykottierten die Sitzung, fielen sich bei uns die Ortskräfte in die Arme und vergossen Tränen der Freude. Dies war der seit langem sehnlich erwartete Moment der Unabhängigkeitserklärung. Wir Macchiato-Diplomaten gratulierten mit gewisser Zurückhaltung und schenkten Sekt aus. Zum einen sahen wir schon die erheblichen rechtlichen, ökonomischen und sicherheitspolitischen Probleme, mit denen wir uns zu befassen haben würden, zum anderen konnten wir mangels Übersetzung weder die Reden noch die Stimmung im Plenarsaal aufgreifen. Statt dessen führte ich am Rande der Übertragung erste Fachgespräche über wirtschaftspolitische Fragen mit den Kollegen von der Kommission und ließ mich ansatzweise in die aus ihrer Sicht wesentlichen Themenfelder meiner Tätigkeit einweisen.
Gegen Mittag verabschiedete ich mich, da ich mich wieder auf die Straße begeben und unter das Volk mischen wollte. Das war mittlerweile nun doch froh beim Feiern, und anders als am Vorabend feierten beiderlei Geschlechter zusammen. Vielleicht war das der Grund, weshalb die Festivität authentischer, fröhlicher und friedlicher wirkte; jedenfalls sah ich viele schöne Szenen echter, ausgelassener Freude. Ein kleiner Platz an einer der Hauptverkehrsstraßen war spontan Newborn Square benannt worden, denn ein Künstler namens Fisnik Ismaili hatte dort in übermannsgroßen, knallgelben Buchstaben aus breiten Metallquadern über Nacht die Geburt der unabhängigen Republik durch das Wort NEWBORN verewigt. Nun schrieben die Menschen mit Filzstiften ihre Namen, Hoffnungen, Wünsche und ihre überbordende Freude auf die großen, gelben Lettern, die alsbald vorne, hinten und seitlich über und über bekritzelt waren und auf diese Weise das Gefühl jenes historischen Augenblicks für die Zukunft bewahren wollten. So erreichte es erhebliche Bekanntheit weit über die Landesgrenzen hinaus und kann beispielsweise in einem Musikvideo bestaunt werden, das die in Priština geborene, britische Sängerin Rita Ora unter einem vielsagenden Titel drehte: Shine Ya Light – Set the World on Fire. Sechs Jahre nach der Unabhängigkeit wurde das Denkmal schließlich neu bemalt, und zwar in den Uniform-Tarnfarben derjenigen westlichen Streitkräfte, die 1999 in das Kosovo eingerückt waren. Anonyme Sprayer brachten rosafarbene Herzchen auf dem martialischen Anstrich an.
Vorläufig jedoch erschien das Denkmal in freudigem Gelb, und den ganzen Nachmittag über streifte ich durch die Innenstadt. Nur einmal pausierte ich in meinem engen Hotelzimmer, da es trotz des Sonnenscheins winterlich kalt war und ich mich aufwärmen wollte. Für den Abend hatte ich dank Veronikas Empfehlung eine Einladung zu einem Empfang des Deputy ICR erhalten. Das ICO wurde durch den International Civilian Representative, den ICR, geführt. Dieser stellte gemäß der noch zu verabschiedenden Verfassung die höchste zivile Instanz im Kosovo dar, befand sich allerdings noch gar nicht im Lande. Sein Stellvertreter jedoch war schon im Amt und fungierte somit als ranghöchster Angehöriger unseres ICO-Vorbereitungsteams. Der Mann hieß John Barton und war Amerikaner, Diplomat und, vielen Stimmen zufolge, Nachrichtendienstler. Auch er hatte mich im Rahmen meiner Rekrutierung in Brüssel interviewt, so daß wir bereits einen ersten Eindruck voneinander hatten gewinnen können.
Was er von mir hielt, außer der Tatsache, daß er meiner Einstellung zugestimmt hatte, erfuhr ich bis zum Ende meiner Dienstzeit nicht. Auf mich wirkte er zu diplomatisch, wenig pragmatisch und zupackend, eher intellektuell und professoral statt professionell. Er war hochgewachsen, hager, schlaksig und mit klugen Gesichtszügen, in amerikanischer Manier immer etwas nachlässig und in zu großen Anzügen gekleidet, mit in gedeckten Farben gehaltenen Button-down-Hemden und in dünnem Knoten zu lang gebundenen, viel zu bunten Krawatten. Er war alleinstehend und verfügte über ein hervorragendes, überraschend geschmackvoll eingerichtetes Appartement ganz oben am Dragodan-Hügel, mit weiter Aussicht auf die Stadt und die am Horizont zu ahnenden Berge. Barton hatte einige Dienstjahre im Orient zugebracht und von dort eine Reihe von Exponaten und Kunstgegenständen mitgebracht, die seine Wohnung schmückten. Daß ich keinen persönlichen Zugang zu ihm fand, bedauerte ich manchmal. Wie ich führte er Tagebuch. Sicherlich wäre er ein interessanter Gesprächspartner gewesen, doch er blieb mir verschlossen. Das Letzte, was ich nach meiner Zeit im Kosovo von ihm hörte, war, daß er einen neuen Posten im Irak angetreten habe.
Überhaupt schienen sich so manche meiner Kollegen im Kosovo über kurz oder lang im Irak oder gar in Afghanistan wiederzufinden. Einige verschlug es auch in den Kaukasus; die meisten aber blieben auf immer auf dem Balkan. Die Entwicklungshilfe war auf Dauer nicht mein berufliches Ziel, so daß ich mir von Anfang an vornahm, meinen Aufenthalt auf maximal ein Jahr zu begrenzen – eben bis ich den Berg Ljuboten von meinem Büro aus nicht mehr würde sehen können.
Das Bonmot kursierte unter uns Macchiato-Diplomaten, daß man drei sogenannte M-Phasen im Entwicklungsdienst absolviere: missionary, mercenary, misfit. Man begann als Missionar mit einer gehörigen Portion Idealismus, wurde dann aufgrund der guten Bezahlung zum desillusionierten Söldner, um zuletzt für Beruf und bürgerliches Leben in der Heimat untauglich geworden zu sein. Das aber war nicht der Weg, den ich beschreiten wollte.
Als ich den Dragodan-Hügel unterhalb der Residenz John Bartons über die lange Freitreppe erklommen hatte, mit der man in rüstigem Fußmarsch die serpentinenartig hinanführende Straße abkürzen konnte, brauchte ich eine Weile, um sein Haus zu finden. Doch dann bemerkte ich schon aus einiger Entfernung die Gesellschaft, die sich hinter den hell erleuchteten, großen und bis auf den Fußboden hinabreichenden Fenstern im obersten Stock des Appartementgebäudes versammelt hatte. Trotz der niedrigen Temperatur befand man sich auch auf der großzügigen, hinter schußsicherem Panzerglas geschützten Dachterrasse in lockerem Gespräch. Jazz-Musik, Gelächter und Stimmengewirr waren von der Straße her zu vernehmen. Ich gesellte mich hinzu und wurde von Barton freundlich aufgenommen. Er hielt eine kurze Rede über den historischen Moment sowie die großen Aufgaben, die uns erwarteten, und brachte einen Toast auf die neugegründete Republik Kosova aus.
Als habe Priština auf das Ende seiner Ansprache gewartet, brach nach Bartons letztem Satz kolossales Geknattere in der ganzen Stadt los wie der Lärm eines schweren Infanteriegefechts. Salvatory fire, sagte Barton trocken, und alles stürzte auf die Terrasse, um sich das Freudenfeuer anzusehen: Militärische Leuchtkugeln stiegen in die nachtschwarze Luft, um am Fallschirm qualmend und langsam zu Boden zu trudeln, ganze Stadtviertel in gespenstisches Licht tauchend, einmal gelb, dann wieder rot und grün. Aus unzähligen Läufen ratterten die an Ton und Kadenz unverkennbaren Salven von Kalaschnikow-Sturmgewehren, und Garben von Leuchtspurmunition zischten durch den Himmel. Dazwischen knallten in schneller Folge einzelne, trockene Pistolenschüsse aus allen Ecken der Stadt. Das vielfältige Getöse war von unserem erhöhten Standpunkt aus gut vernehmbar, zumal wir die Panzerglasscheiben von Bartons Terrasse zur Seite hin aufgeklappt hatten. Ich erfuhr von einer hübschen Diplomatin aus Schweden, daß es im Kosovo mehr Schußwaffen als Einwohner gebe, und vermutete, daß keine einzige davon in dieser Nacht nicht zum Einsatz kam. Man solle sich nicht im Stadtzentrum aufhalten oder sich zumindest unterstellen, krächzte es sodann aus unseren Funkgeräten, damit man nicht von herabfallenden Projektilen getroffen werde. Der Kitzel der Gefahr würzte die Stimmung aller. Sprachlos blickte ich lange auf den feuerspeienden Hexenkessel zu meinen Füßen und sagte mir schließlich, daß der Geruch von Pulverdampf wohl zwangsläufig zur Geburt von Staaten gehöre – genau wie zu ihrem Untergang. Bartons Champagner war köstlich, und die schwedische Diplomatin tunkte eine Erdbeere in mein Glas, um sie mir anschließend in den Mund zu stecken.