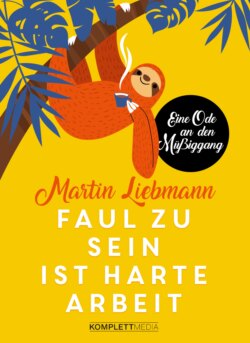Читать книгу Faul zu sein ist harte Arbeit - Martin Liebmann - Страница 10
ОглавлениеDas Wetter im Norden ist im Allgemeinen recht verlässlich. Zwischen Elbe und Ostsee, wo ich die längste Zeit meines bisherigen Lebens verbracht habe, braucht man keine Wetter-App, um vorhersagen zu können, dass von Herbst bis Frühling eine Himmelsfarbe vorherrschend ist: grau.
Im Gegensatz zu den Eskimo, die angeblich Dutzende Wörter für die unterschiedlichen Manifestationen von Schnee haben, begnügen wir Fischköppe uns bei der Beschreibung des mindestens von November bis März vorherrschenden meteorologischen Phänomens mit dem alle seine Spielarten trefflich beschreibenden Begriff des Schmuddelwetters. Der sprachlichen Vielfalt wegen rege ich an dieser Stelle an, ein paar neue Wörter für solchen Regen zu erfinden, der nicht wie ein Schauer oder ein Platzregen senkrecht auf die norddeutsche Tiefebene prasselt. Allein in Abhängigkeit von Tröpfchengröße und Einfallswinkel müssten da doch noch andere Begriffe zu finden sein als Niesel- oder Sprühregen. Wie wäre es beispielsweise mit »kalter Brauser«, »Durchnässer« oder »Horizontalfontäne«?
Zur Ehrenrettung der Nordlichter soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass sich aus dem Umgang mit dem Dauerregen eine Lebenseinstellung entwickelt hat, die quasi aus Ermangelung sonniger Aussichten von einem ebenso unglaublichen Optimismus wie von einer stoischen Gelassenheit zeugt. Sprachlich manifestiert sie sich in diesem kurzen Satz: »Da hinten wat dat heller!« Diese plattdeutsche Lebensweisheit will sagen, dass zumindest am fernen Horizont etwas Licht zu erwarten ist. Der Sommer wird schon irgendwann kommen, mag er auch noch so kurz und nass sein.
Das norddeutsche Schmuddelwetter scheint eines der wenigen Dinge zu sein, auf die wir uns noch verlassen können. Ansonsten ist so ziemlich alles um uns herum einer immer schnelleren Veränderung unterzogen. Der Philosoph Hermann Lübbe hat einen ebenso treffenden wie schönen Begriff dafür geprägt: Gegenwartsschrumpfung. Mir gefällt dieses Wort deshalb so gut, weil es mich fast schon körperlich spüren lässt, wie das Veränderungstempo sowohl von der Vergangenheit als auch von der Zukunft her dem Jetzt auf die Pelle rückt. Gegenwart ist die Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das ist noch einfach zu verstehen. Zu begreifen, warum die Gegenwart schrumpft, dazu benötigt es einer näheren Betrachtung, wie wir das Jetzt erleben. Dieses Erlebnis hat etwas mit Verlässlichkeit zu tun. Wie weit können wir uns auf unsere in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen verlassen? Und wie weit können wir zumindest einigermaßen verlässliche Erwartungen an die Zukunft haben? Je langfristiger der Blick in die Vergangenheit wie auch in die Zukunft uns einen Orientierungsrahmen bietet, desto ruhiger und entspannter wirkt sich das auf unser Leben aus, desto ausgedehnter erleben wir die Gegenwart. Wird die Halbwertszeit unserer Erfahrungen und Erwartungen hingegen kürzer, vergeht auch die Gegenwart schneller. Sie schrumpft. Immer weniger hilft uns das, was wir bereits gelernt haben. Immer verschwommener verflüchtigen sich die Umrisse unserer Zukunft.
Für Lübbe ist die zunehmende Innovationsgeschwindigkeit der Motor dieser Entwicklung. Und bei Innovationen sind wir heute besonders produktiv. Gegenwartsschrumpfung merkt man schon an so banalen Dingen wie Telefonnummern. Die damalige Festnetznummer meines besten Freundes aus der Grundschulzeit habe ich heute noch im Kopf. Damals hatten die Telefone noch Wählscheiben, waren mit einem Kabel über eine Buchse fest mit der Wand verbunden, und die Rufnummern, unter denen man jemanden erreichen konnte, wechselten gefühlt nie. Meine Kinder haben keinen Festnetzanschluss mehr. Mir ihre Handynummern zu merken habe ich mir dagegen inzwischen abgewöhnt. Dass es in jedem Telefon von heute, ob Festnetz oder Mobilfunk, ein Adressbuch gibt, in dem sich die Kontaktdaten bequem speichern und abrufen lassen, ist nicht der Grund dafür. Es ist vielmehr die Erfahrung, dass meine Anrufversuche immer wieder ins Nichts gingen, weil die Kinder mal wieder ihre Anbieter gewechselt hatten. In Spitzenzeiten hatte ich von einer meiner Töchter fünf verschiedene Rufnummern in meinem Handy abgespeichert, wovon nur eine der Schlüssel zu einem Gespräch mit ihr war. Es lohnte sich irgendwann einfach nicht mehr, dass ich mir auch nur eine davon merkte. Da ich nie daran dachte, alte Nummern von ihr zu löschen, half mir das Adressbuch in meinem Mobiltelefon allerdings nur bedingt weiter. Die Verlässlichkeit, meine Tochter unter einer mir bekannten Ziffernfolge zu erreichen, wurde vielmehr zu einem Glücksspiel mit der Wahrscheinlichkeit, zwei Richtige im Lotto zu haben. Überhaupt ist das Mobiltelefon – oder besser Smartphone – ein Paradebeispiel für die Gegenwartsschrumpfung. Kaum gekauft und ausgepackt, ist es auch schon veraltet. Das nur ein paar Wochen später auf den Markt kommende Modell fängt mit besserer Kamera mehr Pixel ein, ist viel schneller, bedient die neuen Funknetzstandards, hat – je nach Trend – ein kleineres oder größeres Display, auf jeden Fall aber mit feinerer Auflösung, verspricht noch mehr Möglichkeiten durch noch mehr Apps und ist – so die Aussage der Hersteller – noch intuitiver zu bedienen. Wer einigermaßen auf dem aktuellen technischen Stand bleiben will, müsste spätestens alle zwei Monate sein quasi neues Smartphone gegen ein noch neueres austauschen. Mir wird schon bei dem Gedanken schwindelig, der Aufforderung meines Mobilfunkanbieters zu folgen und alle zwei Jahre das alte gegen ein neues Handy auszutauschen. So lange brauche ich in etwa, bis ich mich an das Gerät gewöhne – zumal sich in dem Teil selbst mit jedem zweiten Update so viel ändert, dass ich mich vor lauter neuen Funktionen, Symbolen und Anordnungen nicht mehr damit auskenne. Die Halbwertszeit meines mühsam angelernten Wissens über den Umgang mit dem Hosentaschenrechner gleicht ungefähr der eines Eiswürfels in der prallen Augustsonne auf einer Mittelmeerinsel. Das einzig Verlässliche an dem Gerät ist, dass es mich regelmäßig auffordert, das Betriebssystem und die Programme auf den neuesten Stand zu bringen – und dass der Akku meist dann leer ist, wenn ich damit wirklich einmal telefonieren will.
So offensichtlich uns die digitale Welt die Gegenwartsschrumpfung vor Augen führt, so existenziell beschleunigt sie unsere analogen Lebenswelten. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden Berufe noch vererbt. Wer auf einem Bauernhof geboren wurde, verdiente sein Brot später selbst in der Landwirtschaft, die Kinder und Enkel von Ärzten studierten ebenfalls Medizin, und die von Schustern wurden selbst Schuster. Derartige Verlässlichkeiten finden wir heute fast nur noch aufgrund der immer noch großen sozialen Undurchlässigkeit unseres Bildungssystems, heißt: Kinder aus Akademikerhaushalten studieren in der Regel weit öfter als solche aus Arbeiterhaushalten. Ein paar Generationen später waren die Berufsaussichten glücklicherweise deutlich vielfältiger, aber es war immer noch eher die Regel als die Ausnahme, dass man sein Arbeitsleben in der Firma beendete, in der man es angefangen hatte. Mein Vater gehörte noch zu dieser Generation. Für ihn war es unvorstellbar, in ein anderes Unternehmen zu wechseln. Seine damalige berufliche Gegenwart muss für ihn sehr entspannt gewesen sein. Er konnte sich ebenso darauf verlassen, dass seine gemachten Erfahrungen von Wert waren und Bestand hatten, wie darauf, dass seine Zukunft in einem ihm bekannten Rahmen stattfinden würde. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Stationen ein heute ins Berufsleben eintretender Mensch im Durchschnitt durchlaufen wird, aber ich bin mir sicher, dass es kaum noch Leute gibt, für die es normal und selbstverständlich ist, bis zum Ruhestand in nur einem Unternehmen zu arbeiten. So eine Kontinuität entspricht sicherlich nicht den Lebensentwürfen, die uns im Sinne selbstbestimmter Individualität vorschweben. Heute wird so manche Personalabteilung ja schon misstrauisch, wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber irgendwo über zehn Jahre am selben Arbeitsplatz tätig war. Ist so jemand flexibel genug, um die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt zu bewältigen? Flexibilität – also die Fähigkeit, elastisch, biegsam und anpassungsfähig zu sein – wird zu einer immer wichtigeren Voraussetzung, überhaupt noch einen Job zu bekommen. Ist man auf einen bestimmten Ort, auf feste Arbeitszeiten oder auf ein begrenztes Aufgabengebiet eingeschränkt, verringert das die beruflichen Chancen immens. In vielen öffentlichen Berufen, in denen frühere Generationen als Beamte sich auf eine lebenslange Beschäftigung verlassen konnten, werden zunehmend Angestelltenverhältnisse angeboten – gern befristet. Auch die Unternehmen wollen so flexibel wie möglich sein. Die Märkte ändern sich so rasant, dass es zum Wettbewerbsvorteil wird, sich bei Bedarf möglichst ohne Wartezeit und Probleme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen zu können, wie es heißt, um das unschöne Wort entlassen zu vermeiden. Die Anzahl der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter ist mit über einer Million Menschen in Deutschland so hoch wie noch nie. Die Halbwertszeit unserer beruflichen Zukunft hat sich dramatisch verkürzt – und ich habe da so eine Ahnung, dass wir noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Wenn die durchschnittliche Verweildauer der Angestellten in einer Firma allerdings nur noch ein halbes Jahr beträgt – und ich kenne Unternehmen, in denen sich so etwas abspielt –, dann verengt sich die Gegenwart auf einen beklemmend kleinen Zeitraum.
Dass die Gegenwartsschrumpfung auch nicht vor unseren Lebenspartnerschaften haltmacht, verwundert mich nicht. Die durchschnittliche Ehe in Deutschland hat zwar rund fünfzehn Jahre Bestand, und nur die knappe Hälfte der Paare lässt sich scheiden, aber im Generationenvergleich gibt es heute viel weniger Ehen als früher, und seit dem ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert geben sich die Paare erst viel später das Ja-Wort fürs Leben. Dass sich seit den 1960er-Jahren der Anteil von Single-Haushalten von rund 20 Prozent auf gut 40 Prozent verdoppelt hat, lässt zumindest vermuten, dass trotz der Sehnsucht nach der großen Liebe immer weniger Menschen es wagen, sich in gemeinsamen vier Wänden längerfristig aufeinander einzulassen. In den zum Land vergleichsweise schnelllebigen Großstädten zeigt sich das besonders deutlich. Der Anteil an Single-Haushalten ist hier extrem hoch.
Auch der Rückgang des Kinderkriegens ist ein Beleg für die Gegenwartsschrumpfung. Die Entscheidung für ein Kind ist eine der wenigen, die sich nicht mehr so leicht rückgängig machen lässt. Etwas, das ich gekauft habe, kann ich wieder verkaufen, verschenken oder wegschmeißen. Einen Job kann ich wechseln. Selbst eine Lebenspartnerschaft kann ich beenden. Mein Kind bleibt aber mein Kind – für immer. Diese Langfristigkeit passt so gar nicht in das Bild eines flexiblen Menschen. Sind wir reichen Industriegesellschaften vielleicht auch deshalb so arm an Kindern?
So naheliegend diese Vermutung ist, so fern liegt es mir, die Möglichkeiten der Veränderung in den Bereichen der Partnerschaft und des Berufs zu verteufeln. Im Gegenteil: Wer in einem miesen Job oder einer schrecklichen Beziehung bleiben müsste, würde damit bestimmt nicht glücklich. Die Freiheit, unser Leben verändern zu können, hat allerdings unter anderem den Preis eines beschleunigten Lebenstempos. Und wenn Veränderung zum Selbstzweck wird, dann darf man sich nicht wundern, dass die Gegenwart so sehr zusammenschrumpft, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen können und das Leben an uns vorbeirauscht. Vielleicht sehnen sich angesichts eines solchen Gegenwartsvakuums deshalb heute so viele Menschen nach etwas Beständigem – nach etwas, das bleibt. Unser Drang, alles irgendwie zu konservieren, erscheint mir als ein Versuch, ein paar Haltegriffe in unser Leben einzubauen. Hermann Lübbe sah den Aufbau von Museen als ein Anzeichen dafür. Heute haben wir alle unsere ganz persönlichen Museen: mit tausenden Fotos gefüllte Galerien auf unseren Smartphones und Festplatten, in unseren digitalen Wolkenspeichern und Ablageboxen. Von Sekunde zu Sekunde erweitern sich die digitalen Sammlungen um zahllose neue Bilder. In meiner Kindheit gab es noch Dia-Abende. Die Jüngeren unter Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, werden wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, was ein Dia ist, geschweige denn einmal ein Monster von Diaprojektor zu Gesicht bekommen. Sie kennen den Begriff der Diashow vermutlich nur noch als Funktion von Bildbetrachtungsprogrammen auf dem Computer. Die ursprüngliche Diashow war ein ebenso aufwendiges wie mehrheitlich verhasstes Ritual. Damals fotografierte man noch analog. Die Älteren erinnern sich: Dazu musste man Filme in die Kamera einlegen, die in der Regel 24 oder 36 Bilder aufnehmen konnten. Beim sogenannten Dia- oder Umkehrfilm, der besonders gern für Urlaubsbilder genutzt wurde, bekam man nach dessen chemischer Entwicklung Filmstreifen zurück, die feinsäuberlich in einzelne Bilder geschnitten und in kleine Plastik- oder Glasrahmen gefriemelt werden mussten. Für Grobmotoriker wie mich war allein das schon eine Qual, die in ihrer Unerträglichkeit nur noch von eben jenen Dia-Abenden übertroffen wurde, an denen die bildgewordenen Urlaubseindrücke vorgeführt wurden. In speziellen Kassetten sortiert wurden die Durchlichtbilder in einen Projektor geschoben, in einem dunklen Raum an eine Leinwand, die gern ein aufgespanntes Betttuch sein konnte, geworfen und dabei so ausführlich kommentiert, dass ein Spielfilm mit Überlänge dagegen wie im Flug vergeht. Wenn Quentin Tarantino in »Pulp Fiction« John Travolta, Samuel L. Jackson und Uma Thurman über zweieinhalb Stunden viel Unheil anrichten und erleben lässt, für den Western »Django unchained« noch einmal zehn Minuten länger braucht und die blutige Geschichte der »Hateful Eight« gar über drei Stunden ausbreitet, mag das ungemein kurzweilig sein. Die Regisseurinnen und Regisseure von Diashows verfügten in der Regel über deutlich weniger Erzähltalent. Der einzige Trost war, dass durch die analoge Begrenzung des Fotomaterials auf besagte 24 oder 36 Bilder pro Film von jedem Motiv in der Regel nur ein oder zwei Aufnahmen gemacht wurden. Diese Praxis sollte man vielleicht auch für das digitale Fotografieren wieder einführen. Die meisten elektronisch gespeicherten Fotos bleiben ja ohnehin unbetrachtet. Ihr eigentlicher Sinn besteht darin, so meine Unterstellung, etwas festzuhalten, was sich beim heutigen Vergänglichkeitstempo sonst schon nach wenigen Momenten verflüchtigt hätte. Unser Heißhunger auf Zukunftsprognosen dürfte sich aus demselben Bedürfnis heraus entwickelt haben – nur eben nach vorn gerichtet. Wir sehnen uns umso mehr nach Propheten, je weniger verlässlich wir ahnen können, was auf uns zukommt. Eines der vielen dem amerikanischen Baseballspieler Yogi Berra zugeschriebenen Bonmots bringt es auf den Punkt: »Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie einmal war.« Allen, die nach einer Erfolg versprechenden Geschäftsidee suchen, kann ich nur empfehlen, irgendetwas ins Auge zu fassen, das entweder die Illusion eines Festhaltenkönnens an der Vergangenheit oder einer verlässlichen Vorhersage verkauft – also irgendetwas mit Bildern zu machen oder eine Zukunftsforschungsstätte zu gründen. Der Bedarf dafür wird in dem Tempo weiter steigen, in dem unsere Gegenwart schrumpft.
Anscheinend aber erwächst aus dem Bedürfnis nach Nachhaltigkeit noch lange kein entsprechender Wille. Womit wir zurück beim Wetter sind. Denn selbst am Klima arbeiten wir ja schon kräftig. Der sich über Jahrhunderte vollziehende Klimawandel scheint uns viel zu langsam zu gehen. Da muss man doch etwas machen können! Kann man. Machen wir auch. Lebe wohl, du hassgeliebtes norddeutsches Schmuddelwetter. Wir machen jetzt Wetterinnovationen. Vielleicht erfinden wir ja auch noch etwas, womit sich die Erde selbst schneller drehen lässt. Dann würden die Tage und Nächte nicht mehr so lange dauern – und wir hätten in einem Jahr auch ein paar mehr davon.