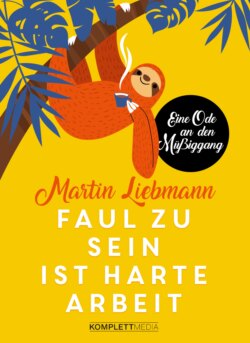Читать книгу Faul zu sein ist harte Arbeit - Martin Liebmann - Страница 9
ОглавлениеIch freue mich regelmäßig über meine Waschmaschine. Meinem Ärger über die stets pünktlich nach fünf Jahren ihren Dienst verweigernden Modelle, deren Reparatur in keinem vertretbaren finanziellen Aufwand stand, habe ich irgendwann einmal einen Schlusspunkt gesetzt. Heute steht eine gebrauchte Qualitätsmaschine in meinem Keller, deren Trommel sich bestimmt noch viele Jahre für mich dreht und die sich im Bedarfsfall auch recht einfach reparieren lässt. Ich singe ihr ab und zu ein kleines Dankeslied, dass sie mir die Arbeit abnimmt. Mit ein paar Handgriffen stopfe ich die Wäsche hinein, drehe einmal am Programmrad und drücke den Einschaltknopf, um mich dann anderen Tätig- oder Untätigkeiten hinzugeben, die mir mehr Freude oder Genuss bereiten. Herrlich! Auch als ich neulich einen kranken Baum in meinem Garten fällen musste und nach einer Stunde Handsägearbeit und der damit verbundenen Schweißproduktion von gefühlten zwei Litern der Nachbar mit seiner Motorsäge zu Hilfe kam, wurde mir klar, wie zeitsparend und hilfreich der Einsatz von Maschinen ist. Der Stamm lag binnen weniger Minuten auf dem Boden und nur ein Viertelstündchen später von seinen Ästen befreit in handlichen Stücken aufgestapelt. Ohne diesen Motorsegen hätte ich Tage dafür gebraucht – und einen ordentlichen Muskelkater und wahrscheinlich auch Rückenschmerzen gratis dazubekommen. Stattdessen konnte ich mich nach vollbrachtem Werk zusammen mit meinem Nachbarn bei einem erfrischenden Bierchen dem malerischen Sonnenuntergang dieses Wintertages hingeben.
Auch ohne Waschmaschine und irdischen Motorsegen träumten schon die großen Denker der alten Griechen von einer Welt, in der uns Maschinen die Arbeit abnehmen. Aristoteles und Konsorten konnten sich ganz aufs Denken und die Muße konzentrieren, weil im klassischen Athen die wirklich fiesen Arbeiten von Sklaven verrichtet wurden. Es war den Philosophen aber bewusst, dass die Welt besser sein würde, wenn statt übelst geknechteter Menschen Automaten die Dinge verrichteten, zu deren Erledigung sich ein edler Geist niemals erniedrigen würde. Der menschliche Erfindungsreichtum hat seitdem Erstaunliches hervorgebracht, zum Beispiel die Elektrizität und den Verbrennungsmotor. Schier unendlich viele Apparate setzen seitdem alles Mögliche in Bewegung und übernehmen damit die Mühsal körperlicher Schufterei. Spätestens seit der Erfindung des Computers, der auch das Rechnen, Suchen, Sortieren, die Steuerung der Maschinen und zunehmend anspruchsvollere Aufgaben für uns übernimmt, müsste der alte Traum von der Erlösung von der Arbeit umzusetzen sein. So scheint es. Aber irgendwie ist schon wieder etwas schiefgelaufen, denn trotz der kürzesten Arbeitszeiten, die wir historisch gesehen je hatten, klagen von Jahr zu Jahr mehr Menschen darüber, keine Zeit zu haben. Dabei nehmen uns fast überall die Automaten viel Arbeit ab. Dank der Waschmaschine und ihrer Kollegen werden einige Stunden pro Woche von Arbeit frei. Entfernungen können wir mittels Automobilen, Zügen und Flugzeugen um ein Vielfaches schneller überwinden als die Generationen vor uns. Und für die Übermittlung von Botschaften brauchen wir weder Papier, Tinte und Briefumschlag noch eine Briefmarke und den Gang zum nächsten Briefkasten. Wir tippen die Texte in den Computer oder das Smartphone und schicken sie mit einem Klick mühelos und fast in Lichtgeschwindigkeit auf die Reise bis in den letzten Winkel unserer Welt. Wir müssen dafür nicht einmal mehr aufstehen. Mit Spracherkennungssoftware entfällt sogar die Fingergymnastik. Der Aufwand für die Herstellung von Waren und Maschinen, für unsere Mobilität und in besonderem Maße für die Kommunikation hat sich dermaßen reduziert, dass wir alle länger im Bett bleiben und den schönen Dingen des Lebens unsere fast ungeteilte Aufmerksamkeit schenken könnten. Warum also die ganze Hetzerei?
Der Widerspruch von maschinenbedingten Möglichkeiten, Zeit einsparen zu können, und der zunehmenden und lauter werdenden Klage darüber, dass wir Menschen in modernen Gesellschaften immer weniger Zeit haben, veranlasste den österreichischen Philosophen Peter Heintel im Jahr 1990 dazu, einen Verein zu gründen, der einen ebenso schrägen wie Verwunderung hervorrufenden Namen trägt: Verein zur Verzögerung der Zeit. Darüber, was Zeit eigentlich genau ist, lässt sich unendlich lange ohne befriedigendes Ergebnis nachdenken. Und dieses anscheinend unbeschreibliche Etwas dann noch verzögern zu wollen, kann doch nur die Idee von Verrückten sein! In irgendeiner Weise gestört war Peter Heintels Geist nicht. Davon habe ich mich persönlich und oft überzeugt. Ganz im Gegenteil hat er den überwiegenden Teil seines Lebens mit Denken verbracht und dabei wirklich Erhellendes herausgefunden. Die bei außergewöhnlichen Persönlichkeiten häufiger anzutreffende Paarung von tiefer Klugheit und leichtem Humor war sicherlich dafür verantwortlich, seinem Verein diesen besonderen Namen zu geben. Seit nunmehr fast dreißig Jahren tauschen sich Mitglieder des Vereins zur Verzögerung der Zeit darüber aus, was ein gutes Lebenstempo sein könnte, verstören mit verdrehten Aktionen die überdrehte Geschäftigkeit und suchen nach den Gründen für die offensichtlich nicht zu stoppende Beschleunigung.
Die vielleicht scharfsinnigste Erklärung dieses Widersinns hat der Soziologe Hartmut Rosa gefunden. Seine These ist im Grunde ganz einfach. Zeit gewinnen würden wir beim Einsatz von Technik bloß dann, wenn wir lediglich genauso viel tun würden wie vorher – nur eben schneller. Wir machen aber genau das Gegenteil: immer mehr. Mehr konsumieren, mehr und weitere Strecken zurücklegen, mehr kommunizieren. Mit jeder neuen Technik, die uns etwas schneller oder bequemer zu erledigen ermöglicht, stopfen wir unser ohnehin schon gedrängtes Leben noch voller. »Bloß nichts versäumen!«, lautet das fast religiös anmutende Bekenntnis unseres Zeitalters. Alles, was geht, wird gemacht. Hemmungslos und ohne die Frage nach dem Ziel oder Sinn zu stellen, stecken wir die Grenzen immer weiter ab. In der Erwartung, unser Leben besser zu machen, packen wir immer mehr in es hinein, ohne uns die Zeit zu nehmen, das Erlebte auch zu verdauen. Die Metapher einer verdauungslosen Gesellschaft kommt mir regelmäßig und zwangsläufig in den Sinn, wenn ich Menschen sehe, die ihr Essen fotografieren, um die Bilder auf irgendwelchen Internetplattformen zu veröffentlichen. Anstatt sich an einem guten Essen zu erfreuen und es genüsslich in Erfahrungen zu verstoffwechseln, halten sie es erst einmal technisch fest und zeigen der Welt, wie gefüllt ihr Leben doch ist. Ob die Welt das überhaupt wissen will oder nicht, ist Nebensache. Es geht lediglich um die Veräußerlichung von etwas, das eigentlich verinnerlicht gehört. Beim Essen ist das Verdauungs-Gleichnis offensichtlich. Es lässt sich meiner Wahrnehmung und Einschätzung nach aber auch auf diverse andere Lebensbereiche und Dinge übertragen: Reisen, Autos, Schmuck, technisches Gerät, beruflichen Erfolg, sogenannte Selfies und – spätestens da wird es widerwärtig – die eigenen Kinder, deren Prächtigkeit in alle Welt hinausposaunt wird.
Doch bevor ich mich zu sehr aufrege, was bekanntlich viel Energie kostet und deshalb in einem Buch über Faulheit fehl am Platz wäre, komme ich auf die sachliche Ebene der Zahlen, die völlig nüchtern belegen, dass wir mit jeder neuen Technik mehr Zeit binden, als freizusetzen theoretisch möglich wäre. Der Bequemlichkeit halber nehme ich aus den unendlichen Beispielen dafür drei heraus, an denen sich das ganze Dilemma mühelos erkennen lässt.
Als Johann Wolfgang von Goethe sich am 3. September 1786 um drei Uhr in der Frühe von Karlsbad nach Italien aufmachte, lag ein weiter Weg vor ihm. Allein für die ersten 140 Kilometer über Zwota, Eger und Tirschenreuth nach Weiden brauchte er seinen Tagebucheinträgen zufolge 18 Stunden. Bis zum Brenner waren es sechs Tage in der Postkutsche. Auf der zweiten Etappe nach Verona, für die er fünf Tage benötigte, schrieb er: »Die Postillons fuhren, daß einem Sehen und Hören verging, und so leid es mir tat, diese herrlichen Gegenden mit der entsetzlichsten Schnelle und bei Nacht wie im Fluge zu durchreisen, so freuete es mich doch innerlich, daß ein günstiger Wind hinter mir herblies und mich meinen Wünschen zujagte.« Wenn heute jemand für 700 Kilometer elf Tage bräuchte, würde dieser Mensch dann von einer »entsetzlichen Schnelle« sprechen? Mit dem Auto schaffen wir so eine Strecke heute in gerade einmal acht bis neun Stunden. Ein ICE benötigt für die noch etwas längere Tour von Hamburg nach München nicht einmal sechs Stunden. Und der Flieger ist sogar nur eine gute Stunde in der Luft, um diese Strecke zurückzulegen. Der technische Fortschritt macht es möglich. Goethes Italienreise über Rom und Neapel nach Sizilien und wieder zurück über Rom nach Mailand dauerte bis zum Mai 1788, also gute eindreiviertel Jahre. In dieser Zeit reiste er – grob überschlagen – einen Weg von rund 4000 Kilometern Länge. Versuchen Sie heute einmal, einen zwei Jahre alten Gebrauchtwagen mit so einem Kilometerstand zu finden! Viel Spaß dabei! Wir Deutschen legen jede und jeder pro Jahr etwa 15 000 Kilometer zurück – im Durchschnitt. Goethe gehörte zu den besonders reisefreudigen Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts. Kilometerfresser in heutigen Zeiten bringen es in einem Jahr allein mit dem Auto auf eine Strecke, die länger ist als der Äquator.
Haben Sie ein Auto mit Bordcomputer? Dann schauen Sie doch spaßeshalber einmal nach, wie viele Stunden Sie in Ihrem Fahrzeug verbringen. Anschließend stellen Sie sich die Frage, ob Ihnen das Automobil Zeit spart oder ob Sie es einfach wahnsinnig oft und lange benutzen. Oder vergleichen Sie die Zahl Ihrer automobilen Stunden mit der, die Sie einfach – auf einer Bank oder am Strand sitzend – in den Himmel geguckt haben. Vielleicht finden Sie im nächsten Stau eine ruhige Minute dafür, sich das einmal bewusst zu machen. Dann wird Ihnen aus ganz eigener Erfahrung klar, dass unser Umgang mit dem technischen Fortschritt unsere Zeit beansprucht, anstatt sie freizuschaufeln.
Noch deutlicher wird es beim zweiten Beispiel, der Kommunikation. Ich gehöre zu der aussterbenden Art, die Briefe noch gern mit der Hand schreibt. Irgendwie finde ich es besonders sinnlich, wenn ein in meinem Kopf fertig formulierter Satz sich im Fluss der Tinte auf schönem Papier verewigt. Schon der Bewegungsablauf ist ganz anders als das Dauerstakkato des Tippens auf einer Tastatur. Die runden Schwünge der Füllfeder machen keinen Lärm, sondern singen eine unhörbare liebliche Melodie. Keine Löschtaste, kein Kopieren und an anderer Stelle wieder Einfügen verleiten dazu, ungereifte Gedanken vorschnell in die Welt zu setzen. Nicht zuletzt gibt mir das herkömmliche Schreiben das Gefühl, mich der digitalen Belanglosigkeit zu entziehen. Sehr persönliche Botschaften verdienen meiner Ansicht nach diese würdige Form. Selbst bei identischem Inhalt entfaltet ein handschriftlicher Brief eine viel ergreifendere Wirkung als eine am Bildschirm aufploppende E-Mail.
Ein herkömmlicher Brief benötigt auch mehr Zeit, bis er beim Empfänger ankommt. Er will sorgfältig gefaltet und in den Umschlag gesteckt werden, braucht eine Briefmarke, die womöglich noch persönlich angeleckt werden muss, um haften zu bleiben, und geht dann auf seiner langen Reise vom Briefkasten über diverse Poststellen durch viele Hände und auch Maschinen, bis er dem Empfänger zugestellt und von ihm womöglich mit einem Brieföffner behutsam geöffnet und endlich gelesen wird. Wie wunderbar sich so ein Briefwechsel verzögern kann, habe ich im vergangenen Jahr erlebt. Ich war im Urlaub auf Sardinien und erfreute mich an den Gedanken an besonders gute Freunde, die ich lange nicht mehr gesehen hatte. Einem von ihnen schrieb ich einen Brief – in der oben ausgeführten Art. Der Brief war etwa eine knappe Flasche Rotwein lang und entsprechend emotional. Am nächsten Tag kaufte ich eine Briefmarke und brachte mein Freundesschreiben auf seinen Weg nach London. Monat um Monat verging, und ich hörte nichts vom Empfänger. Umso größer war bei meinem nächsten Urlaub auf der Insel die Überraschung, als mich mein dortiger Nachbar ansprach und in sein Haus bat. Er öffnete seine Schreibtischschublade und holte ein sichtlich mitgenommenes Kuvert hervor. Er hätte es erst vor Kurzem aus einem Briefkasten gefischt, in den er nur sehr selten hineinschaue. Auf das Adressfeld habe er gar nicht geachtet, sondern den inzwischen von Feuchtigkeit und anderer Witterung nicht mehr taufrisch anmutenden Umschlag geöffnet, um dann zu bemerken, dass der Text in deutscher Sprache verfasst war und in der Anrede nicht sein, sondern mein Vorname stand. Diese Unaufmerksamkeit möge ich ihm verzeihen, es sei ihm ausgesprochen peinlich. Als er die Freude in meinem Gesicht sah, nachdem ich den Absender entziffert und das Schreiben an mich genommenen hatte, entspannte sich der Nachbar und regte an, dass wir uns doch später auf ein Gläschen Wein treffen sollten. Was für eine gute Idee! In meinem Apartment angekommen, setzte ich mich gemütlich auf den Balkon und nahm mir viel Zeit, die ebenfalls handgeschriebenen Worte meines Freundes zu lesen. Es war wie Weihnachten im Frühjahr. Die über sechsmonatige Verzögerung der Ankunft dieses Briefes hat meine Freude über die Lektüre dermaßen gehoben, dass das gute Stück inzwischen in meiner privaten Schatzkiste liegt und ich von Zeit zu Zeit die Blätter wieder heraushole und lese, um mir etwas Gutes zu tun. Ich werde meinem Freund bald zurückschreiben und hoffe, dass meine Antwort auch irgendwo stecken bleibt, bevor er sie erhält.
Wie anders läuft es bei der elektronischen Post. Da wundern wir uns schon, wenn unsere Botschaften oder Anliegen nicht binnen weniger Stunden erwidert werden, obwohl wir doch viel mehr davon verfassen und erhalten als handgeschriebene Briefe. Zählen Sie einmal, wie viele E-Mails, SMS, WhatsApp-Nachrichten und sonstige Posts Sie allein in den letzten sieben Tagen geschrieben und bekommen haben! Wenn ich meinen Rechner angeschaltet habe und das E-Mail-Programm offen ist, signalisiert ein »Pling« fast im Minutentakt, dass etwas Neues eingetroffen ist – von ernsthaften Anfragen über blind kopierte Verteilernachrichten bis zu stumpfsinnigen Massenwerbesendungen und dreisten Versuchen, mich in krimineller Weise um die Herausgabe von Geld oder persönlichen Daten zu bewegen. Wenn ich um mich herum höre, wie oft diverse Smartphones den Eingang von SMS oder WhatsApp-Nachrichten ankündigen, wird mir bewusst, weshalb ich es mit Elias Canetti halte: »Wenn das Telefon nicht klingelt, ist es für mich.« Es gibt garantiert Statistiken, die aufzeigen, wie oft und wie viele Male unser Leben von eingehender Digitalpost unterbrochen wird. Um mir nicht den gleich bevorstehenden Feierabend zu versauen, will ich diese Zahl lieber gar nicht wissen. Es reicht mir festzustellen, dass diese neue Technik unwiderlegbar dazu geführt hat, dass wir mit ihrer Nutzung nicht Zeit gewinnen, sondern verlieren. Viel Zeit. »Man kann nicht nicht kommunizieren«, sagte der Philosoph und Psychotherapeut Paul Watzlawick einmal. Dieser schöne Satz bekommt im Zeitalter der Digitalisierung eine von seinem Urheber bestimmt nicht so gedachte neue Bedeutung. Bei den vielen Mails, Posts und Messages mag die pausenlose Berieselung vielleicht noch unbeabsichtigt sein oder damit zusammenhängen, dass wir den Umgang mit dieser Technik noch nicht lange genug hinterfragt und kultiviert haben. Bei den Medien ist es dahingegen vielfach Programm. Der Geschäftsführer eines privaten Radiosenders hat das einmal beeindruckend offen dargelegt. Danach gefragt, was er denn als die wesentliche Aufgabe seiner Firma betrachte, antwortete er: »Wir zerstreuen Zeit.« Ich vermute, dass Geschäftsmodelle, die auf dem Unbehagen oder gar der Unfähigkeit des gehetzten Individuums, einfach einmal nichts zu tun, aufbauen, auch weiterhin hervorragende Erfolgsaussichten haben. Dank YouTube und Konsorten braucht man heute noch nicht einmal mehr einen eigenen Verlag und aufwendige Technik, um mit aberwitzigen Banalitäten oder unverschämten Dummheiten ein Millionenpublikum vom echten Leben abzulenken.
Mein drittes Beispiel ist die immer effizientere Herstellung von Dingen. Mit abnehmendem Einsatz menschlicher und zunehmendem Anteil maschineller Arbeit werden immer mehr Produkte immer schneller hergestellt. Mit der hergestellten Menge werden sie auch billiger. Und weil wir uns billige Sachen leisten können, kaufen wir sie. Vielen von uns fällt die Sache mit dem wachsenden Konsum kaum noch auf, weil es schon normal geworden ist, immer mehr Zeug zu erwerben und zu horten. Kleidung ist teilweise so billig geworden, dass sich das Waschen zumindest aus geldlicher Sicht kaum noch lohnt. Möbel werden nicht mehr für Generationen getischlert, sondern in für unsere Ahnen unvorstellbar kurzen Zeiträumen durch neue ausgetauscht. Ein europäischer Haushalt soll im Durchschnitt sage und schreibe zehntausend Dinge beherbergen. Wie viele wir davon wirklich brauchen und wie viele davon unser Leben besser machen, fragen wir uns erst gar nicht. Als wir 2015 zwei Geflüchtete in unser Haus aufnahmen, passte ihr Hab und Gut problemlos in zwei Plastiktüten. Mehr konnten sie auf ihrer Flucht aus ihrem von Krieg und Unrecht geplagten Heimatland nicht mitnehmen. Seitdem komme ich mir mit meinem vielen Zeug manchmal vor, als lebte ich auf einer Müllhalde, die ich im Winter sogar noch beheizen muss. Allein wie viel Platz mein gesamter Kram in Anspruch nimmt, den ich im Laufe meines Lebens erworben habe, ist aus dieser Perspektive wahnsinnig. Die regelmäßige Entsorgung des Überflusses und das inzwischen von mir gepflegte Ritual, einmal sehnlich Gewünschtes bewusst nicht zu erwerben, ruft immer wieder ein herrliches Gefühl der Befreiung in mir hervor. Das Wort »Entsorgen« trifft den Vorgang, der sich dann in meinem Gemüt abspielt, auf den Punkt: Mit jedem verkauften, verschenkten oder beseitigten Ding verschwindet auch die Sorge darum – im Kopf genauso wie im Haus. Die mit der Entsorgung verbundene Mühe, so meine Erfahrung, lohnt sich schon deshalb, weil ich mich um etwas, was ich nicht habe, eben auch nicht kümmern muss. Der Nicht-Besitz ist in dreifacher Hinsicht nachhaltig. Er macht den Kopf langfristig frei, führt durch den geringeren Bedarf an Geld für die Anschaffung zu weniger Notwendigkeit, dieses durch Erwerbsarbeit zu verdienen, und ist die wohl müheloseste Art, die natürlichen Rohstoffe unserer Erde nicht in einer für sie ungesunden Weise und Geschwindigkeit zu verprassen.
Immer wieder gern erinnere ich mich an einen Vortrag von Harald Welzer, den ich in Hamburg hören durfte. Der Soziologe präsentierte einen von ihm erdachten utopischen Dialog eines großen Onlinehändlers mit einem Kunden. Der Kunde, der eigentlich eine Bohrmaschine kaufen wollte, wurde zuerst davon überzeugt, dass es viel praktischer und günstiger sei, sich das Gerät für die kurze Zeit der Nutzung auszuleihen. Anschließend erhielt er noch folgende Empfehlung: »Kunden, die diese Bohrmaschine nicht gekauft haben, haben auch folgende Produkte nicht gekauft …« Es folgte eine illustre Reihe an Geräten von Rasenmähern über Motorsägen bis zu Automobilen. Dass das Teilen von Dingen – neben den Vorteilen eines geringeren persönlichen Bedarfs an Geld und eines geringeren Verbrauchs von natürlichen Rohstoffen – auch dazu führen kann, dass man seine nachbarschaftlichen Beziehungen pflegt und gemeinsam eine gute Zeit verbringt, ist ein das Leben bereichernder, sehr angenehmer Nebeneffekt.
Schon an diesen wenigen Beispielen zeigt sich der einstweilen komische, bei näherer Betrachtung aber durchaus als tragisch zu bezeichnende Widerspruch von unseren Möglichkeiten und unserer Kultur. Technisch wären wir in der Lage, ein glückliches, freies Leben zu führen. Statt uns aber damit zu begnügen, jagen wir wie berauscht jeder sich neu auftuenden Option hinterher, um möglichst viel herauszuholen. Würde ein Außerirdischer einen Erdling beobachten, der mit seiner Bohrmaschine wie von Sinnen die Wände seines Hauses durchlöchert, würde er sich womöglich zuerst die Frage stellen, wer in diesem Szenario Gerät und wer Bediener ist. Bei der Beobachtung seiner Mitreisenden bei einer völlig normalen Fahrt einer U-Bahn ist diese Frage alles andere als abwegig, scheinen die Menschen doch ihren Smartphones absolut zu gehorchen. Der antike chinesische Philosoph Laotse wusste: »Nichtstun ist besser als mit viel Mühe nichts schaffen.« Uns modernen Menschen ist diese Weisheit augenscheinlich abhandengekommen. Eventuell ist es ja auch so, wie der französische Moralist François de La Rochefoucauld es schon im 17. Jahrhundert ausgedrückt hat: »Zu viel Fleiß im Kleinen macht unfähig zum Großen.«
Meine Waschmaschine möchte ich deshalb im Haus nicht missen. Aber irgendjemand könnte mal ein Modell erfinden, das Socken nicht nur paarweise entgegennimmt, sondern auch wieder paarweise herausgibt.