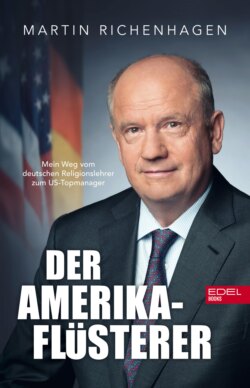Читать книгу Der Amerika-Flüsterer - Martin Richenhagen - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die USA sind keine One-Man-Show
ОглавлениеObama und Trump haben Amerika nicht gutgetan. Der eine hat das Volk erst verzaubert, dann desillusioniert. Und der andere führte seine folgenschwere Inkompetenz nicht nur auf der Weltbühne vor, sondern auch im privaten Kreis.
Die Chancen standen fifty-fifty, und ich hatte Glück. Barack Obama kam von links. Ich war goldrichtig postiert. Der Präsident streckte mir die Hand entgegen, so begegnete ich ihm zum ersten Mal.
Obama hat einen sehr sympathischen Händedruck, trocken und warm. Er guckt einem in die Augen. Ich stellte mich vor, Chef von AGCO und so weiter, und spulte mein einstudiertes Thema ab: unfaire Steuern auf Auslandsgewinne von US-Unternehmen. Obama hörte zu. Man konnte merken, dass es nicht neu für ihn war. Und es interessierte ihn nicht so besonders, muss ich zugeben. Immerhin wurde ich alles los, was ich mir vorgenommen hatte.
Es war der 13. Februar 2009, ein Freitag. Der einflussreiche Business Council, ein Club von Hochkarätern der US-Wirtschaft, durfte im Weißen Haus zum Schaulaufen beim neuen Präsidenten antreten. Der Council ist ein exklusiver Kreis: Die Mitgliedschaft ihrer Chefs kostet die Unternehmen ein Heidengeld, sie ist streng auf 200 Personen limitiert. Ich war 2008 gefragt worden, ob ich dabei sein wollte. Da war ich vier Jahre lang CEO der AGCO Corporation, des drittgrößten Landtechnikkonzerns der Welt. Damit war ich drin im Inner Circle der mächtigen US-Geschäftslobby.
Wer bei einem solchen Termin im Weißen Haus Überraschungen erwartet, liegt falsch. Der Ablauf ist fast standardisiert: Vorne steht eine Bühne. Und der Auftritt läuft im Prinzip nicht anders als bei einem routinierten Entertainer oder Komiker. Der Präsident kommt auf der einen Seite rein und hält seine Rede. Danach gibt es ein paar offizielle Fragen und Antworten, dann geht er wieder raus. Aber manchmal kommt er noch einmal zurück, für informelle Gespräche. Zwei Türen führen zum Raum hinter der Bühne. Niemand weiß, durch welche der Präsident aus dem Backstagebereich auftauchen wird. Und ob er überhaupt eine Zugabe gibt.
Wir waren in den East Room geladen worden, den repräsentativen Raum im Ostflügel des Weißen Hauses. Die eine Seite des Saales war mit roten Samtbändern abgesperrt, wie im Hotel oder bei einem VIP-Bereich. Dort hatten sich die Fotografen in Position gebracht. Ich ging zu einem hin und sagte: „Falls der Präsident mit mir redet, dann wäre es toll, wenn Sie ein Foto machen würden.“ Dieses Mal wollte ich gewappnet sein – anders als bei George Bush. Da war ich schon öfter mal gefragt worden – in Amerika, aber auch in Deutschland: „Kennen Sie eigentlich den Präsidenten?“ Und wenn ich sagte: „Ja, den Herrn Bush habe ich schon ein paarmal getroffen“, dann kam oft die Frage: „Haben Sie nicht mal ein Foto?“ Hatte ich anfangs aber leider nicht. Bei Obama wollte ich es gleich besser machen. Die Fotografen lachten und sagten: „Das wird nicht passieren.“ Abwarten, dachte ich.
Wenn wir mit dem Business Council eine Chance sahen, den Präsidenten zu treffen, gingen wir taktisch vor: Wir diskutierten die wichtigen Fragen, die wir gerne zur Sprache bringen wollten. Und dann wurde das Pensum so verteilt, dass mehrere Leute dasselbe Thema hatten. Simple Mathematik: Wir wollten die Chance erhöhen, mit unseren Anliegen Gehör zu finden. Für mich war vorgesehen, die „repatriation of foreign earnings“ anzusprechen. Ein sehr wichtiges Thema. Denn für US-Unternehmen war es damals schwierig, ihre im Ausland gemachten und dort versteuerten Gewinne nach Hause zu holen. Weil dort noch einmal der volle US-Steuersatz fällig wurde. Also parkten die Unternehmen notgedrungen das Geld lieber weiter im Ausland, anstatt es in Amerika zu investieren – was am Ende natürlich die US-Wirtschaft bremste.
Normalerweise halte ich mich bei solchen Veranstaltungen lieber weiter hinten auf. Diesmal sagte ich aber zu zwei CEO-Kollegen, mit denen ich mich unterhalten hatte: „Wir gehen da jetzt mal hin. Vielleicht ergibt sich ja eine Chance.“ Wir stellten uns also links in die Ecke, gleich neben die Bühne. Und als Obama tatsächlich dort rauskam, lief er als Erstes direkt auf mich zu und streckte mir die Hand entgegen. Blitzlichter, die Apparate klickten.
Eigentlich hätten alle im Council in diesem Moment zufrieden sein müssen, dass ich unser Thema anbringen konnte. Aber so einfach ist die Geschäftswelt natürlich nicht. In der Mitte des Raums stand Bob Lane, der damalige CEO von John Deere, einem der großen AGCO-Konkurrenten, und er wurde unruhig. Lane rief quer durch den Saal: „Mister President, there is also John Deere in the United States of America.“ Da fing Obama an zu grinsen und sagte zu mir: „Die Wettbewerber werden schon nervös. Da müssen wir wohl den Handshake noch ein bisschen verlängern.“ Das fand ich sehr lustig. Dann ging Obama weiter, und drei, vier Handschläge später kam erneut einer aus dem Council mit demselben Thema wie ich. Obama kapierte schnell, wie unsere Vorbereitung gelaufen war. Er drehte sich zu mir um und kniff ein Auge zu, so nach dem Motto: „Ihr seid mir schon ein paar Schlitzohren.“ Immerhin: Mein Foto hatte ich.
Gelöst wurde das Steuerproblem erst von Obamas Nachfolger. Von Donald Trump. Mit seiner Steuerreform hat er dafür gesorgt, dass Hunderte Milliarden Dollar an Firmengewinnen aus dem Ausland zurück in die USA flossen und die Wirtschaft ankurbelten. Es ist vielleicht die einzige gute Sache, die er hinbekommen hat.
Ich muss zugeben: Als Donald Trump Präsident wurde, war ich nicht traurig. Im Gegenteil. Barack Obama hatte die USA zwar in eine Aufbruchsstimmung versetzt. „Yes We Can“, das klang gut und nahm die Leute mit. Aber am Ende ist wenig herumgekommen. Obama trieb die Staatsverschuldung in die Höhe. Seine Gesundheitsreform war gut gemeint, aber schlecht gemacht und für die Leute frustrierend, weil es vor allem teurer wurde. Zudem schien er sich nicht wirklich für die Wirtschaft zu interessieren. Das Land war nach acht Jahren Obama erschöpft und zerstritten. Washington und der aufgeblähte Regierungsapparat, das wurde für viele zum Feindbild.
Donald Trump hat das konsequent genutzt. „Alles Mist, nur Idioten in Washington“, das war sein Tenor – und damit hat er viele Leute erreicht und überzeugt. In einem Interview direkt nach Trumps Wahl 2016 habe ich gesagt: „Das Einzige, was von Obama übrig bleiben wird, ist die Tatsache, dass er der erste schwarze Präsident war.“ Nach vier Jahren Trump sehe ich das anders. Obama war kein besonders toller Präsident, aber auch nicht der schlechteste, den die USA je hatten. Obama war als Präsident sympathisch, er war menschlich. Heute sieht man deutlich, wie wichtig das ist. Ein Stück weit hat Obama seine hohe Popularität vielleicht auch dem Stil seines Nachfolgers zu verdanken, dem jeder Anstand und jede Verlässlichkeit fehlen.
Es hat mich nicht einmal überrascht, dass Donald Trump 2016 die Wahl gegen Hillary Clinton gewann. In deutschen Talkshows war ich regelmäßig belächelt worden, wenn ich in den Wochen zuvor ein enges Rennen prognostiziert hatte. Genauso, wenn ich sagte, wie unbeliebt Clinton in großen Teilen der amerikanischen Gesellschaft war. Aber für viele Wähler hieß das Motto: „ABC – anything but Clinton.“ Also: Alles ist besser als Clinton. Auch ich war von Hillary Clinton nie überzeugt. Für meinen Geschmack kam sie zu emotional und ideologisch rüber. Was viele in Deutschland nicht wahrhaben wollten: Die Ablehnung gegenüber Hillary Clinton war überdurchschnittlich stark ausgeprägt bei Frauen, bei Schwarzen und bei jungen Leuten. Obwohl man doch dachte, dass vor allem sie gegen Trump sein müssten. Aber tatsächlich waren sie vor allem gegen das politische Establishment, für das Clinton stand. Gegen einen Club von Politikern und Bürokraten, die in ihrer Blase in Washington den Kurs des Landes bestimmten, ohne sich groß darum zu kümmern, wie es den Menschen insgesamt ging und was sie wollten. Dass man Trump hier das Feld nahezu kampflos überließ, spricht für die damalige Borniertheit von Hillary Clinton und ihrer Entourage.
Der Blick aus Deutschland auf Amerika ist ja ebenfalls oft reduziert auf die Ost- und die Westküste, gerade auf die liberalen Eliten in New York und Washington oder auch in Los Angeles und San Francisco mit dem Silicon Valley. Es wird oft ausgeblendet, dass in den Tausenden Kilometern dazwischen die Republikaner ihre Stammwähler haben. Wenn man nach der Wahl 2020 auf die Karte blickt: Die Landesmitte ist „Trump Country“, alles rot, die Farbe der Republikaner. Die Evangelikalen, die Landbevölkerung und weiße Industriearbeiter sind sichere Bänke für Trump. Er konnte trotz der Wahlniederlage seine Unterstützerbasis sogar um mehrere Millionen Stimmen vergrößern. Joe Biden regiert ein tief gespaltenes Land.
Viele wundern sich, dass es jemand wie Trump mit all seinen Falschaussagen, Tiraden und spontan-erratischen Entscheidungen geschafft hat, vier Jahre lang an der Spitze zu bleiben. Ausgerechnet im Land der Political Correctness schafft es jemand, der dermaßen politisch unkorrekt ist und sich wie ein Politclown aufführt, nach vier Jahren der Misswirtschaft beinahe, sein Mandat für eine zweite Amtszeit zu verteidigen. Was aus meiner Sicht seine erstaunliche Akzeptanz vor allem erklärt, ist die Tatsache, dass Trump eine Zielgruppe für sich entdeckt hat, die seine Vorgänger vernachlässigt hatten: Er war der Präsident der Abgehängten. Das ist die Hardcorebasis, die ihn auch im jüngsten Wahlkampf weiter unterstützt hat. Es gibt eine Menge Amerikaner, die abgehängt worden sind. Die meisten leben auf dem Land, haben niedrige Einkommen, sind vielleicht arbeitslos. Zumindest rhetorisch hat sich Trump um sie besonders gekümmert, er spricht ihre Sprache. Mit seinem Slogan „Make America Great Again“ gab er ihnen eine Vision, die sie auf sich bezogen in Hoffnung ummünzen konnten.
Auch ich habe 2016 gesagt: „Der Trump hat eine Chance verdient.“ Ich meinte das genau so und war positiv gespannt. Wenn eine Demokratie wählt, muss der Kandidat die Möglichkeit haben zu beweisen, was in ihm steckt. Sehr schnell wurde allerdings klar: nicht viel. Seine Persönlichkeit war bekannt, aber ich hoffte, dass Politik und Privatleben zwei getrennte Welten sein konnten. Und dass Trump politisch vielleicht doch etwas bewegen würde – gerade für die von Obama vernachlässigte Wirtschaft.
Im Business Council wuchsen unsere Hoffnungen, als Trump mit Rex Tillerson 2017 einen Mann der Wirtschaft ins Amt des Außenministers hob. Der war ja lange Jahre Chef des Konzerns ExxonMobil gewesen – er brachte nicht nur fundierte Kenntnisse mit, sondern auch Integrität. Doch schon nach kurzer Zeit wurde klar: Trump untergräbt Tillersons Autorität mit Tweets, die sich direkt gegen ihn richten, gegen seinen eigenen Minister. Auch den Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen von Paris zog Trump im Alleingang durch, gegen Tillersons Willen. Das konnte nicht lange gut gehen. Trumps Volatilität war ja für alle in seinem Umfeld ein Riesenproblem: Man wusste nie, was ihm in der Nacht einfiel. Oft kam er morgens mit irgendeiner furchtbaren Idee aus dem Bett, die er dann sofort umsetzen wollte. Für Unternehmen war es äußerst schwierig, sich operativ auf ihn einzustellen.
Gerade zu Anfang der Amtszeit haben wir versucht, Trump in Kamingesprächen mit dem Business Council für ein paar Dinge zu sensibilisieren. Wir CEOs dachten, dass zumindest wir doch versuchen müssen, ein paar Leitplanken für diesen Mann zu setzen und das Thema Freihandel zu bedienen. Doch es war zwecklos, da funktionierte auch auf dieser inoffiziellen Ebene überhaupt nichts. Man gewann sogar mitunter den Eindruck: Trump hört nicht einmal zu, wenn man ihn direkt anspricht. Das merkte man an seinen Reaktionen. Er redet eben lieber selbst. Und dabei gilt: Trump hat im kleinen Kreis genauso wenig Tiefgang wie auf einer großen Bühne. Immerhin könnte man ihn also authentisch nennen. Ich hatte einmal die Möglichkeit, mit seiner Tochter Ivanka darüber zu sprechen. Mein Eindruck nach dem Gespräch war, dass auch die Familie Trump ihm gegenüber nicht ganz unkritisch ist. Aber das scheint Herrn Trump nicht zu stören.
Wie schlecht er regierte, bewies Trump vor allem mit seinem Handelskrieg. So etwas sei für ihn ja schnell zu gewinnen, tönte er. Völliger Blödsinn. Nachdem er China mit Sanktionen überzogen hatte, reagierten die Chinesen blitzschnell. Zur Überraschung Trumps und vieler Amerikaner sprachen sie Gegensanktionen aus. Was eigentlich nicht so schwer zu erraten gewesen wäre. Sofort galt: Wir Chinesen kaufen keinen Mais, keine Sojabohnen, kein Hühnchen- und kein Schweinefleisch mehr in den USA. Mit anderen Worten: Die bis dahin treuesten Kunden der amerikanischen Bauern waren von heute auf morgen verschwunden. In einem Volumen von 45 bis 50 Milliarden US-Dollar fiel die Nachfrage schlagartig aus. Ein kluger Schachspieler macht ja einen Zug und kalkuliert die möglichen Reaktionen des Gegenspielers ein, um dann noch einmal zu reagieren. Trump hat das in völliger Selbstüberschätzung natürlich nicht getan.
Dieser blinde Schlagabtausch über Zölle und Importverbote hat den Landwirten, unseren Kunden bei AGCO, richtig wehgetan. Dabei waren es ja zum großen Teil seine Wähler. Trump konnte das nur reparieren, indem er massive Subventionspflaster auf die Wunden klebte. So hat er es tatsächlich geschafft, viele Landwirte weiterhin hinter sich zu versammeln: Er hat ihnen die unsinnige Story vom Feind in China erzählt und ihnen weisgemacht, man müsse das mit den Strafzöllen so durchziehen. Unser Geschäft hat darunter dramatisch gelitten. Wir hatten Einbußen von 20 bis 30 Prozent, denn die betroffenen Landwirte hielten sich mit Investitionen in Landmaschinen zurück. Auch die steigenden Stahlpreise machten uns zu schaffen. Erst mit den Subventionen wurde es wieder besser, auch für uns.
Heute steht fest: Donald Trump war ein denkbar schlechter Präsident, es ging ihm immer nur um sich selbst. Er hat Politik genauso gemacht wie zuvor jahrelang in seinem Trash-TV-Format The Apprentice, über das er Bekanntheit in den Wohnzimmern des Landes gewonnen hatte. Also: unterhaltsam zwar, aber mit fragwürdigen Inhalten. „You’re fired“, der von Trump kultivierte Rauswurf, wurde in den USA zum geflügelten Wort. Empathie konnte man von so jemandem nicht erwarten. Trump hat die Spaltung des Landes, die bereits unter Obama begann, so rasch und so stark vorangetrieben, wie ich es mir kurz nach der Wahl nicht hatte vorstellen können. Er ist ein unsympathischer Typ, ein Rassist, ein schmieriger Womanizer. Einer, der andere immer nur über den Tisch ziehen will. Er war auch aus meiner Sicht nie ein Unternehmer, sondern nur ein gewiefter Immobilienspekulant. „Streetwise“ nennen das die Amerikaner. Er ist kein Mann der Wirtschaft, er begreift auch keine wirtschaftlichen Zusammenhänge. Als Politiker war er ebenfalls nur an Deals interessiert, die vor allem ihm selbst nützen. Sein Land stand hinten an – trotz der anderslautenden Floskel „America first“. „Trump first“ war es in Wahrheit.
Obama war anders. Was mir bei aller Kritik an seiner Wirtschaftskompetenz gefallen hat: Er wollte seine Präsidentschaft damit krönen, das TTIP noch unter Dach und Fach zu bringen, das Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union. Das Vertragswerk hätte die auch zu Obamas Zeiten schon bröckelnde transatlantische Allianz wirklich stärken können. Es war ein Anliegen, für das ich mich auch als Chairman der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer sehr stark eingesetzt habe. Ich dachte, das müssen wir noch mit Obama hinkriegen. Denn ich ahnte schon: Wenn Trump kommt, wird das nicht mehr klappen. Ich sprach immer von diesem „window of opportunity“ – dem Fenster, das man nutzen muss, sobald es sich auftut.
Und das Fenster schien sich zu öffnen – nach langer Vorarbeit. Ende 2015 wurde ich angefunkt, aus dem Stab des Präsidenten kam das Signal: Obama sei bereit, zur Hannover Messe im April 2016 nach Deutschland zu kommen. Dort würde er Frau Merkel treffen und den Deal unterschreiben. Als Kammer haben wir den ersten Teil hingekriegt: Das Treffen stand. Aber leider ist doch nichts dabei rausgekommen. Frau Merkel hat sich nicht wirklich positioniert, weil sie wusste, dass das TTIP in Deutschland heftigen Gegenwind bekam. Auch viele mittelständische Unternehmen und Landwirte standen nicht dahinter. So machte die Angst vor dem Chlorhähnchen, dem Symbolbild der TTIP-Gegner, einem wirklich guten und wichtigen Projekt den Garaus. Aber selbst wenn bei den Verhandlungen etwas herausgekommen wäre, Trump hätte es wahrscheinlich sofort wieder zurückgedreht.
Auf Einladung von Obama wurde ich auch im President’s Advisory Council on Doing Business in Africa tätig. Das Beratergremium hatte er eingerichtet, um die Geschäftsbeziehungen zum afrikanischen Kontinent zu überdenken und zu verbessern. Als Trump das Präsidentenamt übernahm, blieb ich zunächst in dem Gremium – auch wenn sich schon andeutete, dass er den Afrikarat ganz eindimensional interpretierte: Wir waren für Trump nicht mehr als Steigbügelhalter für die Exportförderung. Ich erinnere mich, wie man uns nach Washington einlud, wo dann der neue Wirtschaftsminister, Wilbur Ross, vor versammelter Mannschaft lediglich einen Brief von Trump vorlas. Nach dem Motto: „Die amerikanische Wirtschaft hat in Afrika gegenüber den Chinesen an Boden verloren. Nun geht es darum, den verlorenen Marktanteil wiederzugewinnen.“ Ein tieferer Sinn war nicht mehr zu erkennen. Schließlich reichte es mir. Als Trump im März 2018 seinen kompetenten Außenminister Rex Tillerson, der ein guter Freund von mir ist, per Twitter feuerte, hatte ich endgültig genug. Trump bezeichnete ihn öffentlich als „dumb as rock“, was sich als „dumm wie Brot“ übersetzen lässt. Ich verließ den Council unter Protest.
Was das Erstaunliche bei den ganzen Dingen ist, die Trump so macht und erzählt: Dass über die Jahre nie mal einer von den Wirtschaftsbossen aufgestanden ist und gesagt hat: Das wollen wir nicht. Ich habe bei einem Treffen des Business Council 2017 den Vorschlag gemacht, einen offenen Brief zu formulieren. Mich störte gewaltig, wie Trump die Ausschreitungen in Charlottesville zum Anlass nahm, Rassisten und Rechtsextreme geradezu zu verteidigen. Wir hätten als CEOs den Präsidenten gemeinsam dazu auffordern sollen, sich korrekter zu benehmen. Respekt, Stil und solche Dinge mehr. Nachdem ich das gesagt hatte, war es in dem Raum mucksmäuschenstill. Das war noch recht am Anfang der Amtszeit von Trump. Anschließend kamen die Leute dann zu mir und sagten: „Very good point, Martin.“ Gute Sache. Und: „Ja, das müsste man machen.“ Passiert ist nichts.
Die amerikanischen Wirtschaftsführer – mit wenigen Ausnahmen wie Amazon-Chef Jeff Bezos – sind nach meinem Eindruck eine sehr homogene Gruppe: Es sind Republikaner, weiße Männer, konservativ. Und viele haben auch nach vier Jahren Amtszeit immer noch zu argumentieren versucht, dass Trump doch auch sehr viele Sachen sehr gut gemacht habe. Ich sehe das anders. Und glaube nicht, dass wir Manager dazu hätten schweigen dürfen. „Sag, was du denkst. Und tu, was du sagst“ – so lautet der Leitspruch, an dem ich mich immer orientiert habe. Ich habe mich auch im Ausland immer klar gegen Trump positioniert, in Deutschland, Frankreich oder auch Brasilien. Oft wurde ich gefragt, ob ich keine Angst habe, dass das für die Firma schädlich sein könnte. Das hat mir allerdings nie Sorgen bereitet – zumal sich Trump nur selten mit Kritik an ihm befasst hat. Er war wie Teflon.
Ich habe denselben Schneider wie Trump, Ali Ansari, einen Perser. Er war früher im diplomatischen Dienst, nun ist er Manager des Brioni-Ladens auf der Madison Avenue in New York. Ich sagte ihm schon: „Ali, kannst du den Trump denn nicht wenigstens mal beraten, was sein Outfit angeht?“ Nein, das gehe nicht, sagte er. Probiert habe er es ja schon. Als er ihm im Wahlkampf die Krawatte gerichtet und vor allem auf die richtige Länge gebunden habe, sei Trump schnell auf die Toilette verschwunden und habe den Schlips wieder verlängert. Wenn vom Schneider Maß genommen wird, korrigiere Trump die Zahlen, weil er nicht einsehen wolle, dass er etwas zugelegt hat. Trump ignoriert offenbar alles, was Fachleute sagen. Das fängt beim Anzugschneider an, geht weiter über Mediziner, deren Expertise er mit Ratschlägen wie zum Beispiel Domestos-Injektionen gegen Covid-19 kontert, bis hin zu seinen Sicherheitsberatern. Er ist weder gebildet noch halte ich ihn für intelligent. Er gehört nicht an die Spitze irgendeiner großen Firma und schon gar nicht irgendeines Landes.
Dass er es mit der Wahrheit nicht genau nimmt, zeigt das kleine, aber für ihn bedeutende Thema Golf: Ein Aufsichtsratsmitglied von AGCO ist Mitglied in einem Golfclub, der Trump gehört. Der berichtet, dass Trump beim Golfspielen bescheißt wie kaum ein anderer. Zwei Caddies begleiten ihn, einer geht mit ihm, der andere geht vor. Und der da vorne, der findet den Ball immer da, wo er am besten hinpasst. Egal wo Trump hingeschossen hat. Wie üblich hängen in diesem Golfclub die Bilder der Gewinner der Vereinsmeisterschaften im Clubhaus an der Wand. Mein Vertrauter berichtete, dass eines Tages dort in der Meistergalerie auch ein Bild von Herrn Trump hing, der aber zu der fraglichen Zeit weder Clubbesitzer noch Mitglied gewesen war. Er wollte wohl nur den Anschein erwecken, er sei Vereinsmeister gewesen. Der ist also ein unglaublicher Angeber.
Zur Wahl 2020 wurde ich in einem Interview gefragt: „Wenn Donald Trump ein Pferd wäre, was wäre er wohl für eine Rasse?“ Ich musste nicht lange nachdenken: „Ich glaube, ein Shetlandpony“, antwortete ich. Diese Ponys haben auch das Problem eines Scheinriesen, sie meinen viel größer zu sein, als sie in Wirklichkeit sind. „Und diese Mähne spricht eigentlich auch dafür. Ein kleines, freches Gerät, das schwer zu händeln ist.“ Also ich glaube, Trumps größtes Problem ist, dass er zu viel Hengst-Allüren hat. Im Reitsport wäre er schon längst Wallach geworden. Dann wäre Ruhe. Joe Biden wäre im Vergleich für mich ein gutmütiger Hannoveraner oder rheinischer Warmblüter, der gut funktioniert – aber schon an die natürliche Altersgrenze stößt.
Noch nicht richtig ausmachen kann man, ob Biden ein überzeugendes Programm hat. Sein Wahlkampf war im Wesentlichen beschränkt auf die Formel: Ich bin nicht Trump. Ironischerweise das gleiche Muster, mit dem Trump im Jahr 2016 Clinton besiegt hatte. Was bei Biden überzeugt, ist sein Auftreten. Er ist weniger aggressiv und gibt sich staatsmännisch. Das wird ein Vorteil sein, auch was die Verbesserung der diplomatischen Beziehungen in aller Welt angeht. Ich kann mir vorstellen, dass Biden auch mehr Kontinuität zeigt als Trump. Knappe Wahlergebnisse sind für die Amerikaner ja nichts Neues. Nun kommt es darauf an, dass sich dieses Land vom Wahlkampf erholt und dass sich der neue Präsident darum bemüht, die Amerikaner wieder zusammenzubringen. Ich denke, Biden wird das mit aller Ernsthaftigkeit und seiner Erfahrung auch versuchen. Doch ob es gut geht?
Viel hängt davon ab, dass der neue Präsident die Menschen, die sich zu Trump geflüchtet haben, mit seinen Werten wieder abholt. In Deutschland wird Biden auch daran gemessen werden, welches Interesse er daran zeigt, die zuletzt ramponierten transatlantischen Beziehungen wieder zu stärken. Ich bin überzeugt: Damit das gelingt, müssen sich auch die Europäer und insbesondere die Deutschen bewegen. Ich lebe und fühle mich unheimlich wohl in Atlanta, bin aber ebenso gern in Warendorf, Köln oder Berlin. Als Pendler zwischen den Welten, als Staatsbürger und Fan beider Nationen habe ich keinen Zweifel: Es wird sich lohnen, die transatlantische Brücke zu reparieren.