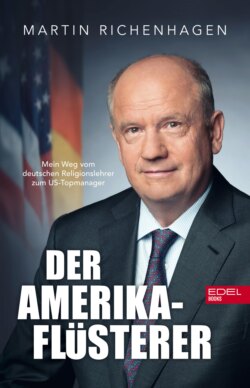Читать книгу Der Amerika-Flüsterer - Martin Richenhagen - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Schule der Bescheidenheit
ОглавлениеAufwachsen in der streng katholischen Bruder-Klaus-Siedlung in Köln-Mülheim. Statt Fernsehen gibt es Geigenunterricht im Reiheneckhaus. Das erste eigene Geld kommt mit Radkappensammeln und Hochzeitsmusik rein.
Die Bruder-Klaus-Siedlung in Köln-Mülheim, das war als Junge mein Revier. Ein Neubaugebiet im Niemandsland. Kurz vor Leverkusen, nach dem Krieg eilig hochgezogen, teilweise in Nachbarschaftshilfe. Auch wenn ich erst sieben Jahre nach Kriegsende zur Welt kam: Noch gut erinnere ich mich an das schwer getroffene Köln, ich sehe die vielen Trümmerbauten. Große Wohnungsnot überall. Die Bruder-Klaus-Siedlung war eine Idee von Konrad Adenauer, dem Oberbürgermeister, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass Köln wieder an Ort und Stelle aufgebaut wurde. Die Erzdiözese Köln plante die Bruder-Klaus-Siedlung für die Ausgebombten. Sogar ein Stück vom Nordturm des Kölner Doms wurde bei der Grundsteinlegung vergraben.
Die ganze Siedlung lag kurios eingefasst zwischen der Autobahn A 3 und einer viel befahrenen Eisenbahnlinie, im Grunde ein bebautes Dreieck „in the middle of nowhere“. Wir bekamen ein schönes Reiheneckhaus im Züricher Weg, sogar mit Garten. Um sich für den Kauf zu qualifizieren, musste man zwei Kriterien erfüllen: erstens katholisch sein und zweitens kinderreich. Kein Problem für meine Eltern. Ich habe insgesamt vier jüngere Geschwister, erst bekam ich zwei Brüder, dann zwei Schwestern. 1957 zogen wir also in dieses, man könnte fast sagen Getto: nur Katholiken mit vielen Kindern.
In der Nachbarschaft wohnte die Familie Woelki. Einer der Söhne, Rainer Maria, ist heute Kardinal in Köln. Er war bei meinem zweiten Bruder Reinhard in der Klasse. Großen Kontakt gab es aber nicht, die Woelkis waren uns zu fromm. Im Gegensatz zu ihnen hatten wir ein Eckhaus. Darauf waren meine Eltern besonders stolz. Es kostete damals 28 000 D-Mark. Muss man sich mal überlegen. Es gab nur ein Kinderzimmer, ich schlief zunächst in einem von meinem Großvater designten Verschlag im Flur. Später kam ein Anbau mit zwei weiteren Zimmern dran, weil wir Kinder ins eigentliche Haus nicht mehr reinpassten. Der Anbau, nicht unterkellert, kostete dann schon 35 000 D-Mark. Aber immer noch alles sehr „affordable“. Am Anbau hatten wir zum Schmuck einen Ziegelstreifen auf der Fassade angebracht. In der Bruder-Klaus-Siedlung galt das schon als architektonisch extravagant.
Die Bauweise war schlicht. Bauträger war eine Firma namens Blivers, das stand für Blinden- und Versehrtenwerkstätten. Es gab nur zwei Haustypen, die sich durch die Neigung des Daches unterschieden – eines war etwas flacher. Die Bauarbeiter waren überwiegend Versehrte und ehemalige Soldaten, die während des Krieges den Umgang mit Beton gelernt hatten. Und so wurden sämtliche Häuser von der Spitze des Giebels bis unten in den Keller aus Beton gegossen. Da wurden Stahlwände aufgestellt, oben Beton eingefüllt, fertig. Natürlich war das von der Wärmeisolierung oder vom Schallschutz her nicht so besonders toll. Und wenn man später etwas umbauen wollte, gab es ein Problem: Die Dinger sind eigentlich unkaputtbar. Wir wollten damals ein Dachfenster einbauen und standen dann mit einem Presslufthammer oben auf dem Haus.
Für mich, den anfangs Sechsjährigen, war es ein fabelhafter Ort. Ich konnte überall mit dem Fahrrad hin, es gab eine Menge Platz zum Austoben – und in der Mitte ein ehemaliges, geschliffenes Militärfort aus dem Kölner Festungsring, das uns Kindern als Spielplatz diente. Wir nannten es „das Förtchen“. Vor allem aber: In einer total platten Gegend war es durch die alten Wälle und Gräben des Forts so ein bisschen hügelig und eigentlich ganz romantisch. Wenn es denn mal geschneit hatte, reichte der Hügel auch für den Schlitten oder für Skier. Später, als ich selbst Kinder hatte, ging mein Vater mit denen dort auch mal Ski fahren – einfach den Matsch runter, ohne Schnee. Die kamen total verdreckt zurück, teils ohne Schuhe – und hatten einen Riesenspaß. So etwas hätte es in meiner Kindheit nicht gegeben, aber als Großvater wird man ja weich.
Vor zehn Jahren war ich das letzte Mal in der Siedlung, als meine Mutter dort ausgezogen ist. Früher standen dort noch wesentlich mehr Bäume, es war grüner, viel bewachsener. Im Haus gegenüber, da wohnte die Familie Meier, die Tochter Evchen war eine Freundin. Der Garagenvorplatz ist ganz berühmt, vor allen Dingen deshalb, weil wir Fußball drauf gespielt haben. Wenn der Ball auf dem Dach landete oder dahinter im Garten der Familie Bosch, kriegte man unter Garantie Ärger, wenn man ihn wieder zurückgeholt hatte.
Gleich beim Förtchen, neben einem kleinen Einkaufszentrum, steht die Kirche St. Bruder Klaus, benannt nach einem seltsam-frommen Einsiedler aus der Schweiz. Der Architekt war damals in Deutschland nach dem Krieg recht bekannt: Fritz Schaller. Er hat in den 1960er-Jahren auch die Kölner Domplatte entworfen – das erhöhte Terrain für Fußgänger, das den alten Domhügel ersetzt hat. Schaller hat viele moderne Kirchen gebaut, so ein bisschen ungewöhnliche, mir gefällt das. Ich war ja auch oft genug drin.
Das Aufwachsen in dieser Siedlung hat mich schon stark geprägt. Es war sehr katholisch, damit auch sehr verklemmt. Aber auf der anderen Seite geordnet und sehr beschützt.
Den Beginn meiner Schulzeit habe ich noch nicht in der Schule verbracht, die neu in der Siedlung gebaut worden war. Als Erstklässler wurde ich im katholischen Jugendheim unterrichtet, quasi im Notbetrieb. Dann besuchte ich bis zum vierten Schuljahr die Volksschule Tiefentalstraße in Köln-Mülheim. Das Besondere: Mein Vater Wilhelm Balthasar, genannt Willi, war genau dort Lehrer. Wir gingen uns aus dem Weg, wo es nur ging. Ich wollte nicht als das Lehrersöhnchen gelten. Ich hatte Gott sei Dank keinen Unterricht bei meinem Vater. Und er wurde dann sehr schnell Konrektor. Aber wenn er mal Vertretung bei uns machte, war es mir eher unangenehm.
Er muss ein guter Pädagoge gewesen sein. Mein Vater konnte zum Beispiel nicht schwimmen. Er hat aber – als Nichtschwimmer – im Lehrbecken der Schule Hunderten von Kindern das Schwimmen beigebracht. Respektable Leistung. Heute wäre so eine Nummer schon aus haftungstechnischen Gründen gar nicht mehr möglich. Ich selbst habe erst ganz spät schwimmen gelernt, obwohl mein Vater es ja eigentlich gut beibringen konnte. Den anderen Kindern zumindest.
Vom Interesse an weltlichen, materiellen Dingen oder gar Anflügen von Luxus war mein Vater weit entfernt. Er besaß auch bis zu seinem Tod keinen Führerschein. Mit Autos konnte er partout nichts anfangen, ganz anders als später meine Brüder und ich. In der Kindheit lief bei uns einfach alles mit dem Fahrrad. Ich besaß ein Fahrrad der Marke Bauer ohne Gangschaltung. Als Jugendliche sind wir schon mal nach Bonn geradelt, knapp 40 Kilometer eine Strecke. Oder mit der ganzen Familie für einen Tagesausflug sogar nach Maria Laach, 85 Kilometer ein Weg. Dort waren wir dann vielleicht eine Stunde lang. Da gab es ein Restaurant, wo man preiswert Erbsensuppe essen konnte. Dann ging es die 85 Kilometer auf dem Rad wieder zurück. Kann man sich heute auch kaum noch so vorstellen.
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere wurde mein Vater später noch Rektor einer Grundschule in Köln-Buchheim, einem kleinen Brennpunktviertel. Es gab da Kasernen, die man in Wohnraum für wirtschaftlich Schwache umgewandelt hatte. Mein Vater war in der Hauptsache für die oberen Klassen verantwortlich und ich wurde regelmäßig von seinen Schülern verprügelt. Ich fuhr immer mit dem Fahrrad in die Schule. Wenn mein Vater irgendwas falsch machte, wurde ich auf dem Weg von seinen Schülern angehalten und vermöbelt. Darüber habe ich nie mit ihm gesprochen. Diese Prügel einzustecken, war für mich eine Art Ehrensache. Ich hatte sogar ein gewisses Verständnis dafür. Ich wusste, dass mein Vater ein ziemlich strenger Lehrer war. Ich war nicht automatisch der Meinung, dass seine Schüler unrecht hatten.
Auch ich habe ihm in der Schule den einen oder anderen Streich gespielt. Ich konnte zum Beispiel die Stimme meines Vaters sehr gut nachahmen. Damals mussten die Klassen, bevor man in die Pause auf den Hof durfte, an der Treppe stehen bleiben, in Kolonnen. Bis mein Vater kam und die Freigabe erteilte. Das habe ich dann auch mal gemacht. Als die Frage „Wer war das?“ kam, hat mich keiner verpetzt. Wir mussten alle eine Strafarbeit machen. Das empfand ich als Anerkennung.
Mein Vater war ein Pedant, in der Schule und zu Hause. „Papa ist aber pingelig“, sagten wir oft. Und es ist nicht zu leugnen: Genau das hat er über die Erziehung an mich weitergegeben. Ich bin auch eher ordentlich, meine eigenen drei Kinder spiegeln mir das. Zum Beispiel wenn es um meine alten Autos geht, meine Sammlerleidenschaft. Meine Kinder machen sich lustig und sagen: „Papa macht eine Plane über das Auto und dann über die Plane noch mal eine Plane, damit die Plane nicht schmutzig wird.“ Und ja: Ich fühle mich tatsächlich wohler, wenn es ordentlich ist. Ich mag keine Fingerabdrücke auf meinem Handy. Deshalb finde ich auch Touchscreens eigentlich doof. Also dieses Pedantische ist mir so antrainiert worden, da kann ich mich nicht so leicht von losmachen.
Allerdings: Ich fühle mich sehr wohl im unordentlichen Umfeld von anderen Leuten. Nur mein eigenes Umfeld halte ich lieber sauber. Ich bin jetzt seit 37 Jahren verheiratet, und das funktioniert mit meiner Familie nur deshalb, weil ich mich um die Kinderzimmer nie gekümmert habe.
Was meinen Vater angeht, war der in der Schule eigentlich fast noch netter, als wir ihn zu Hause wahrnahmen. Denn er hatte noch eine zweite Macke: Er war Choleriker. Bei Auseinandersetzungen wurde es schon mal laut. Aber dabei blieb es auch. Man muss wissen: In meiner Kindheit gab es ja noch die Prügelstrafe, das fing in der Volksschule an. Da gab es einen Lehrer, der hat uns immer mit dem Geigenbogen vertrimmt. Und bei einer Lehrerin musste man die Finger an die Tischkante legen – und dann ging es auf die Fingerspitzen. Im Gymnasium hatten wir einen Studienrat, der war ehemaliger Studentenmeister im Boxen und der haute immer ordentlich hinten auf den Rücken. Im Laufe meiner Schulzeit wurden die Sanktionen auf Klassenbucheintragungen umgestellt, was für mich den Nachteil hatte, dass ich sofort mit der maximalen Eintragungszahl belohnt wurde. Mir war die Prügelstrafe fast lieber.
Zu Hause wurde mein Vater immer mal von meiner Mutter eingespannt – nach dem Motto: Jetzt haben die Kinder wieder das und das ausgefressen. An der Kellertreppe hing der Riemen, der Gürtel meines Opas, eines Schreinermeisters. Ein ordentlicher, stabiler Ledergürtel. Und dann mussten wir mit unserem Vater in den Keller gehen und er sagte immer: „So, du schreist jetzt, wenn ich dir das sage.“ Und dann hat er mit Kraft auf die Kartoffelkiste geschlagen. Wir mussten schreien, nach drei Schlägen ging es wieder nach oben. Meine Mutter war zufrieden und wir waren körperlich völlig unversehrt. Also, eigentlich war mein Vater ein ganz netter Mensch, aber eben auch ein kleiner Wüterich.
Wir wussten natürlich genau, was ihn auf die Palme brachte. Die Dinge, die zu Problemen führten, waren eher ordnungsbedingt. Da genügte schon, wenn in der Sandkiste im Garten die Förmchen und Schippchen wild herumlagen. Es musste alles aussehen wie im Museum. Und wenn wir nicht aufräumten, gab es Zoff.
Meine Eltern hatten ein ganz einfaches Wertesystem. Zwei Dinge waren für sie ganz wichtig: erstens die Kirche. Die war immer ein Thema. Meine Eltern waren später starke Anhänger des Zweiten Vatikanischen Konzils, also eher fortschrittlich. Das andere, womit sie sich befassten, war Kultur. Wir hatten keinen Fernseher und lange kein Telefon. Und andere, strengere Werte als in den meisten Familien meiner Freunde. Bis weit in meine Studentenzeit galt: „Was liest du? In welchem Theaterstück bist du gewesen? Welches Konzert hast du gehört?“
Auch unser Geschmack wurde kontrolliert. Bei uns durfte alles an klassischer Musik gehört werden. Aber einmal hatte ich mir eine Schallplatte geliehen: These Boots Are Made for Walkin’ von Nancy Sinatra. Die durfte ich auf dem Plattenspieler nicht hören. Es war sehr restriktiv. Samstagabends gab es für uns immer ein Hörspiel, einen Krimi, das war ganz spannend. Immerhin.
Die normalen Dinge des Lebens spielten für meine Eltern keine Rolle. Mein Vater hatte einen Freund, der war selbstständig und fuhr eine Borgward Isabella. Wenn der Wagen anrollte, war das für uns eine Sensation. Wir hatten sonst gar keine Verwandten oder Bekannten, die ein Auto besaßen. Für meinen Vater war dieser Freund stets eine zweifelhafte Persönlichkeit, weil: Der war selbstständig, der war Geschäftsmann. Das war für meine Eltern etwas ganz Komisches. Diese Skepsis gegenüber dem Unternehmertum sollte ich auch noch zu spüren bekommen.
Meine Mutter war eine super Hausfrau, sie konnte perfekt haushalten. Sie verwaltete quasi das Gehalt meines Vaters und kam damit bestens über die Runden. Bei uns gab es immer gute Butter, bei uns gab es immer ordentliches Fleisch. Die Mutter ging auf den Markt und kaufte dann zum Beispiel Hasenklein und machte einen wunderbaren Hasenpfeffer. Und wenn sie Reibekuchen machte, dann kam die ganze Verwandtschaft.
Mein Vater kümmerte sich mehr oder weniger um nix. Und mein Großvater? Der sagte immer zu seinem Schwiegersohn, wenn der doch mal zu Hause etwas reparieren wollte: „Willi, lass die Futfinger davon.“ Und das sagte er nicht zu Unrecht. Mein Vater schraubte immer alles so fest, dass die Schraube abbrach. Mein Großvater kommentierte das dann lakonisch mit dem Spruch: „Nach fest kommt los.“ Bei uns mussten sogar die Wasserhähne regelmäßig ausgetauscht werden, weil mein Vater die so doll zudrehte, dass sie kaputtgingen. Er war handwerklich nicht besonders begabt.
Das ganze praktische Leben wurde von meiner Mutter gemanagt. Sie war streng, aber weitestgehend gerecht. Eines fanden wir als Kinder nicht so gut: Wir wurden alle einsortiert, jeder hatte so seine Schublade. Ich war intelligent, aber faul. Einer meiner Brüder war nicht so intelligent, aber praktisch sehr begabt und so weiter. Wir wurden alle miteinander verglichen und über unsere Schubladen letztlich auch geprägt. Pädagogisch war es im Rückblick vielleicht nicht besonders geschickt. Aber so sind wir groß geworden. Also einer meiner Brüder wurde immer für alle handwerklichen Fragen herangezogen – und so wurde er darin natürlich auch besser. Weil ich nie gefragt wurde, war ich natürlich nicht so gut, habe es aber dann nachher doch noch hingekriegt. Der Weg dahin war nicht leicht. Ich kann mich erinnern: Einmal habe ich die Waschmaschine repariert, einen neuen Stecker angebaut – und dabei die Pole verwechselt. Das Gehäuse der Waschmaschine stand dann unter Strom. Da hätte meine Mutter zu Tode kommen können, aber Gott sei Dank hat sie nur leicht einen gewischt bekommen.
Eines war für meine Mutter besonders charakteristisch: Sie war fest davon überzeugt, dass unsere Familie eigentlich die beste war. In den Augen meiner Mutter hatten wir das schönste Haus, den besten Geschmack und solche Dinge mehr. Von der Einrichtung her waren meine Eltern vom Bauhaus geprägt. Weniger ist mehr. Als wir da einzogen, gab es im Grunde ein Esszimmer und ein Wohnzimmer. Doch das Esszimmer blieb ungenutzt und lief jahrelang unter der Bezeichnung „das leere Zimmer“.
Das Badezimmer war zwar beim Einzug vorhanden, es hatte so einen Ölputz an der Wand und auch Anschlüsse. Aber wir besaßen weder eine Badewanne noch eine Dusche. Im Keller stand stattdessen eine Waschwanne aus Kupfer, eingefasst in Waschbeton, die von unten beheizt wurde. Darin wurde die ersten Jahre gebadet. Und ich hatte das große Privileg, dass ich als Ältester auch als Erster baden durfte, eigenartigerweise kam der Vater als Letzter dran. Der saß dann in der Suppe, in der sich schon die ganze Familie gesuhlt hatte. Die Verhältnisse waren ein bisschen rustikal, aber behütet.
Keine Frage: Als sich die Gelegenheit bot, waren wir selbstverständlich die Ersten in der Siedlung, die eine Badewanne hatten. Es wurde ja immer kontrolliert und verglichen, was machen die Nachbarn? Es gab auch Nachbarn, die Fernsehen hatten. Und so durften wir gelegentlich auch mal mitgucken. Ich kann mich an Peter Rosegger erinnern, den Waldbauernbub. Das war so eine alpine Kindergeschichte, sehr beeindruckend damals. Ansonsten weiß ich, dass wir eine Papstwahl im Fernsehen gucken durften. Das wars dann auch schon.
Das alles war etwas weltfremd – und mir wurde es zunehmend unangenehm. Als ich studierte und mich mal zu Hause melden wollte, musste ich bei den Nachbarn anrufen und mich entschuldigen für die Störung. Die holten dann meine Mutter an den Apparat. Mein Vater wäre gar nicht erst rübergegangen, so wenig interessierte der sich für das praktische Leben. Irgendwann nahmen wir Kinder das dann in die Hand und schenkten unseren Eltern ein Telefon, Anfang der 70er-Jahre muss das gewesen sein. Meine Eltern bekamen nach und nach auch Dinge von Verwandten, die es nicht mehr mit ansehen konnten. So kam erst eine Tiefkühltruhe ins Haus, irgendwann auch ein Fernseher. Aber als das passierte, war ich längst ausgezogen, um in Bonn zu studieren.
Mit elf Jahren kam ich auf das staatlich-humanistische, altsprachliche Gymnasium für Knaben in Köln-Mülheim. Die Schule war klein und altmodisch, sie hatte nur 450 Schüler. Auch meine Onkel waren alle dort gewesen, der Name Richenhagen war bekannt, was ein Vorteil war. Weil meine Familie musikalisch war, kriegte ich automatisch in Musik immer eine Eins.
Doch es lief nicht alles glatt: Als ich in der Lateinarbeit erwischt wurde, weil ich dieses Pons-Wörterbuch als unzulässige Übersetzungshilfe benutzt hatte, drohte großer Ärger. Das Wörterbuch wurde mir abgenommen und meinem Vater ein böser Brief zugeschickt. „Pass mal auf, Martin“, hat er gesagt. „Man darf alles, aber man darf sich nicht erwischen lassen. Hier hast du den Pons zurück – und lass dich nicht noch mal erwischen.“ In vermeintlich gravierenden Dingen war er erstaunlicherweise immer super großzügig.
Ich nehme an, die Nachkriegszeit war auch mit prägend für die ethischen Vorstellungen meines Vaters: Obwohl er Katholik war, ging er damals – wie so viele – „organisieren“. Der Kölner Kardinal Josef Frings hatte in seiner Silvesterpredigt 1946 für dieses Stehlen aus Not so viel Verständnis aufgebracht, dass anschließend die eigenwillige Beschaffung von Kohle und Nahrung unter dem Ausdruck „fringsen“ Absolution fand. Auch mein Vater und seine Verwandten sind wohl übers Land gezogen und haben irgendwie Kartoffeln besorgt. Teilweise getauscht, teilweise geklaut.
Und dieses Organisieren und Beziehungenhaben – das blieb in unserer Familie auch immer ganz wichtig. Wenn wir Besuch hatten, hieß es dann: „Willi, was brauchst du?“ Und dann wurde gedealt. Fliesen, Kartoffeln, alles Mögliche. Da war mein Vater relativ locker. Ich glaube, wenn ich irgendwo beim Stehlen erwischt worden wäre, hätte er gesagt: „Ist okay, aber mach es nicht noch mal.“
Als ich den Führerschein hatte, war mein erstes Auto ein R4 für 450 D-Mark. Den habe ich dann getauscht gegen einen VW Käfer von 1957, das Modell mit dem ovalen Fenster im Heck. Eines Tages im Winter hatte ich den auf unserem Parkplatz am Haus wunderbar gewaschen und geputzt. Abends war ich unterwegs, hatte vielleicht einen Schluck zu viel getrunken und kam schwungvoll nach Hause. Nur leider war die Parkfläche durch das Autowaschen spiegelglatt gefroren und ich bin voll gegen unser Haus gefahren.
Auch darauf hat mein Vater nicht schlimm reagiert – im Gegenteil: Er hat mit mir überlegt: „Ja, wie kriegen wir das jetzt wieder hin?“ Und sagte dann: „Ich hab da einen, der kann das machen.“ Ein neuer Kotflügel musste dran, vorne links. Und damit war es für ihn erledigt. Diese Mentalität fand ich bewundernswert: Ein Fehler kann passieren, es wäre nur blöd, daraus nicht zu lernen.
Es war immer mein Traum, aus der Bruder-Klaus-Siedlung rauszukommen und die Welt kennenzulernen. Die Abläufe waren bei uns zu Hause sehr geregelt. Nach der Schule Mittagessen, Hausaufgaben, dann jeden Tag Geige üben, was von meinen Eltern kontrolliert wurde. Das blieb so bis zum Abitur. Hätte man mich gefragt, welches Instrument ich lernen wollte, hätte ich mich für Klarinette entschieden, weil sie vielseitiger ist. Mit einer Klarinette kann man klassische Musik spielen, aber auch Jazz.
Ich hatte aber das Glück – oder eben Pech –, dass ich von einem Onkel eine Geige bekam. Und zwar nicht irgendeine. Er war Geiger auf dem Schiff „Bremen“ gewesen, einem 1941 ausgebrannten und gefluteten KdF-Dampfer. Das Einzige, was in der Katastrophe gerettet wurde, so wurde mir erzählt, war die Geige. Und ich wurde dazu verdonnert, Unterricht zu nehmen. Zunächst bei einer Frau, aber ihr Ehemann unterrichtete mich auch häufig. Sein Name: Klaus von Wrochem. In Köln und darüber hinaus ist er als Straßenmusiker „Klaus der Geiger“ bekannt geworden – Latzhose und Hippiebart waren seine Markenzeichen. Und der hat natürlich immer sofort festgestellt: „Martin, häste mal widder nit jeübt.“
Geübt habe ich meist im Sitzen, was man eigentlich nicht machen sollte. Oft hatte ich auch ein Buch auf dem Notenständer. Um die Erwartungen meiner Mutter zu erfüllen, habe ich etwas rumgefiedelt, in Wirklichkeit aber ein Buch gelesen.
Das Lustige war: Nachdem ich meinen Kindern erzählt hatte, dass ich Klaus den Geiger kenne, kam es viel später einmal zur zufälligen Begegnung. Wir gingen über die Hohe Straße oder Schildergasse, also eine von Kölns Shoppingmeilen, da stand Klaus von Wrochem. Wir blieben stehen und er konnte sich tatsächlich an mich erinnern. „Martin, mir war klar, dass aus dir nichts wird“, sagte er. „Guck dir doch mal an, wie du aussiehst.“ Ich hatte einen Anzug an. In seiner Welt war ich eine totale Fehlentwicklung.
Glücklicherweise konnte ich nachmittags nach dem obligatorischen Geigeüben immer machen, was ich wollte. Ein Gutes hatte der Zwang zur Geige: Ich brachte es bis ins Schulorchester und vor allem erschloss sich dadurch eine Einnahmequelle. Mit einem Klassenkameraden, der sehr gut Orgel spielen konnte, fuhr ich immer mal wieder an Samstagen mit dem Fahrrad nach Altenberg. Ich hatte die Geige auf dem Rücken und dann spielten wir in der wunderschönen gotischen Kathedrale auf Hochzeiten. Unser Starstück, das für Geiger nicht besonders anspruchsvoll ist, konnte ich so einigermaßen: das Largo von Händel. Oft mussten wir auf Wunsch auch so einen Kram wie das Ave Maria spielen. 50 D-Mark pro Hochzeit pro Person konnten wir damit verdienen, also sehr viel Geld. Hinzu kam häufig noch jede Menge Trinkgeld von Opas, Tanten und so weiter.
Ich bin ein ganz passabler Geiger geworden, aber mein jüngerer Bruder war immer besser als ich, weil er mehr geübt hat. Ich habe mich auch für andere Musik interessiert und mir selbst Gitarre spielen beigebracht. Ich kann bis heute das Liederbuch Die Mundorgel vorwärts und rückwärts spielen. Das mache ich tatsächlich ganz gerne, wenn man am Abend irgendwo gemütlich sitzt und zufällig eine Gitarre in der Nähe ist.
Wir waren eine große Familie, in der sich viele beim Frommsein gegenseitig zu überbieten versuchten. Mein Vater war der jüngste von vier Brüdern. Sein ältester Bruder, auch er hieß Martin, war mein Patenonkel. Er war Priester und viele Jahre Professor für Altes Testament. Der nächstjüngere, Gottfried, arbeitete als Militärdekan bei der Luftwaffe in Köln-Wahn, später wurde er Pastor einer großen Pfarrei in Bonn-Beuel. Der dritte Bruder, Joseph, war Amtmann bei der Stadt Köln. Wenn die Brüder zusammenkamen, wurde immer viel diskutiert, bevorzugt über Religion. Mir wurde irgendwann klar: Im Grunde war meine spätere Studienwahl – vor allem das Interesse für die Fächer Religion und Philosophie – eine Reaktion auf diese innerfamiliären Debatten. Ich wollte mitreden können, am besten natürlich: den Alten widersprechen.
Mich reizt der Widerspruch, schon immer. Wenn früher bei Familientreffen über Kirche diskutiert wurde, geriet mein Vater sogar in Rechtfertigungsnöte gegenüber seinen Brüdern. Gemessen an der Restfamilie waren wir etwas fortschrittlicher und vielleicht doch nicht so fromm. Es hieß aber dennoch immer für uns Kinder: „Haltet euch da raus, ihr habt sowieso keine Ahnung.“ Das führte dazu, dass ich ein sehr kritischer Schüler im Religionsunterricht war. Ich bekam immer eine Eins. Und ich habe mich auch in der Kirche engagiert. Zwar war ich nie Messdiener, aber zur Optimierung meines Budgets habe ich später den Küster vertreten und Pfarrfeste mitorganisiert. In den Ferien war ich manchmal „Gruppenführer“, so hieß das damals noch in der Katholischen Jugend.
Gelegentlich kam hoher Besuch in die Bruder-Klaus-Siedlung. Als unsere Kirche eingeweiht wurde, waren Adenauer und Kardinal Frings vor Ort. Wir Kinder wurden besonders herzlich begrüßt und durften dicht ran. Für meine Eltern waren solche Events immer ein willkommener Anlass für einen Ausflug. Einmal, das war auf dem Flughafen in Köln-Wahn, wo mein Onkel Militärseelsorger war, wurde eine Behelfskirche eingeweiht. Auch da kam der Frings. Sein Kardinalhut lag schon bereit, bevor es losging. Wir haben ihn uns genommen und reihum aufgesetzt. Als wir dem Kardinal anschließend vorgestellt wurden, hat einer meiner Brüder stolz gepetzt: „Ich habe deinen Hut aufgehabt.“
Unser Vater unternahm mit uns Kindern immer gerne Touren, etwa Krippentouren, wo wir dann die Kölner Kirchen abklapperten und fünfzehn Krippen besichtigen durften. Viel besser gefielen uns natürlich der Zoo und die Fahrt mit dem Mülheimer Bötchen und der Seilbahn. Damals gab es ein Gutscheinheft für kinderreiche Familien, das einem auch mal zu freiem Eintritt ins Hänneschen-Theater und ins Museum verhalf.
Auch zum Flughafen radelten wir öfter mit meinem Vater, und dank der Verbindung zum Onkel durften wir auf das militärische Gelände. Da gab es kein richtiges Terminal, nur einen bescheidenen Tower und ein kleines Abfertigungsgebäude. Vor einer Art Cafeteria standen ein paar Gartenstühle, das war es auch schon. Die Leute gingen vom Check-in ohne Kontrolle über das Flugfeld zu ihrer Maschine. Treppe hoch, einsteigen, weg. Auch zu besonderen Anlässen wie Staatsbesuchen sind wir gerne nach Köln-Wahn zu meinem Onkel gefahren. 1965 haben wir die englische Königin Elisabeth II. begrüßt, auch bei der Landung von Charles de Gaulle waren wir am Rollfeld. Da gab es nur einen kleinen Zaun. Es war eine ganz andere Welt, ohne große Kontrollen.
Miterlebt habe ich auch, wie am 23. Juni 1963 John F. Kennedy in Köln landete. Drei Tage vor seiner berühmten Berliner Rede, fünf Monate vor seinem Tod in Dallas. In der ersten Reihe am Rollfeld konnte es schon mal passieren, dass einem über den Kopf gestreichelt wurde. Nun muss man überlegen: Woran kann man sich eigentlich aus seiner Kindheit verlässlich erinnern? Ich behaupte jedenfalls immer, dass der Kennedy mich, den Zehnjährigen, persönlich begrüßt hat. Es kann aber auch rheinisch-familiäre Legendenbildung sein. Mein Vater und mein Onkel können keine Auskunft mehr geben. Beide sind tot. Mein Vater ist früh verstorben, schon bevor ich in die USA gegangen bin. Und die Kennedy-Story ist für mich selbst erst relevant, seitdem ich hier in Amerika bin.
Alles, woran ich mich aus Kindheit und Jugend in Bezug auf Amerika außerdem erinnern kann, sind die typischen Sachen: vor allem die Musik, der immense Eindruck von Woodstock, die Freiheit und Weite. Zwei Merkmale, die zu der Zeit weder meine Geburtsstadt noch meine Familie aufweisen konnten. Geboren wurde ich im Dreikönigen-Hospital auf der Keupstraße in Köln-Mülheim, die heute türkisch und kurdisch dominiert ist. Meine Eltern wohnten zu der Zeit noch in Köln-Dünnwald. Der Großvater väterlicherseits, Joseph, war Textilkaufmann, er lebte in der Nähe des Wiener Platzes in Köln-Mülheim. Mit ihm und seiner Frau Elisabeth hatte ich regelmäßig Kontakt, es waren alles kurze Wege im rechtsrheinischen Köln.
Meine Mutter war ein paar Jahre älter als mein Vater. Auch sie war sehr katholisch. Ihr Vater Heinrich, der Schreinermeister, war für uns als Handwerker sehr spannend, besonders wenn er uns etwas beibrachte. Nachdem Heinrich im Krieg alles verloren hatte, arbeitete er als Hausschreiner im Kloster Vom Guten Hirten auf der Aachener Straße in Köln-Junkersdorf. Das war damals ein wirklich konservativer Orden. Eine Schwester meiner Mutter lebte dort als Nonne. Ich kann mich erinnern: Man konnte meine Tante nur in so einer Art Knastsituation besuchen. Sie saß dann in einem Zimmerchen mit einem Gitter dazwischen, was ich sehr beklemmend fand.
Gerne verzog ich mich in der Bruder-Klaus-Siedlung in das Wäldchen, das gleich an unser Haus anschloss und bis zur Autobahn reichte. Da gab es noch Reste von Schützengräben aus dem Krieg, in denen wir spielten. Wir hatten unsere Baumhäuser, es gab verschiedene Banden. Heute ist dort ein großer Lärmschutzwall hochgezogen. Damals war auf der Autobahn noch nicht so viel los – aber sie war die natürliche Grenze des Viertels.
Richtig spannend wurde es, als Anfang der 60er-Jahre eine Brücke über die Autobahn gebaut wurde – praktisch als Verlängerung unserer Wohnstraße. So erweiterten wir mit einem Schlag unseren Aktionsradius enorm. Rüber nach Höhenhaus zum Bauern Heinz Litz waren es Luftlinie nur 100 Meter. Vor dem Brückenschlag war der Hof unerreichbar, die andere Seite existierte praktisch nicht. Nun aber konnten wir stundenlang auf der Brücke stehen, Autos angucken und einfach rübergehen.
Schon der Bau war ein Spektakel, wir Kinder waren natürlich total begeistert und hatten guten Kontakt zu den Bauarbeitern. Den Oberaufseher nannten wir „Bau-Chef“. Wir waren auch der Meinung, dass dem die Brücke gehörte. Schließlich sind wir ihm so lange auf den Keks gegangen, bis er für unsere Griechischen Landschildkröten und unsere Karnickel einen Stall gebaut hat.
Der Hof Litz ist bis heute ein stattliches, efeuberanktes Gutshaus aus Backstein. Im weniger schicken Anbau lebten einige polnische Gastarbeiter und eine Familie Jäschke. Die Mutter putzte schon mal bei uns, ihr Mann war Schweizer, also der Melkexperte des Hofes. Zu Ostern bekamen wir von unseren Eltern immer ein kleines Kaninchen geschenkt. Das wurde, wenn wir in den Sommerurlaub fuhren, bei Jäschkes abgegeben. Und jedes Mal verschwand das komischerweise. Wenn wir zurückkamen, war das Kaninchen weg – weggelaufen, krank geworden, was weiß ich. Erst viel später haben wir herausbekommen, dass es natürlich im Kochtopf gelandet war.
Dieser Bauernhof bekam für mich eine immer größere Anziehungskraft. Nicht dass der Bauer besonders freundlich zu uns gewesen wäre. Im Gegenteil. Gegenüber vom Gutshaus sammelten wir Kastanien auf und wurden immer weggejagt. Aber wir trieben uns dennoch oft dort herum, denn es war immer großer Betrieb. Uns haben die Landmaschinen fasziniert und natürlich die Tiere. Später haben wir die Autos des Bauern gewaschen, in einer großen Scheune, wo auch die Traktoren standen – erst Hanomag, dann Deutz. Damals waren mir die Marken noch egal, aber registriert habe ich sie schon.
Wir wurden als Kinder finanziell sehr knapp gehalten. Mein höchstes Taschengeld in der Oberstufe betrug 5 D-Mark pro Woche. Dadurch haben wir schon von klein auf gelernt, uns irgendwie geschäftlich zu entwickeln. In einer Unterführung flogen den Autos in den tiefen Schlaglöchern die Radkappen ab. Die haben wir aufgesammelt und zurückgebracht – für ein Trinkgeld.
Im Grunde bin ich durch das Autoputzen bei Bauer Litz zur Landwirtschaft gekommen. Ich interessierte mich für die Pferde dort, echte Ackergäule, auf denen wir auch mal reiten durften. Ebenso ging es meinem zweiten Bruder Reinhard. Bei uns beiden entwickelte sich der Geschäftssinn mehr und mehr im reitsportlichen Bereich. Erst haben wir gegen Geld Pferde gepflegt, später für andere Leute Pferde geritten, schließlich auch in Reitställen Unterricht erteilt.
Mein Bruder Reinhard hat später begonnen, Landwirtschaft zu studieren, ist dann aber umgestiegen auf eine Ausbildung bei der Stadt Köln. Schließlich war er jahrelang Mitarbeiter bei einem Großhändler für Reitsportzubehör. Reinhard ist von Pferden begeistert, so wie ich. Ein extrem engagierter Reiter, Reitsportrichter und Ausbilder. Das gemeinsame Hobby bedeutet uns bis heute viel. Reinhard ist internationaler Grand-Prix-Richter im Dressursport und trainiert noch heute für uns Pferde in Deutschland, die wir dann später auf unsere Familienfarm Hidden Pines einfliegen, die nördlich von Atlanta in Alpharetta liegt. Diese Farm, um die sich vor allem meine Frau kümmert, begreifen wir als Paradies für unsere Dressurpferde, die hier trainiert werden. Auch nach ihrer aktiven Karriere haben sie ihre Box bis ans Lebensende sicher. Die Farm ist auch der bevorzugte Rückzugsort für meine Frau und mich. Gerade während der Coronapandemie haben wir dort viel Zeit verbracht.
Insgesamt hatten wir fünf Geschwister eine sehr gute und immer enge Beziehung. Wir spielten unglaublich viel zusammen, auch ohne Spielzeug, denn das war knapp. Es gab für uns einen ausrangierten Barren und einen Bock von der Schule, auf dem wir rumturnten. Aber einen vernünftigen Ball zum Beispiel hatten wir lange nicht.
Wir drei Jungs waren die Erstgeborenen, dann folgten die beiden Schwestern, die heute als Lehrerinnen arbeiten. Natürlich stellten sich die drei Jungs schützend vor die Schwestern – auch gegenüber den Eltern. Wir Älteren versuchten, ein paar Dinge, unter denen wir noch gelitten hatten, für die Schwestern etwas zu erleichtern. Wir legten bei den Eltern öfter ein gutes Wort ein, nach dem Motto: „Och, lasst die doch jetzt mal länger wegbleiben.“
Als wir älter wurden, ging es immer darum, irgendetwas auf die Beine zu stellen. Eines Tages aus der Bruder-Klaus-Siedlung rauszukommen, wurde immer wichtiger. Autos waren insofern genial. Ich hatte einen Freund, der hatte schon den Führerschein und eine Ente. Wir hatten die Idee, beim Pfarrfest in der Nachbargemeinde St. Hedwig im großen Stil Waffeln zu backen, einen richtigen Stand aufzuziehen und damit Geld zu verdienen. Meine Mutter hatte eine riesige Pfanne mit Teig vorbereitet, so eine richtige Bütte, wie man damals sagte. Die wuchteten wir in die Ente. Und schon in der ersten Kurve schwappte eine ordentliche Portion in den Bodenraum. Das Auto roch noch Monate danach – jedes Mal wenn die Heizung anging.
Also dieses Organisieren und auch das Geldverdienen, das hat mir schon damals immer Spaß gemacht. Der erste Weihnachtsmarkt in Köln, zumindest der erste in meiner Erinnerung, muss so 1970 gewesen sein. Da haben wir einen London-Bus als Stand gemietet. Und aus diesem Doppeldecker heraus haben wir Dritte-Welt-Klamotten verkauft, das war damals noch innovativ.
Die Bruder-Klaus-Siedlung hat mit ihrem speziellen Klima ein paar interessante Leute hervorgebracht. Bei der Frage, wer es eigentlich geschafft hat, sich dort raus zu entwickeln, kommt man neben Kardinal Woelki schnell auf Franz Meurer. Er war eine Klasse über mir und ich kann mich noch gut an ihn erinnern. Heute ist Meurer ein stadtbekannter Pfarrer in den Kölner Vierteln Vingst und Höhenberg, er gilt als sozial sehr engagiert und streitbar. Er hat beispielsweise einen Kondomautomaten aufgestellt und die Sonntagskollekte eines katholischen Gottesdienstes der umstrittenen Kölner Großmoschee gewidmet. Auch eine Geldstrafe bekam er vom Gericht aufgebrummt, weil er rechtspopulistische Wahlplakate in der Nähe der Kirche abgerissen hatte.
Nach meiner Erinnerung war Meurer allerdings in jungen Jahren sehr konservativ. Er wurde Messdiener, dann Obermessdiener, war in der Katholischen Jugend sehr aktiv, wurde Klassensprecher und Schulsprecher. Ich hatte einmal, im Oktober 1966, direkt mit ihm zu tun. Damals lief in Köln über mehrere Tage eine massive Demonstration gegen die Fahrpreiserhöhung der Kölner Verkehrsbetriebe KVB. Tausende Schüler und Studenten blockierten am Neumarkt die Schienen, Wasserwerfer und berittene Polizei waren im Einsatz. Man kann fast von Krawall sprechen.
In dieser Situation kamen extra Studenten vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund SDS an unsere abgelegene Schule, um uns zu rekrutieren. Die wollten uns Schüler motivieren, bei der Demo mitzumachen. Wir waren begeistert. Ich fuhr zwar immer mit dem Fahrrad umher und nutzte keine Busse und Straßenbahnen, aber selbstverständlich haben wir uns solidarisiert. Aber dann hat Franz Meurer, der Schulsprecher, die Tür abgeschlossen. Die Meurers hatten einen gut ausgebildeten Deutschen Schäferhund. Mit dem ging er vorne auf dem Schulhof Streife. In dieser Stunde wurde ich sozusagen der Anführer einer Gegenbewegung: Ich habe den Hausmeister überzeugt, uns hinten den Lehrerausgang aufzuschließen. Wir sind entwichen und haben es alle auf den Neumarkt zur Demonstration geschafft. Die Demo hat in mir eine erste Politisierung ausgelöst – und eine kritische Grundeinstellung gegenüber Autoritäten. Meurer habe ich nie mehr getroffen, obwohl er eine sehr hübsche Schwester hatte.
Mein Vorbild und engster Freund in der Schulzeit war jemand anderes: Raphael Wunsch. Er lebte auch in der Bruder-Klaus-Siedlung, war ein bisschen älter als ich, sehr gut in der Schule. Allerdings besuchte er eine andere als ich. Dem Raphael Wunsch habe ich immer ein bisschen nachgeeifert. Zum Beispiel hatte er Meerschweinchen. Ich bekam also auch eins, sodass sich unsere Tiere treffen konnten. Raphael war ein guter Fotograf, auch das Fotografieren habe ich von ihm gelernt. Ich wurde leidenschaftlicher Hobbyfotograf und meine Schwestern habe ich besonders oft abgelichtet. Raphael hat später Anglistik und Sozialwissenschaften studiert und dann Karriere als Studienrat und schließlich Schulrat gemacht.
Ich finde es immer sehr schön, die alten Weggefährten zu treffen. Vor ein paar Jahren bin ich mal vom Amerika-Haus in Köln zu einem Vortrag eingeladen worden. Dorthin kamen auch Leute aus meinem Studium, aus meiner Kindheit. Raphael Wunsch war gekommen und ehemalige Kollegen, ehemalige Schüler. Das war für mich eine tolle Überraschung.
Vor vielen Jahrzehnten habe ich mal ein Klassentreffen in meinem Elternhaus organisiert. Nach zwei Kurzschuljahren habe ich 1971 Abitur gemacht – in einer echten Umbruchphase nach den Studentenprotesten von 1968. Es gab die Auflehnung gegen den Krieg der USA in Vietnam, gleichzeitig gegen die als autoritär empfundene Elterngeneration. Man hatte eine Protesthaltung. Unsere Klasse war eher klein, mit einem sehr guten Zusammenhalt. Wir fühlten uns alle ein bisschen revolutionär – und haben eine Abiturfeier abgelehnt. Wir bestanden darauf, dass uns das Zeugnis einfach nur zugeschickt wird.
Heute gibt es ja diese wahnsinnigen Möglichkeiten, Leute über das Internet wiederzufinden. So habe ich vor ein paar Jahren von Amerika aus ein Klassentreffen in Köln organisiert. Treffpunkt: das Brauhaus Früh am Dom. Gefühlt war ich immer ein mittelmäßiger Schüler. Als wir uns im Früh trafen, habe ich das auch so gesagt: „Ich war ja nie so ein toller Hecht.“ Darauf meldete sich mein Banknachbar, der Sohn einer Studienrätin, Christoph Burchard. Heute ist er Anwalt in Hamburg. „Du gehörtest doch immer zu den vier Besten“, sagte der. „Ihr seid total bescheuert“, sagte ich. Eine ganze Zeit lang war Burchard unser Klassenbuchbeauftragter und hatte offenbar auch noch so einen roten Lehrerkalender geführt, den er von seiner Mutter hatte. Darin hatte er sämtliche Noten schriftlich und mündlich mitgeschrieben. Dieses Büchlein zückte er nun. „Ich les mal vor“, sagte er. Dabei stellte sich zu meiner Überraschung heraus, dass ich auf unserem kleinen humanistischen Gymnasium wohl zu den Top 3 oder Top 4 der Klasse gehörte. Ich war nicht besonders ehrgeizig, aber effizient. Hausaufgaben erledigte ich meist komplett in der Schule, in den Pausen, den Freistunden. Dann wurden sogar im Geschichtsunterricht die Lateinhausaufgaben gemacht und so weiter. Auch Vokabeln habe ich nie gelernt, das reichte zum Glück immer so. Offenbar war ich doch ganz okay als Schüler – mit einer auf Desinteresse basierenden Schwäche in Mathematik.
Noch Jahre nach dem Abitur hatte ich einen Albtraum, in dem ich in der Matheprüfung pfusche. Im Traum muss ich – wie in der Feuerzangenbowle – noch mal in die Oberprima. In der Realität war meine Vorzensur nur eine knappe Vier. Doch dann bekam ich die Klausur tatsächlich ganz ordentlich hin, sodass die Gefahr bestand, in die mündliche Nachprüfung zu kommen. Um das zu vermeiden, bin ich auf die schlechte Vornote eingestiegen. Im Gegensatz zum Rest waren meine Matheleistungen wirklich nicht gut. Seitdem habe ich aber ein ganz gutes Zahlenverständnis und ein Gefühl für das praktische Rechnen entwickelt.
Mein absolutes Lieblingsfach war Deutsch. Ich mochte auch Kunst, Musik und Philosophie. Aber für Deutsch habe ich mich begeistert. Am liebsten waren mir Aufsätze über freie Themen. Einmal argumentierte ich in einer Arbeit, dass die Ehe keine Zukunft habe. Seitenweise schrieb ich solche Besinnungsaufsätze.
Dabei entwickelte ich auch bestimmte individuelle Züge, besser gesagt: Ich kopierte sie. Mein Klassenlehrer, den ich mochte, schrieb in Druckschrift. So eine leicht verflüssigte Druckschrift. Das habe ich übernommen, so schreibe ich bis heute noch. Und Raphael Wunsch schrieb mit grüner Tinte. Also habe ich bald in Druckschrift mit grüner Tinte geschrieben. Einmal sprach mich der Direktor darauf an. „Hören Sie mal, Grün ist eigentlich nur meine Farbe. Wenn ich nämlich eine rote Korrektur überstimme, dann mache ich das in Grün.“ Ich habe das aber nie geändert, auch heute noch habe ich auf meinem Schreibtisch einen Montblanc-Füller mit grüner Tinte. Meine Notizen mache ich handschriftlich. Und ich schreibe gerne einen Brief zu besonderen Anlässen. Zum Beispiel zum achtzigsten Geburtstag des Unternehmers Bernard Krone in Spelle. Man muss sich einfach die Zeit nehmen. Schönes Papier, schöne Tinte – das gehört dazu.
Meine Beziehung zum Schulsport war zwiegespalten: All diese technischen Sportarten hat mir niemand beigebracht. Es gab aber bestimmte Dinge, die konnte ich seltsamerweise. Am Reck und am Barren gelang mir nichts. Dafür beherrschte ich aber den Salto über das lange Pferd, also die schwerste Übung beim Geräteturnen. Ich erinnere mich gut an das Abitur. Das Prüfungsgremium saß in der Turnhalle an einem langen Pult. Es lief echt nicht gut für mich. Reck ausreichend, Barren ausreichend. Bodenturnen war eine Katastrophe. Dann habe ich das Pferd aufbauen lassen. Da sagten alle: „Sind Sie lebensmüde?“ Ich habe meine Hand rausgestreckt, zur Faust geballt, wie das damals die Schwarzen bei den Olympischen Spielen machten. Hab den Überschlag hingelegt und bekam am Pferd eine Eins.
Ich konnte nie am Reck diesen Felgumschwung, mit Mühe den Felgaufschwung. Vor dem Abitur hatte ich aber gesagt: „Wenn ich in Sport bestehe, dann mache ich einen Felgumschwung.“ Und nachdem die Prüfung zu Ende war, bin ich ans Reck gegangen, hab den Felgumschwung gemacht und es klappte. Den konnte ich noch Jahre später. Heute aber wahrscheinlich nicht mehr.
Viele Sportlehrer sind ja so, dass sie sich nur um die Guten kümmern und die Schwächeren nicht fördern. Ich war zum Beispiel ein superschneller Läufer. Den Sportlehrern hätte eigentlich auffallen müssen, dass ich doch etwas konnte. Hat aber keiner bemerkt. Wenn Mannschaften gewählt wurden, war ich immer mit bei den Letzten. Oft musste ich „Ball über die Schnur“ spielen, weil man mich beim Fußball nicht gebrauchen konnte. Deshalb habe ich mich sportlich eher in den Randbereichen entwickelt, wo ich Chancen hatte. Ich war in der Rudermannschaft der Schule, ich habe Skifahren gelernt. Und dann habe ich mich immer mehr in das Reiten reingesteigert.
Bestimmte Lehrer haben uns sehr geprägt, so wie unser Deutschlehrer, der uns unglaublich viel Freiraum gegeben hat. Bei ihm durften wir sogar unsere Klassenarbeit im Eiscafé schreiben. Wir fühlten uns in seinem Unterricht wie die Mini-Sartres – und lieferten super Ergebnisse.
Wir hatten auch einen richtig tollen Französischlehrer, Manfred Hoffmann – mein Lieblingsklassenlehrer. Hoffmann war nicht nur für mein neues Schriftbild verantwortlich, sondern auch mit dafür, dass ich Französisch studiert habe. Ein für mich absolut prägender Charakter, ein Freigeist. Mit ihm habe ich heute noch Kontakt. Beim Klassentreffen im Brauhaus war er auch dabei. Auch wollte ich ihn einladen, als mir 2018 der französische Orden Ritter der Ehrenlegion (Chevalier de la Légion d’honneur) angeheftet worden ist. Leider konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen.
Dieser Mann war gar kein leidenschaftlicher Lehrer, ebenso wie wir nicht allzu leidenschaftliche Schüler waren. Aber er war ein genialer Pädagoge. Er hat uns erklärt: „Ihr braucht bei mir keine Hausaufgaben zu machen und keine Vokabeln zu lernen.“ Als ich später Lehrer wurde, habe ich das auch so gemacht. „Wenn ihr hier 45 Minuten lang aufpasst, reicht das vollkommen aus.“ Und in diesen 45 Minuten hat er uns so für Frankreich begeistert, dass es für das eigene Leben etwas bewegt hat. Die eine Lektion im Schulbuch Etudes Françaises heißt beispielsweise Salade niçoise. Bei Hoffmann wurde dieser Nizzasalat wie selbstverständlich in der Klasse zubereitet. Auch das habe ich später als Lehrer gemacht. Dinge tun, nicht nur darüber reden: ein absolutes Erfolgsrezept.