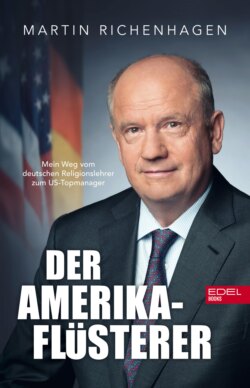Читать книгу Der Amerika-Flüsterer - Martin Richenhagen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wer bin ich?
ОглавлениеVom Erwachsenwerden zwischen Sartre und Reitstall, Katz-und-Maus-Spiel mit französischen Polizisten, von gescheiterten ersten Beziehungen – und davon, was man bei einer Skatrunde mit Strauß und Wehner lernen kann.
Reisen bildet, heißt es ja. Eine Binsenweisheit zwar. Aber wer auf der Suche nach sich selbst ist, setzt sich am besten in Bewegung. Bei mir hat es oft klick gemacht, wenn ich unterwegs war. Immer wieder waren für mich Geschehnisse fern der Heimat Wendepunkte oder Auslöser für etwas Neues.
Schon die Urlaube mit der Familie waren etwas ganz Besonderes, trotz einer gewissen Monotonie, was das Ziel anging: Wir fuhren jedes Jahr in die Berge, obligatorische Ferien auf dem Bauernhof. Aber ich mochte das Landleben und die Gipfelstürmerei: herrliche Luft, Natur, kraxeln – und zur Belohnung der Blick von weit oben. Alles aber in Grenzen: Österreich und Schweiz waren für uns das Höchste der Gefühle.
Unser Urlaubsziel musste ohne Auto erreichbar sein, weil wir ja keines besaßen. Wir stiegen alle zusammen in Köln in den Zug, nahmen später irgendwo den Postbus und saßen die nächsten sechs Wochen an einem Fleck in Vorarlberg oder Tirol fest. Dort habe ich das Bergwandern entdeckt, das bis heute zu meinen Hobbys zählt, auch wenn die Steigungen und Distanzen mit zunehmendem Alter sinken. Meist ging ich zusammen mit meinem Bruder Reinhard auf Tour. Die kleinste Gemeinde Österreichs ist Gramais im Lechtal. Die hatte damals 52 Einwohner, einen Traktor und ein Telefon. Reinhard und ich verließen uns auf einen kleinen Wanderführer, in dem die Touren beschrieben waren. Wir waren total heiß: Wenn da stand, es dauert für einen erfahrenen Bergsteiger acht Stunden bis zum Gipfel, dann wollten wir es in vier Stunden schaffen. Wir haben das weniger genusstechnisch betrachtet, sondern wollten nur die Schnellsten sein.
Solche Bergtouren habe ich auch noch alleine unternommen, als ich verheiratet war. Da bin ich zum Beispiel um zwei, drei Uhr morgens los und war bei Sonnenaufgang auf dem Gipfel. Als ich wieder abstieg, kamen mir die Ersten keuchend entgegen. „Ja, wo kommen Sie denn her?“ „Na, vom Gipfel.“ Das wurde mir nie geglaubt. Dann habe ich gesagt: „Also, gucken Sie doch im Gipfelbuch nach. Ich sitze in der Alpenrose und werde da jetzt mal ein schönes Bier trinken. Und wenn ich recht habe, bezahlen Sie meinen Deckel.“
Als wir älter wurden, wollten wir auch mal ans Meer. Ein einziges Mal konnten wir unsere Eltern zu einem Urlaub in Koksijde in Belgien überreden. Doch die Nordsee blieb eine große Ausnahme. Meinen Eltern war es zu anrüchig, da im Badeanzug rumzuhängen. Stattdessen lernte ich im Tiroler Örtchen Häselgehr im oberen Lechtal schwimmen – in einem Schwimmbad, durch das der Gebirgsbach floss. Es hatte bestenfalls 10 Grad Wassertemperatur.
Dann passierten zwei Dinge, die meinen Horizont wahnsinnig erweitert haben – und zwar in Richtung Westen. Das erste: Mein unglaublich frankophiler Lehrer Manfred Hoffmann stellte für uns im Mai 1968 eine Reise nach Paris auf die Beine. Ich war total begeistert, zumal wir sogar alleine losziehen durften. Ich habe ganz Paris zu Fuß erwandert, jedenfalls gefühlt. Heute noch kenne ich mich in Paris besser aus als die meisten Pariser. Behaupte ich. Damit war der Grundstein gelegt: Ich liebe Frankreich bis heute.
Allmählich wuchs auch mein Interesse an anderen Aspekten des Lebens. Wir waren jahrelang eine reine Jungenschule, dann wurden Ende der 60er-Jahre aber die ersten Mädchen eingeschult. Eine von ihnen war meine Schwester. Und in ihrer Klasse war ein ganz hübsches Mädchen, wesentlich jünger als ich: Melanie Madaus, die Tochter des Besitzers der Firma Madaus. Sie war für uns Jungs unglaublich. Die Mutter sah auch toll aus, fuhr ein Porsche-Cabrio und lieferte die Tochter morgens ab. Wir standen da mit offenem Mund.
So bekamen wir zum ersten Mal Kontakt zu Mädchen. Wenn wir andere Mädchen sehen wollten, gingen wir hin und wieder zur Genoveva-Schule. Das war ein reines Mädchengymnasium in unserem Stadtteil. Man konnte sich davor aber nicht lange herumtreiben, höchstens mal gucken. Wir gingen bevorzugt in die Eisdiele Dolomiti, wo auch öfter mal Mädchen aus der Genoveva-Schule saßen. Dort betätigten wir uns – bei Gauloises und Espresso – natürlich viel lieber intellektuell als in der Schule. Diese Freiheit hat uns unglaublich motiviert.
Und dann geschah Folgendes: An der Oberschule tauchte plötzlich eine englische Assistentin aus Liverpool auf, Ann hieß sie. Ich besuchte die Oberstufe, war gerade volljährig geworden, es war die Zeit von Minirock und Hotpants. Alle wollten auf der Treppe hinter Ann gehen. Mein Freund Raphael Wunsch hatte bereits das Studium der Anglistik in Köln begonnen. Ich war ja eher auf dem Frankreichtrip, Englisch interessierte mich höchstens so nebenbei, obwohl wir das Fach auch bei Manfred Hoffmann hatten.
Dann allerdings gab es eine Englisch-AG bei dieser Assistentin. Natürlich habe ich mich angemeldet. Bis zur Quarta waren meine Kopfnoten immer: Betragen „Sehr gut“, Beteiligung am Unterricht „Könnte reger sein“. Ab der Pubertät kehrte es sich um: Betragen „Nicht ohne Tadel“, das war ziemlich schlecht, aber Beteiligung am Unterricht „Sehr gut“. Wobei meine Beteiligung oft auch sehr frech und vorlaut war. Ich muss Ann wohl in der AG aufgefallen sein. Ich nehme mal an: wegen meines Humors.
Jedenfalls habe ich sie zu uns nach Hause eingeladen. Ich war zwischenzeitlich in den ausgebauten Keller gezogen, wo ich mein erstes eigenes Zimmer hatte. Meinen Freund Raphael Wunsch lud ich ebenfalls ein – mit der Idee, dass die beiden doch perfekt zusammenpassen würden. Bei dem Treffen kam aber heraus, dass sich meine Englischassistentin nicht für meinen Freund interessierte, sondern für mich. In der Schule war das natürlich eine Sensation, weil auch etliche Lehrer ein Auge auf Ann geworfen hatten. Die meisten waren zwar verheiratet, aber die jungen Sportlehrer waren hinter ihr her. Und jetzt war es ausgerechnet dieser etwas altmodische Richenhagen. Damals wurde man ja mit Familiennamen angesprochen. Richenhagen hatte also ein Verhältnis mit der Assistentin.
Zu Ann habe ich heute keinen Kontakt mehr. Sie hat mich irgendwann sitzen lassen. Wir hatten uns sehr gut verstanden, aber ich war damals noch der Meinung, dass Sex vor der Ehe nicht erlaubt ist. Für Petting war ich zu gewinnen, aber mehr habe ich mich nicht getraut. Ich glaube, das hat sie ein bisschen enttäuscht. Es gab ja auch einen Altersunterschied von vielleicht acht Jahren, so in der Größenordnung.
Was da im Keller lief, haben meine Eltern irgendwann doch mitbekommen, und das war mir sehr, sehr peinlich. Mein Vater reagierte ziemlich relaxt und interessierte sich nicht weiter dafür. Anders meine Mutter. Ich kann mich erinnern, dass Ann und ich uns mal vor der Haustür mit einem Kuss verabschiedeten. Da riss meine Mutter oben das Badezimmerfenster auf und rief runter: „Ihr seid aber noch nicht verlobt!“ Also die Idee, dass man ein Mädchen küsst, war für meine Mutter vollkommen abwegig.
Insgesamt hat auch diese Erziehung dazu geführt, dass ich ein Spätzünder war. Die 68er habe ich mitgenommen, aber mit leichter Verzögerung. Die Vorstellungen waren sehr liberal, Jungen und Mädchen waren gleichermaßen daran interessiert, sich auszuleben. Diese Chance habe ich gehabt. Ich glaube, meine Ehe ist deshalb so stabil, weil ich nicht den Eindruck habe, ich müsste irgendetwas nachholen. Das war eine Zeit, über die man sagen muss: Schade, dass die jungen Leute sie heute nicht erleben. Die Pille war erfunden, Aids aber noch kein Thema. Überall Happenings und Protest, alles war in Aufruhr, alles kam auf den Prüfstand, freie Liebe war das Ideal.
Mitten im Kölner Zentrum gab es diesen „Neumarkt der Künste“, eine Gegenveranstaltung zur Kunstmesse, die vielen kurz nach ihrer Eröffnung bereits als zu kommerziell und elitär galt. Es war wohl im Oktober 1970, da hatte Joseph Beuys dort einen großen Tisch für ein öffentliches Abendessen aufgebaut. Und ich ging hin. Dabei turnten zwei nackte Kinder über den Tisch, und Beuys hielt einen flammenden Vortrag, dass alles Kunst ist. Allerdings kritisierten andere schon zu dieser Zeit, Beuys sei inzwischen selbst Teil des Establishments.
Im Mai 1968 war auch die besagte Klassenreise nach Paris. Wir fuhren also direkt in die Pariser Revolte, mitten ins Epizentrum der Studentenunruhen. Untergebracht waren wir in einer Art Jugendherberge im Quartier Latin. Es gab für uns ein paar offizielle Veranstaltungen, aber ansonsten durften wir uns ziemlich frei in der Stadt bewegen. Also haben wir mitdemonstriert. Es gab Sprüche, die ich nie vergessen werde. „Sous les pavés, la plage!“ Also: „Unter dem Pflaster ist der Strand“, denn diese Pariser Pflastersteine waren in Sand gebettet. Das fiel in dem Moment auf, als man sie massenhaft zu Barrikaden auftürmte.
„Wählen ist wie gegen den Wind pissen“ – das war noch so ein Spruch, für den wir uns begeistert haben. Einmal bin ich mit meinen Klassenkameraden bei einer Demonstration verhaftet worden. In einer kleinen Straße kamen Polizisten von beiden Seiten. Wir wurden in die Citroën-Kastenwagen der Polizei verfrachtet, Wellblechautos, die Franzosen nannten das „transport de viande“, also Fleischtransport. Das fanden wir natürlich enorm spannend. Man muss zugeben: Die französischen Polizisten, die „flics“, handelten sehr geschickt: Wir wurden eine Stunde nach Norden aus Paris rausgefahren, wo wir buchstäblich am Arsch der Welt waren. „So, jetzt könnt ihr gehen“, hieß es dann. Man brauchte quasi den ganzen Tag, um es per Anhalter zurück in die Innenstadt zu schaffen.
Ich persönlich habe durch die ganzen Erlebnisse eine große Begeisterung entwickelt – für Paris im Besonderen und für Frankreich insgesamt. Manfred Hoffmann, unser Lehrer, hat später noch eine zweite sensationelle Reise organisiert. Die gesamte Klasse, es muss in der Zwölf oder Dreizehn gewesen sein, wurde für ein paar Wochen zu einem Austausch in eine kleine Privatschule bei Paris geschickt, Cours Sévigné hieß sie. In diesem Vorort von Paris, Asnières-sur-Seine, wohnten wir auf der Rückseite eines Sportstadions, praktisch in den Mannschaftsräumen. Und sind jeden Tag ganz normal in die Schule gegangen.
Wir waren ziemliche Rabauken zu der Zeit. Das kleine Gymnasium hatte eine sehr strenge Direktorin. Einmal sagte sie zu mir, weil ich mich danebenbenommen hatte: „Prenez la porte!“ Also: „Raus!“ Ich habe es bewusst falsch verstanden, die Tür aus den Angeln gehoben und sie der Lehrerin übergeben. Wortwörtlich übersetzt heißt es ja: „Nehmen Sie die Tür!“ Wir haben viel Blödsinn gemacht, aber auch extrem viel gelernt – und das Land in unser Herz geschlossen. Obwohl ich in Amerika lebe, werde ich für mein Französisch immer gelobt. Ich habe keinen Akzent. Wenn ich in Frankreich bin, komme ich schnell wieder rein in die Sprache. Im Französischen wollte ich unbedingt perfekt sein, anders als im Englischen. Auch die Umgangssprache, also Argot, kann ich bis heute.
Ich liebe Frankreich. 1975 habe ich ein Jahr lang als Austauschlehrer in dem Land gearbeitet. Auch wollte ich immer unbedingt eine Französin heiraten – und habe das mehrmals erfolglos versucht, wie das Leben so spielt. Heute bin ich Deutscher und Amerikaner, aber wenn man mich fragt: Franzose wäre für mich eine attraktive Alternative. Die Lebensart liegt mir.
Diesen französischen Ansatz, dass man morgens erst einmal ins Bistro geht, Kaffee trinkt und ein Croissant isst, den schätze ich sehr. Bei mir stellen sich sofort viele schöne Erinnerungen ein: Eine befreundete Familie etwa, der Vater war Tiermediziner und Professor in Maisons-Alfort bei Paris, hatte so ein Schlösschen geerbt an der Loire. Für uns Deutsche mit perfektionistischem Anspruch wäre es fast unerträglich, etwas in dem Zustand überhaupt zu besitzen. Man würde sagen: Bruchbude, zu großes Risiko. Die Deutschen setzen immer alles super instand, die Franzosen haben eine leichtere Gangart. Die lassen das Ding stehen, daran wird nichts gemacht, außer wenn es wirklich massiv durchregnet. Renovieren – wieso denn? Dann trifft sich dort die Familie am Wochenende, jeder bringt was mit und es wird erst einmal gekocht. Später wird ein Zimmer zugeteilt, man schläft in Bettwäsche, die wahrscheinlich schon über ein halbes Jahr lang von anderen Menschen benutzt worden ist. Keiner stört sich daran.
Ein weiteres Erlebnis hat mich sehr für Frankreich eingenommen: Abitur habe ich zu Ostern gemacht, aber erst im Oktober konnte man anfangen zu studieren. Ich interessierte mich für ein Medizinstudium in Bonn, aus dem einfachen Grunde, weil ich gerade so den Numerus clausus geschafft hatte. Um die Zeit zu überbrücken, bin ich als zukünftiger Medizinstudent für mehrere Wochen zu einer Gastfamilie nach Lille in Nordfrankreich gezogen.
Es war eine sehr eigenwillige Familie, streng katholisch, zehn Kinder. Der Vater war Unternehmer, er hatte eine Weberei. Ich kann mich erinnern, dass die abends alle in großer Runde zusammen aßen. Der Großvater, die Oma, die Eltern, die Kinder – alle saßen da. Es war eine klassische, traditionelle Familie, in der die Kinder ihre Eltern siezten. Ich duzte alle, aber die siezten sich untereinander. Und dann fragte der Großvater: „Wer ist dieser junge Mann?“ Die Tochter Annick antwortete: „Das ist unser Austauschschüler aus Deutschland.“ Daraufhin hat der Großvater mich rausgeschickt, ich musste in der Küche essen. Der Opa war also kriegsgeschädigt und ein Deutschenhasser.
Jetzt kam es aber so: Die Kinder waren in der Schule und ich hielt mich viel im Haus auf. Die hatten eine tolle Köchin. Bei ihr habe ich viele Dinge gelernt, zum Beispiel wie man eine Leberpastete macht. Alle möglichen französischen Gerichte habe ich mit ihr gekocht, und nach ein paar Tagen hatte der Opa gemerkt, dass ich vielleicht doch kein großer Nazi bin. Er kam zu mir und sagte: „Komm mal mit.“ Und dann ging er mit mir in den Keller, um den Wein auszusuchen. Er wollte mal gucken, was ich vorschlage. Er hatte einen riesigen Weinkeller und dieses Weinholen wurde eine tägliche Übung. Mit der Zeit entstand mit dieser Familie eine Freundschaft über alle Generationen hinweg.
Und noch etwas entstand: nämlich der Gedanke, dass Medizin eigentlich das falsche Studium ist. Meine neue Idee: Ich studiere Romanistik – also Französisch und Italienisch. Mir war auch sofort klar, was ich als Nebenfach wählen wollte, nämlich katholische Theologie, um meiner Familie zu Hause mal fundiert Kontra geben zu können. Und als drittes Fach wegen fehlender Frömmigkeit: Philosophie. Ich dachte: Wenn du Philosophie und Theologie studierst, kannst du den alten Säcken mal richtig erklären, was Sache ist. Dann können die nicht mehr sagen: „Du hast keine Ahnung.“ So habe ich das auch gemacht. Bonn als Studienort der Wahl blieb allerdings. Allzu weit bin ich im ersten Schritt nicht von der Bruder-Klaus-Siedlung weggekommen.
Zunächst gab es auch noch ein anderes Problem: den Wehrdienst. Ich wollte nicht zur Bundeswehr und damals war eine Kriegsdienstverweigerung nicht ganz alltäglich. Die Gewissensentscheidung wurde streng überprüft. Da gibt es einen schönen Song von Franz Josef Degenhardt, „Befragung eines Kriegsdienstverweigerers durch den liberalen und zuvorkommenden Kammervorsitzenden“, heißt es darin ironisch. Und genau so war es.
Man musste erstens alles schriftlich begründen. Zweitens musste man Zeugen benennen und drittens mussten diese noch schriftlich Stellung nehmen. Mein Onkel, der Militärdekan, ging für mich als einer meiner Zeugen in die Bütt. Er sagte, dass die Kriegsdienstverweigerung, kurz KDV, für mich ein ernstes Thema sei. Im Anschluss stand mir ein richtiges Verfahren bevor, das sich wie ein kleiner Gerichtsprozess anfühlte, in dem ich mich und meine Haltung verteidigen musste. Es kam zu den typischen Fragen, wie im Degenhardt-Song: „Sie sitzen auf einer Parkbank mit Ihrer Freundin, haben zufällig eine Maschinenpistole in der Tasche, und dann kommt einer und vergewaltigt Ihre Freundin. Was machen Sie jetzt?“ Auf solche Fragen musste man sich sorgfältig vorbereiten, damit die Argumentation nicht über einen Flüchtigkeitsfehler zusammenbrach. In der Kirche gab es dafür extra Schulungsmaßnahmen, richtige Kurse zur Vorbereitung auf die Gewissensprüfung.
Meine Ablehnung des Soldatischen ist familiär bedingt. Mein Vater war überzeugter Pazifist. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war er zu jung, um für einen Fronteinsatz infrage zu kommen. Ganz zum Schluss ist er in den Arbeitsdienst eingezogen worden und musste irgendwo im Emsland Torf stechen, wobei er sich einen lebenslangen Lungenschaden und schweres Asthma geholt hat. Während mein Vater das Militär absolut ablehnte, ging mein Onkel Gottfried, der Militärdekan, in die entgegengesetzte Richtung. So kam es zu Hause immer wieder zu Diskussionen. Ich war aus eigener Anschauung der Meinung, dass Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen kein Werkzeug der Politik mehr sein sollten, und habe das dann auch so vertreten.
Als der berüchtigte Brief im Postkasten lag, die Aufforderung zur Musterung, habe ich nicht gezögert. Sofort, noch vor dem Musterungstermin, stellte ich den KDV-Antrag. So wurde ich natürlich auch gleich als „voll tauglich“ eingestuft. Die Amtsärzte haben mich gar nicht groß untersucht. Wahrscheinlich war ich aber tatsächlich voll tauglich.
Die Gewissensprüfung habe ich bestanden, meine Urkunde „Anerkannter Kriegsdienstverweigerer“ bewahre ich bis heute auf. Damals hatte ich die Wahl: Entweder wurde man für achtzehn Monate am Stück zum zivilen Ersatzdienst eingezogen oder man machte etwas anderes Soziales über einen längeren Zeitraum, aber nicht jeden Tag. Ich verpflichtete mich für zehn Jahre beim Deutschen Roten Kreuz. Man musste über die Dekade so und so viele Stunden ableisten, etwa über Wochenenddienste. Ich wurde Fahrer des Küchenwagens der Bereitschaft 4G.
Wir waren relativ berühmt, denn wir hatten einen Metzgerssohn bei uns in der Truppe. Wenn wir mit der Gulaschkanone irgendwohin mussten, sind wir zuvor an der Metzgerei vorbeigefahren. Wir haben privat die ganzen Wurstreste geholt, im Kessel gekocht, die Erbsensuppe obendrauf und schon mal alles ein bisschen brutzeln lassen. Das dürfte man heute auch nicht mehr. Aber so kamen wir mit der besten Erbsensuppe zum Rosenmontagszug oder wo immer man so hinfuhr. Wir waren auch in der Lage, Hunderte von Sechsminuteneiern zu kochen. Die wurden fein säuberlich in ein Plumeaulaken gestapelt und dann mit einem Besenstiel – hau ruck – in das kochende Wasser gelassen und nach der entsprechenden Zeit wieder rausgeholt. Fertig.
Es gab Dinge, die beim Roten Kreuz niemand machen wollte, die ich aber hochspannend fand. Vermutlich ist es heute nicht mehr so, aber damals saß in jeder Theateraufführung, bei jeder Oper, Museumseröffnung und sogar Vernissage immer jemand von der Feuerwehr und auch einer vom Roten Kreuz. Die Kollegen der Bereitschaft interessierten sich mehr für den 1. FC Köln oder solche Einsätze. So habe ich während der Dienstzeit ein tolles Kulturprogramm gehabt. Viel gesehen, eine sehr solide Ausbildung in Erster Hilfe bekommen und nebenbei noch gelernt, wie man mit einer Gulaschkanone viele Leute satt machen kann. Dem Militärdekan Gottfried sei Dank.
Mein Patenonkel Martin, Professor für Theologie, hat sich eher wenig um mich gekümmert. Dennoch aber hat er entscheidende Dinge in meinem Leben beeinflusst. Von ihm habe ich mein erstes Fahrrad bekommen und die erste Armbanduhr. Mit ihm bin ich zum ersten Mal in einer Pizzeria gewesen. Der war sehr fortschrittlich. Einmal durfte ich ihn in der Karwoche begleiten, er saß mit seinen Studenten am großen Tisch, es wurde zu Abend gegessen. Und da wurde so nebenbei die Ostermesse gefeiert, ganz salopp. Das war für mich sehr beeindruckend. Und der kam dann und sagte: „Martin, ich habe ja nie so viel für dich getan. Hier ist die Anschrift meiner Buchhandlung.“ Das war die Buchhandlung Bierbaum in Düsseldorf. „Und da kannst du alle Bücher bestellen, die du haben willst. Ich bezahle alles. Die schicken mir eine Rechnung, brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen.“ Das führte dazu, dass ich fast nie in der Unibibliothek war. Die Literaturlisten habe ich in die Buchhandlung rübergefaxt, dann bekam ich meine Buchpakete mit der Post. Auch im privaten Bereich konnte ich alles bestellen. Ich habe die komplette Böll-Ausgabe, mein Onkel hat mir alles finanziert. Das war natürlich Luxus. Meinem Onkel Martin sei Dank.
Der Name Martin wird in unserer Familie in Ehren gehalten. Mein Patenonkel hieß so, weil dessen Onkel, also der Bruder meiner Großmutter väterlicherseits, ein gewisser Martin Engels war. Er war ein Benediktinermönch, der sich in eine junge Ärztin oder Apothekerin in Bayern verliebt hatte. Daraufhin beschloss er, sich laisieren zu lassen, er legte also alle klerikalen Rechte und Pflichten ab. Das war nach dem Krieg und ein Riesenthema. Also Martin Richenhagen, der Ex-Mönch. Mein Patenonkel war der zweite, ich bin der dritte. Ich habe einen Sohn, der heißt ebenfalls Martin. Und der hat wiederum einen Sohn, der auch so heißt – Martin junior. Spitzname M. J., wie man das hier in Amerika gerne macht.
Mein Vater hat sich auch nach dem Abitur um mich gekümmert und mich sogar beim Antrittsbesuch an der Universität Bonn begleitet. Dort gefiel es mir auf Anhieb, Romanistik und Theologie waren im Hauptgebäude untergebracht. Meine Mutter wollte, dass ich zu Hause wohnen bleibe und von dort aus immer nach Bonn fahre. Aber die Pendelei hatte schnell ein Ende, ich zog aus. Im Studentenwohnheim lebte ich viele Jahre auf demselben Flur wie Norbert Walter-Borjans, der heutige SPD-Chef, der in Bonn VWL studierte. Der Wohnturm war 1973 in Bonn-Tannenbusch gebaut worden, ein Betonhochhaus, genannt Tabu. Eigentlich superklasse ausgestattet und daher sehr begehrt. Alle Zimmer waren bereits vergeben, bis auf das Erdgeschoss, wo laut Plan nur Männer wohnen sollten. Es gab eine Ausschreibung und wir stellten uns nachts nach unserem Kneipenbesuch in die Schlange vor dem AStA-Studentenwerk. Ich kam auf die Idee, dass wir uns in eine Liste eintragen sollten, um die Reihenfolge des Anstehens festzuhalten. Als morgens die Türen öffneten, gab es einen Riesentumult. Wir hielten uns erst zurück, legten den Leuten dann aber die Liste vor – und tatsächlich wurden in dieser Reihenfolge die Zimmer vergeben. Walter-Borjans war, soweit ich weiß, Nummer 14, ich war Nummer 12. Wir sahen uns dann regelmäßig in der Küche, manchmal auch in der Kellerbar, die ein paar Mädels aufgemacht hatten. Ich hatte da einen kleinen Heimvorteil: Die Bar befand sich direkt unter meinem Zimmer. Als Entschädigung für den Lärm bekam ich jeden Abend ein Freibier.
In Bonn hatte ich auch ganz schnell die erste ernsthafte Beziehung. Das war für mich unglaublich, weil ich auch nach der Geschichte mit der Assistentin Ann gedacht hatte, mich würde sowieso keine haben wollen. Ein sehr hübsches Mädchen, das auch Romanistik studierte und Germanistik. Friederike war die Tochter eines Landmaschinenhändlers vom Niederrhein: Agrartechnik Dröppelmann in Geldern-Pont. Ich habe zu ihr und zu ihrem Bruder noch immer Kontakt.
An der Uni habe ich alles Mögliche mit Begeisterung studiert, vieles so am Rande, indem ich einfach hinging. Ich baute mir eine Art Studium universale zusammen. Bei Alfred Gütgemann habe ich eine Vorlesung zu Herzchirurgie gehört. Auch Psychologie habe ich mal zwei Semester besucht, um jedoch festzustellen, dass zu viele Studenten damit befasst waren, ihren eigenen Fall zu lösen.
Schon bald wurde mir klar: Lehrer wollte ich überhaupt nicht mehr werden – das war ja bei meinen Fächern der eigentlich vorgezeichnete Weg. Trotzdem bewarb ich mich bei einem Gymnasium in Frankreich und wurde dort 1975 für ein Jahr Assistent. Der Grund war vielleicht auch, dass das zu Hause ganz gut ankam.
Ich wollte gerne nach Aix-en-Provence ziehen – im Wesentlichen wegen der Lebensqualität. Stattdessen wurde ich aber nach Maubeuge ins regenreiche Département Nord verfrachtet. Durch dieses Jahr als Assistent an der Schule wurde mein späteres Referendariat verkürzt auf ein Jahr, sodass ich etwas Zeit aufholen konnte. Denn ich habe wirklich lange studiert, achtzehn Semester oder so. Heute würde man sagen: Bummelstudent. Aber damals gab es eine andere Einstellung. Mein Vater hat immer gesagt: „Das ist die beste Zeit deines Lebens. Solange du studieren kannst, mach das ruhig.“ So sah ich das auch.
Meine Beziehung zu Friederike war schon vor meinem Umzug nach Frankreich beendet – und das kam so: Beide hatten wir keine Lust mehr, Lehrer zu werden, und dachten uns, wir werden Journalisten. Bei der Bonner Rundschau absolvierte ich unter Rüdiger Durth eine Hospitanz, der Beruf gefiel mir. Meine Freundin und ich bewarben uns beim Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses, eine katholische Einrichtung, getragen von der Deutschen Bischofskonferenz. Wir gingen gemeinsam hin und ich kann das heute gut nachvollziehen: Sie haben meine bildhübsche Freundin genommen und mich nicht. Ich war denen vielleicht sogar noch zu wenig katholisch oder was auch immer.
Meine Freundin hat mich für einen evangelischen Theologen verlassen, Helmut Keiser, der auch einen unternehmerischen Touch hatte und später das erste lokale Privatfernsehen in Bonn gegründet hat. Ich bin noch ein bisschen in Richtung Journalismus weitergegangen, habe beim WDR-
Rundfunk als Produktionsassistent gearbeitet, also MAZ-Bänder in die Studios gebracht und auch mal den Kabelträger gemacht. Das wurde sehr gut bezahlt. Außerdem fing ich an, Reitsportartikel zu schreiben. Mit sechs Kommilitonen hatte ich neben dem Studium einen Reitverein gegründet. Mit diesem Club hatten wir immer extrem gute Presse, im Wesentlichen deshalb, weil ich die vor Lob strotzenden Texte unter einem Pseudonym selbst geschrieben hatte. Also juristisch oder ethisch vielleicht nicht ganz vertretbar, aber verjährt.
Die Lust auf Journalismus ließ irgendwann nach. Zumal ich auf die Idee kam, mir ein wirklich solides finanzielles Standbein zu schaffen – und als Assistent am Lehrstuhl zu arbeiten. So hatte ich zwei Säulen für meine Finanzierung als Student. Das eine waren die Reitstunden. Das andere war mein Job als wissenschaftliche Hilfskraft am Neutestamentlichen Seminar der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn. Mein Chef hieß Professor Heinrich Zimmermann, ein absoluter Experte vor allen Dingen im Bereich der Christologie.
Diese Unitätigkeit hatte nur Vorteile: Ich bekam ein kleines Büro im Hauptgebäude, konnte dort rein und raus, wie ich wollte, und ich hatte ein Telefon. Damit konnte ich zwar nur Ortsgespräche führen, aber das war schon einmal ganz toll. Ich konnte an der Uni sein und studieren und in der Zeit zwischen Vorlesungen und Übungen durfte ich in mein eigenes Zimmerchen gehen und arbeiten. Das war ein enormer Luxus. Dazu kam mehr oder weniger zufällig ein weiteres Plus: Die Universität hatte eine Tiefgarage gebaut, unter der Hofgartenwiese. Es wurden auch an Studenten Parkplätze verlost, und ich hatte das Glück, auf diese Weise einen zu ergattern. Ich fuhr damals schon, weil das mit dem Reitsport ganz gut funktionierte, einen Mercedes-190D-Jahreswagen und parkte neben dem einen oder anderen Professor. Die waren immer ganz beeindruckt: „Junger Mann, was haben Sie denn da für ein Auto?“ Es war dunkelblau und sah aus wie neu.
Die Assistententätigkeit wurde auch ordentlich bezahlt: Da verdiente man 1200 D-Mark im Monat. Was man dafür machen musste, war überschaubar: Im Wesentlichen für den Professor Literatur recherchieren, seinen Forschungen zuarbeiten und Dinge fotokopieren. Zimmermann war ein sehr weltfremder Theologe, aus seinem Büro guckte man gegenüber auf die Konditorei Müller. Wenn der Professor einen guten Tag hatte, wurde ich losgeschickt und musste Hefeteilchen kaufen, die er dann seinem Team spendierte.
Eines Tages wurde die Bäckerei geschlossen, und wie es der Zufall so will, eröffnete stattdessen in dieser doch erstklassigen Lage ein Dr.-Müller-Sexshop. Und dann stand Herr Professor Zimmermann am Fenster und sagte: „Herr Richenhagen, Sie kennen doch den Bäckermeister Müller.“ „Ja, den kenne ich.“ „Ist doch erstaunlich, dass der in seinem hohen Alter noch promoviert hat.“ Vielleicht wollte er mich ja auf den Arm nehmen. Die Hefeteilchen mussten wir nun jedenfalls woanders organisieren.
Bonn war damals ja ein Kaff. Da gab es Politiker, aber nicht so viel Wirtschaft. Im Grunde beschränkte es sich auf Politiker und Studenten. Uns Studenten zog es in eine legendäre Künstlerkneipe: die Kerze, in der Königstraße. Die war auch deshalb besonders attraktiv, weil man dort bis spät in die Nacht für 5 D-Mark Spaghetti bolognese essen konnte. Die normale Übung war, dass man in der Kerze versackte und von da aus zur Markthalle fuhr. Dort konnte man anschließend wunderbar auf dem Großmarkt frühstücken – noch vor Sonnenaufgang.
In der Kerze gab es – ich glaube, es war immer donnerstags – eine Skatrunde: Richard Stücklen, Franz Josef Strauß und Herbert Wehner. Zwei stramme CSUler und dazu ein beinharter Sozialdemokrat. Die drei hätte man so gar nicht zusammenkombiniert, aber sie spielten da Skat. Und wenn einer fehlte, wurde man schon mal rekrutiert. Es kam der Ruf: „Wer macht hier mit? Wir brauchen einen dritten Mann!“ Das habe ich hin und wieder mal gemacht. Man wurde als Student aber total ausgenommen, weil die zwei Politiker sich immer super verstanden. Und der arme Student schmierte ab.
Sie spielten immer um Geld und es war interessant: Wenn der Wehner gewonnen hatte, kassierte er die Kohle, fertig. Bei Strauß war es total anders. Wenn man verloren hatte, kam der Fahrer diskret mit einem Umschlag. Der enthielt eine aufgerundete Summe, die man quasi zurückerstattet bekam. Dafür durfte man sich aber nicht bedanken, weil der Strauß nicht wollte, dass seine Kollegen das wussten. Für mich hat Skat nie eine große Bedeutung gehabt. Ich war erstens kein besonders guter Skatspieler und zweitens bin ich überhaupt kein Spielertyp.
Aber Bonn war so ein Pflaster, da konnten normale Menschen ganz einfach Politiker treffen, wenn sie Spaß daran hatten. Natürlich war die Nähe für uns aus einem anderen Grund wichtig: Als wir mit den Studentenreitern anfingen, immer größere Reitturniere zu veranstalten, waren wir heiß darauf, dass wir Politiker als Schirmherren hatten oder als Ehrengäste.
Der Reitsport nahm schon zu meinen Bonner Zeiten einen immer größeren Stellenwert bei mir ein: Ich habe neben dem Studium eine Sonderbegabtenprüfung zum Pferdewirt gemacht. Ich durfte als einer von wenigen diesen Weg gehen, weil ich zuvor schon als Berufsrichter im Dressursport tätig war, in ungewöhnlich jungen Jahren also. Diese Prüfung nennt sich auch Bereiterprüfung – es ist praktisch die Gesellenprüfung im Reitsport. Wer Reitlehrer werden will, muss sie bestehen. Das hat auch ein bisschen Zeit gekostet, aber es war mir extrem wichtig. Mein Staatsexamen lief verglichen damit fast nebenher, der Abschluss klappte relativ reibungslos. Irgendwann dachte ich: Och, jetzt mach mal Prüfung. Und damit war die Studienzeit unspektakulär zu Ende.
Nach dem Examen stellte sich die Frage: Sollte ich jetzt Referendardienst machen oder nicht? Ich überlegte: Journalismus würde es ja nun doch nicht. Da blieb erst mal nur Lehrer. Und wenn man etwas halb fertig hat, soll man es besser beenden. Nach dem Motto „Erstes Staatsexamen ist gut, Zweites ist besser“ trat ich also den Referendardienst an, es war ja dank meiner Zeit in Frankreich nur noch ein Jahr. Also ran. Mein Studienseminar lag in Siegburg bei Bonn. Nicht weit entfernt, in Heister, betrieb ich Ende der 70er-Jahre einen Reitstall, wo ich auch während meines Referendardienstes noch Reitunterricht gab.
Fortan führte ich ein Doppelleben. Unter meiner Hose hatte ich immer schon die Reithosen an, weil ich vom Seminar in Siegburg wieder schnell in den Stall musste, um zu arbeiten. Das hat alles ganz gut funktioniert – und ich habe 1980 mein Zweites Staatsexamen gemacht. Damals war es schwer, gleich im Anschluss Lehrer zu werden. Es gab die berühmte „Lehrerschwemme“, selbst im Bundestag warnte man in den 80er-Jahren schon vor dem „akademischen Proletariat“. Ich habe mir gesagt: Bewirb dich mal, man weiß ja nicht. Und dank meiner Fächerkombination war ich ruckzuck Studienrat am Gymnasium in Frechen. Im Jahr 1983 war ich schon Beamter auf Lebenszeit und auf dem Sprung zum Oberstudienrat. Die Karriere nahm ihren berechenbaren Lauf. Genau das, was ich nie wollte.
Das Verhältnis zu meinen Schülern war durchweg gut. Von meinem Mercedes war die Anhängerkupplung nicht wegzudenken. Mit dem Pferdeanhänger kam ich auch schon mal in die Schule. Dann stand das Pferd wartend auf dem Parkplatz, während ich Unterricht gab, denn danach mussten wir schnell aufs Turnier. Alle pferdesportbegeisterten Mädchen hatte ich auf diese Weise schon auf meiner Seite.
Nachdem ich eine Weile dabei war, stellte ich fest: Eigentlich war ich doch gerne Lehrer. Ein Vorteil: Der Beruf war abwechslungsreich. Die meisten Lehrer interessierten sich nicht dafür, irgendwo einzuspringen, aber ich habe das immer gerne gemacht. So gab ich auch mal Latein, mal Englisch oder Geschichte, Kunst oder Musik. Ich machte mich zugleich beliebt im Kollegium, indem ich bereitwillig der Lückenbüßer war.
Auch in meiner eigenen Schulzeit fand ich es immer blöde, wenn in Vertretungsstunden nichts unternommen wurde. Als Lehrer habe ich öfter meine Gitarre in die Klassen mitgenommen. Einmal, das muss 1984 gewesen sein, als der junge Grünen-Politiker Joschka Fischer seinen berühmten Ausspruch gemünzt auf Bundestagspräsident Richard Stücklen gemacht hatte, da war wieder Liederstunde. Am beliebtesten war der Song Scheiße in der Lampenschale und den habe ich mit der Klasse gesungen. Kurz darauf bekam der Direktor einen Brief eines Vaters, der Rechtsanwalt war, mit der Frage, ob denn der junge Kollege der Meinung sei, dass das Wort „Scheiße“ Teil des deutschen Kulturguts sei.
Der Direktor, Hubert Telöken, war Westfale. Er mochte mich, das hatte ich schon früher gespürt. Zum Beispiel trug ich damals immer Holzclogs, die hinten geschlossen waren wie normale Schuhe. Clogs und Jeans. Ich war auf den Gängen der Schule nicht zu überhören, was nicht unbedingt günstig war, wenn ich zu spät kam. Der Direktor hatte mich schon deswegen zur Seite genommen: „Herr Richenhagen, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder kaufen Sie ein paar andere Schuhe, sodass ich nicht höre, wenn Sie zu spät über den Flur galoppieren – oder Sie kommen pünktlich.“ Ich hatte zu dem ein vernünftiges Verhältnis.
Er gab mir nun diesen Brief des Rechtsanwalts zur Beantwortung. Ich schrieb zurück: „Sehr geehrter Herr Sowieso. In Zeiten, wo Herr Fischer im Bundestag sagt – Zitat – ‚Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch‘, da gehört auch das Wort ‚Scheiße‘ zum deutschen Kulturgut. Mit freundlichen Grüßen ...“
Dann meldeten diese Eltern sich für den Sprechtag an. Die Tochter hieß Bettina. Und ich dachte: Jetzt haste aber richtig Ärger. Aber dann waren die extrem nett und sagten, ihre Tochter sei ja so begeistert von mir und habe noch nie so viel Spaß am Religionsunterricht gehabt. Aber auch Französisch würde jetzt funktionieren. Und im Übrigen hätten sie ja gehört, ich sei ein Pferdefreund, und sie bräuchten ein Pferd für ihre Tochter. Da habe ich denen auch noch ein Pferd verkauft.
Es wurden zu der Zeit Dinge gemacht, die man heute vielleicht nicht mehr vertreten würde. Meine Frau zum Beispiel studierte Geografie und Sport. Ich hatte samstagmorgens zwei Stunden Religion, wollte an dem Tag aber unbedingt einer Reitverpflichtung nachgehen. Zu den Schülern habe ich gesagt: „Also, am Samstag habt ihr richtig Glück. Da kommt eine junge Referendarin, die macht den Unterricht – und seid nett zu der.“ Und dann hat meine Frau die zwei Stunden Unterricht gemacht. Die war weder Lehrerin oder Angestellte der Schule, noch wusste jemand, dass sie da vor der Klasse saß. Das würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Oder präziser: Wie kann man so wahnsinnig sein?