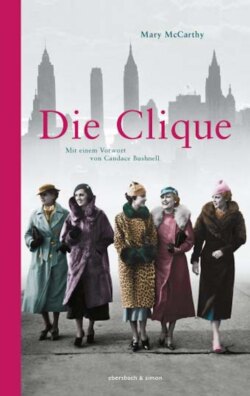Читать книгу Die Clique - Mary McCarthy - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VORWORT
Оглавлениеvon Candace Bushnell
Ich war noch ein Teenager, als meine Mutter mir empfahl, Die Clique zu lesen. Sie wusste, dass ich Schriftstellerin werden wollte, und gab mir häufig Bücher von zeitgenössischen Autoren, wobei »zeitgenössisch« in diesem Fall heißt: Anfang 19. Jahrhundert bis etwa Mitte der Siebzigerjahre. Flannery O’Connor, Anaïs Nin, Edith Wharton, Ayn Rand. Und Mary McCarthy. Ich verschlang O’Connor, Nin, Wharton und Rand. Mit McCarthy tat ich mich schwer. Ihre Heldinnen überzeugten mich nicht, was keineswegs überrascht, wenn ich heute zurückschaue. Fast alle bedeutenden literarischen Werke erreichen Jugendliche nicht, weil diese nicht über die notwendige Lebenserfahrung verfügen, um die Enttäuschungen und Frustrationen der Erwachsenen nachempfinden zu können. Und so legte ich Die Clique beiseite. Es sollte 18 Jahre dauern, bis ich sie wieder hervorholte.
Für meine Mutter indes war Die Clique das prägende Buch ihrer Generation: Sie war Jahrgang 1930 und die Erste überhaupt in unserer Familie, die ein College besucht hatte – Mount Holyoke, eins der renommierten Seven Sisters Colleges, zu denen auch Vassar und Smith gehören. Die Clique erschien 1963 in den USA, mitten in einer Zeit tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels: John F. Kennedy war gerade ermordet worden, die Hippies predigten die freie Liebe, und der Vietnam Krieg tobte bereits seit vier Jahren. Der Mythos der friedlichen, familienorientierten Fünfzigerjahre, als die heitere Hausfrau mit Schürze und Stöckelschuhen ihren adretten Göttergatten noch mit einem Cocktail auf der Schwelle empfangen hatte, geriet zunehmend ins Wanken. Soeben war das Buch The Feminine Mystique (USA 1963, dt. Der Weiblichkeitswahn, 1966) von Betty Friedan erschienen, basierend auf der Auswertung eines Fragebogens, den Friedan auf der Feier zum 15-jährigen Examens-Jubiläum des Smith Colleges an zweihundert ihrer ehemaligen Studienkolleginnen verteilt hatte. Das Ergebnis bewies, dass viele Frauen unzufrieden waren mit ihrem Leben und den durch Ehe und Mutterschaft erheblich eingeschränkten Entfaltungsmöglichkeiten, was Friedan als »das Problem, das keinen Namen hat« bezeichnete. Der Zeitpunkt für die Publikation der Clique hätte perfekter nicht sein können: Wie die realen Frauen aus Friedans Buch litten auch die acht Heldinnen aus der Clique unter dem »Problem, das keinen Namen hat«. Die Frauen-Generation der Sechzigerjahre identifizierte sich mit ihnen und so konnte sich Die Clique zwei Jahre lang auf der Bestseller-Liste der New York Times behaupten.
Wenn ich heute zurückschaue, drängt sich mir die Frage auf, ob meine Mutter und ihre Freundinnen durch die Lektüre der Clique mit ihrer eigenen latenten Unzufriedenheit über ihr Hausfrauendasein konfrontiert wurden. Was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass meine Mutter und ihre beste Freundin zwei Jahre nach Erscheinen des Buches ihre eigene Firma gründeten, sehr zum Unwillen ihrer Ehemänner. Auch wenn man einem solchen Schritt heute keine besondere Bedeutung mehr beimessen würde, in unserem Haushalt galt dies damals als regelrechte Revolution. Doch meine Mutter blieb unerbittlich, und genau zur selben Zeit, im Alter von acht Jahren, beschloss ich, Schriftstellerin zu werden.
Mitte der Neunzigerjahre, als ich die Sex and the City-Kolumnen für den New York Observer schrieb, brachte meine Agentin den Vertrag für meinen ersten Roman unter Dach und Fach. Als ich meiner ehemaligen Herausgeberin davon erzählte – eine der wenigen Frauen, die beim Observer gearbeitet hatten –, schlug sie spontan vor: »Du solltest die moderne Version von Die Clique schreiben!« Auf dem Heimweg kaufte ich mir eine Ausgabe des Buches und las es innerhalb von zwei Tagen nochmals durch. Das, was mit siebzehn keinerlei Sinn für mich gemacht hatte, kam jetzt, mit fünfunddreißig, einer erstaunlichen Offenbarung gleich. Hier fanden sich authentische, klar konturierte Charaktere, mit denen man sich identifizieren konnte: idealistische junge Frauen Anfang zwanzig, die mit den ungeahnten Nöten und Wonnen des »wahren Lebens« konfrontiert wurden. Auch wenn freilich jede Generation von Frauen für sich in Anspruch nimmt, vor völlig neuen Herausforderungen zu stehen, die sich aus ihrem Status als moderne Frauen in der Gesellschaft ergeben, so zeigt uns Die Clique doch, dass sich insgesamt nicht viel verändert hat: Sex vor der Ehe, unzuverlässige Männer, der Spagat zwischen Familie und Beruf – all diese Themen beschäftigten uns noch immer. Wenn man das Buch heute liest, könnte man sich tatsächlich fragen, ob nicht der größte Unterschied zwischen den Frauen von heute und den Frauen vor siebzig Jahren in dem Begriff »Wahlfreiheit« liegt – ein Begriff, der uns glauben macht, wir besäßen bis zu einem gewissen Grad die Kontrolle über unser Leben, ja, wir hätten gar »das Problem, das keinen Namen hat« gelöst. McCarthys Protagonistinnen in der Clique haben diese Wahlfreiheit nicht.
Und so beginnt denn der Roman auch folgerichtig mit einer unheilvollen Hochzeit, auf der sich die unbeschwerten Kommilitoninnen der Braut voller Idealismus und Zuversicht tummeln, und kreist anschließend relativ rasch um gescheiterte Ambitionen, schlechten Sex (der Ehemann einer Heldin sagt regelmäßig das Einmaleins auf, um seinen Samenerguss zu verzögern), um die Anforderungen der Kindererziehung, den Ehrgeiz, mit den anderen mitzuhalten und nicht zuletzt um die Unzuverlässigkeit der Männer – so lässt sich etwa zu Beginn der Geschichte eine der Heldinnen ein Diaphragma anpassen, woraufhin sie von ihrem Liebhaber sitzen gelassen wird.
Geht man von der Aufmerksamkeit aus, die heutzutage den Geschlechterbeziehungen beigemessen wird, könnte man versucht sein, Die Clique als Wegbereiter der aktuellen chick lit, der anspruchslosen Frauen-Unterhaltungsliteratur, zu bezeichnen. Das trifft jedoch keineswegs zu. Obwohl McCarthys Frauen alles daran setzen, den richtigen Mann zu finden, ist dieses Thema doch eher ein Nebenschauplatz für einen weitaus bedeutenderen Konflikt. Als Absolventinnen des Vassar Colleges sind die Mitglieder der Clique nämlich davon überzeugt, dass sie die Welt verändern werden. Doch dann müssen sie nicht nur erkennen, dass sie die Welt nicht verändern können, sondern dass ihr Überleben vielmehr nach wie vor von der eigenen Akzeptanz abhängt, dem »anderen Geschlecht« anzugehören.
Als Feministin und hochpolitischer Mensch war McCarthy davon überzeugt, dass ein Roman keineswegs nur der bloßen Unterhaltung dienen sollte. In einem Beitrag, der 1981 in der New York Times erschien, schrieb McCarthy, dass sich der klassische Roman »infolge von Ideen und öffentlichen Debatten über gesellschaftspolitische Themen, Politik und Religion, über den Freihandel oder die Frauenfrage, die amerikanische Weltmachtstellung, politische und gesellschaftliche Reformen etc. entwickelt und an Bedeutung gewonnen hat. Ein seriöser Roman muss sich zwingend mit solchen aktuellen Fragen und ihrer Bedeutung in Hinblick auf Macht, Geld, Sex und Gesellschaft auseinandersetzen.«
McCarthys Entschlossenheit, das Leben so zu akzeptieren, wie es war, entgegen der Wunschvorstellung davon, wie es hätte sein sollen, ist zweifellos auf ihre eigene schwierige Kindheit und Jugend zurückzuführen. Nachdem beide Eltern 1918 einer verheerenden Grippeepidemie zum Opfer gefallen waren, blieb die erst Sechsjährige als Vollwaise zurück und wuchs bei streng katholischen Verwandten auf, wo sie mit harter Hand erzogen und missbraucht wurde. Ihre Unschuld verlor sie mit vierzehn und fortan stand fest, dass sie Ehe und Sex niemals als angenehm oder gar lustvoll empfinden würde. In ihrem Buch Intellectual Memoirs (USA 1992; dt.: Memoiren einer Intellektuellen, 1997) beschreibt sie ihren zweiten Ehemann, den Kritiker Edmund Wilson, als »keuchenden, fetten, alten Mann mit Mundgeruch.« Sie behauptet, ihn nie geliebt und in die Ehe nur eingewilligt zu haben »zur Strafe dafür, mit ihm ins Bett gegangen zu sein.«
Auch wenn sich der Groll aus diesen Zeilen nur unschwer herauslesen lässt, zeigen sie zugleich doch McCarthys Scharfsinn, Sarkasmus und tiefschwarzen Humor, welche sie glänzend einzusetzen verstand, um tiefe Verbitterung in Satire zu verwandeln. In Die Clique wird ein Mann beschrieben, der »durch und durch nichts taugte, aber das waren natürlich gerade die Männer, die anständigen Frauen das Herz brachen.« Später erkennt Priss, eine der Heldinnen, dass in ihrem Mann »etwas steckte, dem sie misstraute, und das sie sich nicht anders erklären konnte als damit, dass er Republikaner war.« Indessen befällt Polly, eine weitere Heldin, mit sechsundzwanzig die Angst vor dem Alter, denn »schon jetzt behandelten einige ihrer Freundinnen sie wie eine Trouvaille aus einem Trödelladen – wie ein leicht beschädigtes Stück antiken Porzellans.«
McCarthy übt sich also nicht gerade in Zurückhaltung in Bezug auf ihren Plot und ihre Protagonisten. Leser, die vor allem Wert auf »sympathische Charaktere« legen, werden vermutlich eine gewisse Irritation empfinden angesichts der Tatsache, dass die Heldinnen der Clique ausnahmslos alle mit Fehlern behaftet sind: Sie sind je nachdem vom Ehrgeiz zerfressen, verwirrt, teilnahmslos, leiden unter Angststörungen, sind arrogant oder zickig; McCarthy entwirft die Persönlichkeit ihrer Protagonisten nicht, damit sie dem Leser gefallen, noch lässt sie sich dazu herab, sie von ihrem Schicksal zu erlösen. Vielmehr entwickelt sich das Leben ihrer Charaktere mit logischer und absolut realistischer Konsequenz.
Seit mir vor rund 15 Jahren Die Clique wieder in die Hände gefallen ist, habe ich das Buch wohl an die zehn Mal gelesen. Es ist ein grandioses Buch, nicht nur wegen des hinreißend spöttischen Stils, sondern auch wegen der großartigen Erzähltechnik, der glänzenden Monologe und scharfsinnigen Schilderungen. Jedes Mal, wenn ich das Buch lese, werde ich von Ehrfurcht ergriffen angesichts McCarthys schriftstellerischer Qualitäten. Ich bin ziemlich sicher, dass ich nie ein Buch wie Die Clique zustande bringen werde, aber Mary McCarthy wird mich immer inspirieren.
Aus dem Amerikanischen von Sophia Sonntag