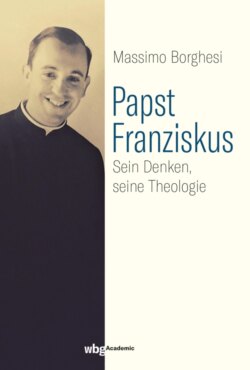Читать книгу Papst Franziskus - Massimo Borghesi - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Stadt Gottes und Stadt der Menschen: Bergoglio und der heilige Augustinus
ОглавлениеDiese Gegenüberstellung von Augustinus und Hegel erweckte Bergoglios Interesse. Sie zeigte ihm, wie weit die Theologie der Politik von jener politischen Theologie entfernt war, die er stets abgelehnt hatte (»Cristo vence«).87 Er war der festen Überzeugung, dass Christus niemanden besiegte, weder mithilfe der Milizen der Armee noch durch eine Revolution. Er glaubte vielmehr, dass der Sieg Christi der Sieg des Kreuzes ist, dass sein Reich in dieser Welt durch Samen des Lichts und der Gnade, durch Samen der Gerechtigkeit und der Werke offenbar wird, die dem pueblo fiel Leben einhauchen. Dass er den messianischen Populismus ablehnte, führte dazu, dass er ebenso wie Amelia Podetti in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts die Bedeutung von De civitate Dei als Modell für eine Theologie der Politik wiederentdeckte. Dies ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil große Teile der Wissenschaft dem Augustinus von De civitate Dei damals nur wenig Beachtung schenkten, wenn auch vereinzelt Beiträge dazu erschienen: So veröffentlichte die von Alberto Methol Ferré herausgegebene Zeitschrift Nexo Anfang 1987 einen Aufsatz von Pedro Morandé mit dem Titel »Desde la óptica de la Ciudad de Dios«.88 In der darauffolgenden Ausgabe rezensierte Methol Ferré die spanische Übersetzung von Erich Przywaras Augustinus. Gestalt als Gefüge (»San Agustín)«.89 Ferner publizierte die internationale Zeitschrift 30 Giorni, die auch auf Spanisch erschien, in den 1990er-Jahren eine Reihe von Artikeln, die – anknüpfend an Ratzingers Augustinus-Studien – die kirchliche und politische Relevanz von De civitate Dei beleuchteten.90 Dadurch erreichte der »Augustinus-Trend« auch Bergoglio. In einem Beitrag von 2002 stellte er Augustinus’ Denken der kaiserlichen Theologie des Eusebius von Cäsarea, dem Biographen Konstantins, gegenüber. Darin knüpfte er an die von Erich Peterson und Joseph Ratzinger skizzierte hermeneutische Linie an.91
In jener Zeit fand Augustinus, ein Mann, der den Unglauben und den Materialismus selbst gut kannte, den entscheidenden Schlüssel, um seiner Hoffnung eine Getalt zu geben, in einer fundierten Theologie der Geschichte, die er in seinem Buch De civitate Dei vorstellte. Darin stellt uns der Heilige ein hermeneutisches Prinzip vor, das weit über die »offizielle Theologie« des Reiches hinausgeht und für sein Denken entscheidend ist: das Konzept der »zwei Lieben« und der »zwei Städte«. Zusammengefasst argumentiert er folgendermaßen. Es gibt zwei »Lieben«: die Eigenliebe, die aggressiv individualistisch ist, andere für die eigenen Zwecke ausnutzt, das Gemeinsame nur in Bezug auf den eigenen Nutzen sieht und sich gegen Gott auflehnt; und die heilige Liebe, die in erster Linie sozial und auf das Gemeinwohl ausgerichtet ist und die Gebote des Herrn achtet. Um diese »Lieben« oder Finalitäten herum sind die »zwei Städte« organisiert: die »irdische« Stadt und die »Stadt Gottes«. In der einen wohnen die »Bösen«, in der anderen die »Heiligen«. Aber das Interessante am augustinischen Denken ist, dass diese »Städte« in der Geschichte nicht vorkommen können, d.h. sie können nicht in dieser oder jener weltlichen Wirklichkeit gefunden werden. Es ist klar, dass die Stadt Gottes nicht die sichtbare Kirche ist: Viele aus der himmlischen Stadt wohnen im heidnischen Rom, und viele aus der irdischen Stadt in der christlichen Kirche. Die »Städte« sind eschatologische Einheiten: Erst beim Jüngsten Gericht werden ihre jeweiligen Profile sichtbar werden, so wie auch das Unkraut und das Getreide erst bei der Ernte voneinander getrennt werden. Indes bleiben sie hier in der Geschichte untrennbar miteinander verbunden. Die historische Existenz der beiden Städte ist »säkular«. Schließt die eine die andere aus eschatologischer Sicht auch aus, so können sie im saeculum, in der weltlichen Zeit, nicht klar voneinander unterschieden und getrennt werden. Die Trennlinie verläuft … entlang der Freiheit des Menschen, der persönlichen wie der kollektiven.92
Der damalige Kardinal von Buenos Aires fragte sich weiter: »Warum wiederhole ich nun hier Dinge, die ein Bischof im 5. Jahrhundert gedacht hat? Weil seine Überlegungen uns dabei helfen, die Wirklichkeit zu sehen. Die Menschheitsgeschichte ist ein ungewisses Feld mit vielen unterschiedlichen Plänen, von denen keiner aus menschlicher Sicht makellos ist. Wir sollten aber erkennen, dass in ihnen allen sowohl die ›unreine Liebe‹ als auch die ›heilige Liebe‹ steckt, von denen der heilige Augustinus spricht. Fern von jeglichem Manichäismus oder Dualismus ist es legitim, die historischen Ereignisse als ›Zeichen der Zeit‹, als Samenkörner des Königreichs, sehen zu wollen, und darüber hinaus die Dinge zu erkennen, die – losgelöst vom eschatologischen Ziel – nur dazu dienen, die Verwirklichung des höchsten Schicksals des Menschen zu verhindern.«93
Kein menschliches Vorhaben ist »makellos«: Dies ist der Realismus des Augustinus. Seine Auffassung der beiden »miteinander verbundenen« Städte ermögliche es uns aber, so Bergoglio weiter, den »Manichäismus oder Dualismus« zu überwinden, der jedem politisch-religiösen Messianismus innewohne. 2003 wandte sich Bergoglio erneut Augustinus zu. In einer Rede mit dem Titel »Erziehen heißt, das Leben wählen« erläuterte er anhand von De civitate Dei den Begriff und das Konzept der »Utopie«. Bergoglio zufolge kann Utopie nicht auf bloße Imagination reduziert werden, sondern Utopie ist ein Suchen nach neuen Wegen und eine Kritik an der bestehenden Wirklichkeit. Jede nonkonformistische politische und gesellschaftliche Vision braucht die Utopie. Doch dieses Modell, die kritische Vorstellung einer anderen Welt, stößt »an zwei ernst zu nehmende Grenzen«:
[E]rstens eine gewisse »Verrücktheit«, die ihrem fantastischen oder imaginären Charakter geschuldet ist, und, wenn der Aspekt der Praktikabilität darüber vernachlässigt wird, die Utopie in einen bloßen Traum oder unerfüllbaren Wunsch verwandeln kann.94 […] Zweitens kann die Utopie mit ihrer Ablehnung des Bestehenden und ihrer Sehnsucht, etwas Neues zu schaffen, in einen Autoritarismus verfallen, der noch viel radikaler und unnachgiebiger ist als der, den sie eigentlich überwinden wollte. Wie oft haben utopische Ideale in der Menschheitsgeschichte alle nur erdenklichen Arten von Ungerechtigkeit, Intoleranz, Verfolgung, Gewalt und Diktaturen unterschiedlichster Prägung hervorgebracht!95
Angesichts dieser beiden Grenzen der Utopie wird die Bedeutung von Augustinus’ Sichtweise deutlich:
Genau an diesem Punkt wollen wir wieder auf den Gottesstaat zurückkommen. Die Utopie, wie wir sie kennen, ist eine typisch moderne Konstruktion (wenngleich sie im Millenarismus des späteren Mittelalters wurzelt). Der heilige Augustinus aber gibt uns mit seinem Schema von den »zwei Staaten« (dem Gottesstaat, in dem die Liebe regiert, und dem Erdenstaat, in dem der Egoismus herrscht), deren weltliche Erscheinungsformen unentwirrbar eng miteinander verflochten sind, einige wichtige Anhaltspunkte, um das Verhältnis zwischen Neuheit und Kontinuität zu bestimmen. Ebendieses Verhältnis ist der kritische Punkt des utopischen Denkens und der Schlüssel zu jeder Kreativität, die aus der Geschichte schöpft. Augustinus’ Gottesstaat ist in erster Linie eine Kritik an einer Sichtweise, die die politische Macht und den Status quo als heilig betrachtete. Alle antiken Reiche stützten sich auf eine solche Vorstellung. Die Religion war wesentlicher Bestandteil eines ganzen Konstrukts aus Symbolen und Fiktionen, das die herrschende Macht für sakrosankt und zum Fundament der Gesellschaft erklärte. Und das galt durchaus nicht nur für die Heiden: Sobald das Christentum im Römischen Imperium Staatsreligion geworden war, wurde eine offizielle Theologie erarbeitet, die diese politische Gegebenheit zementieren sollte – ganz so, als wäre mit ihr das Reich Gottes auf Erden Wirklichkeit geworden.96
Ebenso wie Joseph Ratzinger es in Die Einheit der Nationen getan hatte, griff Bergoglio auf Augustinus’ Theologie der Geschichte zurück, um sich gegen die politischen Theologien von rechts und links zu stellen, die in Ratzingers Augen durch die christlich-kaiserliche Theologie des Eusebius von Cäsarea und die gnostisch-subversive Theologie des Origenes symbolisiert wurden. Ratzinger hatte 1971 die neuen politischen Theologien von Metz und Moltmann kritisiert, die beide vom »utopischen« Marxismus Ernst Blochs geprägt waren. Ihnen sowie auch dem konservativen Pol setzte Ratzinger Augustinus entgegen: »[S]o müssen wir feststellen, daß auch Augustinus nicht versucht hat, so etwas wie die Verfassung einer christlich gewordenen Welt auszuarbeiten. Seine civitas Dei ist zwar nicht eine rein ideelle Gemeinschaft aller gottesgläubigen Menschen, aber sie hat auch nicht das mindeste mit einer irdischen Theokratie, mit einer christlich verfaßten Welt zu tun, sondern sie ist eine sakramental-eschatologische Größe, die in dieser Welt als Zeichen des Kommenden lebt.«97 Daher »ist bei Augustin das Christlich-Neue gewahr: Seine Lehre von den zwei Staaten zielt weder auf eine Verkirchlichung des Staates noch auf eine Verstaatlichung der Kirche ab, sondern darauf, inmitten der Ordnungen dieser Welt, die Welt-Ordnungen bleiben und bleiben müssen, die neue Kraft des Glaubens an die Einheit der Menschen im Leibe Christi gegenwärtig zu setzen als ein Element der Verwandlung, deren Vollgestalt Gott selber schaffen wird, wenn diese Geschichte einmal ihr Ziel erreicht hat.«98 Auf diese Weise »blieb der Staat für ihn in aller wirklichen oder scheinbaren Verchristlichung ›irdischer Staat‹ und die Kirche Fremdlingsgemeinde, die das Irdische hinnimmt und gebraucht, aber nicht darin zu Hause ist«.99 Augustinus’ eschatologische Vorstellung sei zugleich revolutionär und gesetztestreu:
Während man also bei Origenes nicht recht sieht, wie diese Welt weitergehen soll, sondern nur den Auftrag zum eschatologischen Durchbruch deutlich vernimmt, rechnet Augustin mit einer Fortdauer des gegenwärtigen Zustandes, den er für diese Weltzeit so weit für richtig hält, daß er eine Erneuerung des Römischen Reiches wünscht. Aber er bleibt insofern dem eschatologischen Denken treu, als er diese ganze Welt für ein Provisorium ansieht und deshalb nicht versucht, ihr eine christliche Verfassung zu geben, sondern sie als Welt stehen läßt, die um ihre eigene relative Ordnung ringen muß. Insofern bleibt auch sein bewußt legal gewordenes Christentum in einem letzten Sinn »revolutionär«, da es sich mit keinem Staat identisch setzen kann, sondern eine Kraft ist, die alles Innerweltliche relativiert, indem es hindeutet auf den allein absoluten Gott und den einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen: Jesus Christus.100
Die Vorstellung von einem zugleich revolutionären und gesetzestreuen Augustinus fand Widerhall bei Bergoglio. 2000 erläuterte der Kardinal von Buenos Aires in einer Predigt ausführlich seine Vorstellung vom »Königreich Gottes«. Er übte zunächst Kritik an einer allzu optimistischen oder pessimistischen Bewertung eines bestimmten historischen Moments und skizzierte dann einen positiven Realismus, der über die bloßen Kategorien optimistisch/pessimistisch hinausgeht: »In unserer heutigen Wirklichkeit gibt es viele Dinge, die, wenn sie gezielt eingesetzt werden, das Leben der Menschen auf Erden erheblich verbessern können.«101 Dazu zählte er die Technologie, die Emanzipation der Frau, verschiedene Kommunikationsmittel und -wege, medizinischen Fortschritt und sozialen Wohlstand. »Doch dürfen wir nicht naiv sein und die Gefahren dessen, was heute passiert, ignorieren: Entmenschlichung, schwere soziale und internationale Konflikte, Ausgrenzung und Tod zahlreicher Menschen… Für den Pessimismus der Apokalyptiker gibt es durchaus einen Grund.«102
Diese Ambivalenz, die die Grenzen des modernen Progressivismus aufzeige, fordere uns heraus, über das Verhältnis von Eschatologie und Geschichte nachzudenken. »In jüngster Zeit« – und hier bezog er sich ganz klar auf den marxistisch geprägten Strang innerhalb der Befreiungstheologie – »glaubten viele Christen, dass die Gegenwart des Königreichs durch historisches Engagement eine echte und konkrete Vorwegnahme dieser neuen Welt bewirken könnte: eine bessere, gerechtere und menschlichere Gesellschaft, eine Art erster grober Entwurf oder Vorspiel dessen, was uns am Ende der Zeiten erwartet. Mehr noch: Man glaubte, dass das Handeln der Christen das Kommen des Königreichs tatsächlich ›vorwegnehmen‹ könne, da der Herr es in unsere Hände gelegt habe, sein Werk zu vollenden. Aber die Dinge haben sich nicht wie erhofft entwickelt.«103 So »folgte auf all die Bemühungen, die Utopie zu verwirklichen, die desillusionierte Einsicht, dass man die inneren und äußeren Konditionierungen akzeptieren musste. An die Stelle des Strebens nach dem Wünschenswerten tratt die Umsetzung des Möglichen. Die gegebenen Versprechen wurden nicht erfüllt, im Gegenteil, sie waren nur eine Illusion. Wir sollten uns fragen, ob das gegenwärtige Desinteresse der jüngeren Generationen an der Politik und an gemeinschaftlichen Projekten nicht mit eben dieser Erfahrung von Frustration zusammenhängt.«104 Die Ernüchterung der heutigen Welt ist das Ergebnis eines historischen Prozesses, eine Reaktion auf Utopien, die ihre Versprechen nicht halten konnten. »Das Ergebnis des Zusammenbruchs historischer Gewissheiten und des Verlusts jenes Gefühls, dass menschliches Handeln etwas objektiv und subjektiv Besseres bewirken kann, ist ein postmoderner Individualismus und Ästhetizismus, ja vielleicht sogar ein gewisser Pragmatismus und Zynismus. Selbst bei manchen Christen drückt sich das in einem bloßen ›Leben im Augenblick‹ (mag es auch der ›Moment‹ der spirituellen Erfahrung sein) aus: Man wartet passiv darauf, dass das Königreich vom Himmel ›fällt‹.«105
Dieser christliche Pessimismus, der mit Trägheit und Desinteresse am Schicksal der Welt einhergeht, sei aus Sicht des christlichen Glaubens und der christlichen Hoffnung ungerechtfertigt: »Aber lässt die postmoderne Ernüchterung (nicht nur in der Politik, sondern auch in der Kultur, der Kunst und im Alltagsleben) wirklich einen Funken Hoffnung erahnen, der auf der Erwartung des Königreichs beruht? Oder aber anders gefragt: Hat die Vorstellung, dass das Königreich unter uns beginnt, der Kern von Jesu Lehren und Handeln, und eine vertraute, aber nicht persönliche Erfahrung unter den Gläubigen nach seiner Auferstehung, heute noch etwas zu sagen? Besteht abgesehen von diesen vielleicht zu linearen Vorstellungen eine Verbindung zwischen der theologischen Botschaft vom Reich Gottes und der konkreten Geschichte, in die wir Menschen eingetaucht sind und für die wir verantwortlich sind?«106 Und ja, es gibt sie, diese Beziehung, die über eine lineare Kontinuität zwischen der Geschichte und der Vollendung des Königreichs hinausgeht:
So wie die individuelle Erfüllung (die Begegnung mit Gott und die endgültige persönliche Verklärung in der Auferstehung) in den allermeisten Fällen durch einen schrecklichen Moment der »Diskontinuität«, des Scheiterns und der Zerstörung (durch den Tod) verläuft, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass dasselbe nicht auch mit der Geschichte in ihrer Ganzheit geschieht. Und hier sehen wir die Wahrheit eines apokalyptischen Denkens: Die Welt vergeht, es gibt keine finale Erfüllung ohne irgendeine Form von Zerstörung oder Verlust, auch wenn wir nicht im Voraus wissen können, wie sie aussieht. Dass es aber keine Kontinuität geben wird, stimmt nicht: Ebenso wie ich auferstehen werde, wird es die gleiche Menschheit, die gleiche Schöpfung und die gleiche Geschichte geben, und wir alle werden in der Fülle der Zeit verklärt werden! Kontinuität und Diskontinuität. Eine geheimnisvolle Wirklichkeit zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, zwischen »bereits« erfüllten, aber »noch nicht« in vollem Umfang erfüllten Versprechen.107
Der Text von 2000 zeigt, dass Bergoglio am paulinisch-augustinischen Modell festhielt, am Paradigma vom »bereits« und »noch nicht«. Die polare Spannung zwischen der Erwartung der Parusie und dem Einsatz in der Welt: Dies ist die Wesensart des Christen in der Geschichte.