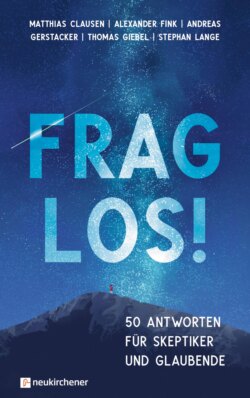Читать книгу Frag los! - Matthias Clausen - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGlaube
und Wissenschaft
Einwand 6:
Wer an Wunder glaubt, macht sich der Naivität schuldig.
Wenn es einen aktiv handelnden Gott gibt, gibt es keine Sicherheit gegen Wunder. So ähnlich formuliert es C. S. Lewis in seinem Buch Wunder. Es ist keineswegs irrational, an die Möglichkeit von Wundern zu glauben, wenn man gute Gründe hat anzunehmen, dass das natürliche Universum nicht alles ist, was existiert.14
Die Philosophen der Aufklärung wie Voltaire, Spinoza oder Hume glaubten in Anlehnung an das Newton’sche Uhrwerk-Universum, Naturgesetze seien unabänderlich, das Universum sei kausal geschlossen und in seinem Lauf völlig berechenbar. Da war kein Platz für ein Eingreifen von außen, allenfalls vielleicht noch ganz am Anfang, als Gott das Universum in Gang gesetzt und sich danach zurückgezogen hat (das nennt man Deismus). Doch die Physik hat sich längst weiterentwickelt. Die erstaunlichen Phänomene der Quantenmechanik wie der spontane radioaktive Zerfall eines einzelnen Atomkerns, spontane Paarerzeugung, „Schrödingers Katze“, die unauflösbare Kopplung von Beobachter und Messobjekt und anderes erschütterten das Uhrwerk-Bild und zeigten, dass es im Universum keineswegs so vorhersagbar zugeht, wie die Alten glaubten. Vielmehr lässt die quantenmechanische Beschreibung der Welt völlig unterschiedliche Entwicklungen der Zukunft zu. Ein Eingriff von außen könnte unter Umständen nicht einmal detektiert werden, also jeder menschenmöglichen Messgenauigkeit entgehen. Das Universum wird daher von der Mehrzahl der Wissenschaftler als kausal offenes System angesehen. Der Zufall löst die Vorherbestimmtheit ab.
Zufall ist natürlich noch kein aktiv handelnder Gott. Aber naturwissenschaftlich kann man zufälliges Geschehen nur sehr bedingt von willentlich gesteuertem Geschehen unterscheiden. Die Anzahl der Autos, die unter einer Autobahnbrücke hindurchfahren, erscheint zufällig. Und doch steckt hinter jedem Auto ein absichtsvoller Fahrer.
Doch um an Wunder zu glauben, brauchen wir die Quantenmechanik gar nicht. Denn Gott muss gar keine Naturgesetze brechen, um in die Welt einzugreifen. Wenn ich einen Stift zu Boden fallen lasse, kann ich genau berechnen, wann und wie schnell der Stift am Boden auftrifft. Doch weil es ein teurer Stift ist, entscheide ich mich, ihn aufzufangen. Meine Berechnung war also falsch. Habe ich damit Naturgesetze gebrochen? Keineswegs. Ich habe lediglich willentlich eine neue Kraft eingeführt, welche den Fall des Stiftes gestoppt hat.
Was sollte den Schöpfer des Universums also hindern, in sein Universum einzugreifen und eine Kraft auszuüben, um Jesus auf der Wasseroberfläche zu halten? Oder erneut C. S. Lewis: „Wenn Gott im Körper einer Jungfrau ein wundersames Spermatozoon schafft, dann macht sich das nicht daran, irgendwelche Gesetze zu brechen. Die Gesetze übernehmen es sogleich. Die Natur ist bereit. Allen normalen Gesetzen entsprechend folgt eine Schwangerschaft, und neun Monate später wird ein Kind geboren.“15 Grundsätzlich gilt: Die Existenz eines Schöpfers des Universums können wir nicht a priori ausschließen. Es ist gerade diese Frage, die uns Menschen interessiert: Ist das Universum alles, was existiert, oder gibt es einen Schöpfer? (siehe Einwand 1, 5, 7, 11 u. 45)
Die zu prüfende Frage lautet also – zumindest dann, wenn wir die Existenz Gottes als nicht unmöglich betrachten: Gibt es gute Gründe dafür, ein bestimmtes Ereignis tatsächlich als ein Wunder, ein Eingreifen Gottes, anzusehen? Wesentlich ist die Denkvoraussetzung: Wer nicht an Wunder glauben will und Gott kategorisch ausschließt, wird natürlich immer eine rein natürliche Erklärung anzuführen versuchen. Aber die Frage bleibt, ob diese Erklärung tatsächlich wahr oder einfach nur eine mögliche Rekonstruktion ist. Das für die Wahrheit des Christentums entscheidende Wunder ist die Auferstehung Jesu. Könnte es sein, dass die leibliche Auferstehung tatsächlich die plausibelste Erklärung der Ostergeschehnisse ist? (siehe Einwand 23)
(Alexander Fink)
Einwand 7:
Die riesige Größe des größtenteils lebensfeindlichen Universums spricht gegen die Existenz Gottes.
Diesen Einwand höre ich oft aus dem Mund von Naturwissenschaftlern, obwohl es kein naturwissenschaftliches, sondern ein theologisches Argument ist. Aber warum sollte aus den Größendimensionen des Universums folgen, dass es keinen Gott gibt? Wenn es einen Gott gibt, so ist er doch frei, das Universum so zu erschaffen, wie er will.
Das Argument gewinnt nur an Kraft, wenn man annimmt, dass Gott sehr utilitaristisch denkt: „Warum soll ich mehr Energie aufwenden als nötig, um ein Universum zu erschaffen, in dem Leben existieren kann? Würde nicht auch eine Käseglocke reichen? Warum ein gigantisch großes Universum mit hundert Milliarden Galaxien?“ Aber genauso könnte man fragen: Warum gibt es über 350.000 Käferarten, wenn sie doch für die Existenz des Menschen nicht nötig sind, der im Ebenbild Gottes als das große Ziel der Schöpfung erschaffen wurde? Widerlegen diese vielen Käfer nicht, dass es einen Gott gibt, der ausgerechnet den Menschen zu seinem Gegenüber erwählt hat? Doch im Gegenteil kann uns die unfassbare Vielfalt an Lebensformen auf der Erde in einem ansonsten lebensfeindlichen Universum nahelegen: „Für euch Menschen habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht, weil ihr mir besonders wichtig seid. Und das liegt nicht an eurer Größe, sondern daran, weil ich euch so gemacht habe, dass ihr meine Gedanken ansatzweise nach-denken und mit mir darüber staunen könnt!“
Diesem Einwand liegt also ein utilitaristischer Fehlschluss zugrunde, wie er uns im Technologiezeitalter nur zu tief in den Knochen steckt. Aber der Gott der Bibel ist anders. Er liebt Vielfalt, er erschafft in unermesslicher Fülle. Er ist kein nutzenorientierter Gott, wenn es um Kreativität geht. Das sollte uns zu denken geben in unserer Zeit, in der wir vieles nach seinem Nutzen bewerten, sogar menschliches Leben. Die Größe des Universums hat in der Tat schon die biblischen Schreiber ins Nachdenken gebracht. Im achten Psalm fragt König David, was angesichts der überwältigenden Größe des Himmels der Mensch sei, dass Gott sich überhaupt um ihn kümmert.
Aber die Frage, ob wir Gott wichtig sind, ist keine Frage der Quantität, sondern der Qualität. Auch wenn das Universum im uns beobachtbaren Raum weitgehend leer erscheinen mag, so hat die moderne Naturwissenschaft doch ganz Erstaunliches über die Beschaffenheit des Universums herausgefunden. So hat der renommierte Mathematiker und Physik-Nobelpreisträger Sir Roger Penrose, ein Freund des Astrophysikers Stephen Hawking, berechnet: Von allen potentiell bei einem Urknallereignis entstehenden Universen besitzt nur eines von 10 hoch 10123 eine lebensfreundliche Energieverteilung.16 In den anderen wäre Leben unmöglich, weil die Gravitationskraft die Materie so sehr zusammenballen würde, dass es nur Schwarze Löcher und dazwischen leeren Raum gäbe, oder weil die Energie so gleichverteilt wäre, dass es praktisch keine Zusammenballungen und damit keine Sterne gäbe. Und dennoch ist genau dieses Universum entstanden – wir leben darin und beobachten es. Ein unglaublicher Volltreffer! Unser Weltall beinhaltet gar nicht genug Atome (man schätzt 1080), um die 10123 Nullen dieser Zahl überhaupt aufschreiben zu können.
Es gibt zahlreiche weitere Feinabstimmungen, die zeigen, dass ein lebensfreundliches Universum auf Messers Schneide steht. Doch auch innerhalb dieses Universums müssen wiederum feinabgestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit es wirklich zur Entstehung eines lebensfreundlichen Planeten kommt. Das alles würde den Rahmen dieses Textes aber sprengen.17 In seinem jüngsten Aufsatz zu den Fundamentalkonstanten des Universums kommt der Astrophysiker Luke A. Barnes zum Ergebnis, dass – vorsichtig geschätzt – mindestens ein Drittel der über 30 physikalisch grundlegenden Konstanten sehr fein abgestimmt sein müssen, um Leben zu ermöglichen. Er fasst zusammen: „Kombiniert man unsere Abschätzungen, so liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Universum, das Leben erlaubt, auf naturalistischer Basis bei weniger als 10-136. Das ist, wie ich behaupte, verschwindend gering.“18 Wissenschaftliche Befunde legen also nahe: Unser lebensfreundliches Universum ist ein extrem (!) außergewöhnliches Phänomen, das eine Erklärung verlangt.
Aufgrund dieser Indizien führten Wissenschaftler das sogenannte Anthropische Prinzip ein: Das Universum muss so beschaffen sein, dass es die Existenz intelligenter Beobachter erlaubt. Sonst wären wir schließlich nicht hier und könnten uns gar nicht wundern. Doch diese Interpretation verwechselt Ursache und Wirkung. Das feinabgestimmte Universum ist eine notwendige Bedingung für unsere Existenz. Aber wir können natürlich nicht die Ursache für die Existenz des Universums sein, da das frühe Universum durch unsere spätere Existenz keine steuernden physikalischen Kräfte erfahren haben kann.
Wir gleichen Schiffbrüchigen, die sich glücklicherweise auf eine nahe gelegene Insel retten können und auf ihr „zufällig“ einen wunderbaren Garten vorfinden, der alles bietet, was wir zum Leben brauchen.19 Wer käme da nicht auf den Gedanken, dass das geplant sein könnte? Wer Planung ausschließen will, weil er die Existenz eines transzendenten Planers aus weltanschaulichen Gründen ablehnt, muss entweder an einen unglaublichen Zufall glauben oder daran, dass es noch unendlich viele andere Universen gibt, die diesen gigantischen Zufall durch die Anzahl der Möglichkeiten aufwiegen. Man stellt sich dabei vor, dass z. B. aus ewig existierenden Quantenfluktuationen immer wieder neu Universen entstehen. Beim Lotto liegt die Wahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn bei 1 : 140 Millionen. Aber wenn 20 Millionen Menschen jede Woche spielen, gewinnt irgendwann einer. Doch bei jeder neuen Lottoziehung besitzen alle Ergebnisse die gleiche Wahrscheinlichkeit, während das für unser Universum aufgrund der vielen nötigen Feinabstimmungen bezweifelt werden darf. Darüber hinaus liefert uns die Naturwissenschaft keine Belege für die Existenz anderer Universen. Der Astrophysiker Ethan R. Siegel kommentiert in einem Blogbeitrag vom 22. Mai 2020: „Parallele Universen werden auf Grundlage der uns vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse ein Science-Fiction-Traum bleiben müssen.“20 Das Multiversum ist pure Spekulation, ein Glaube, der auf der willkürlichen Festlegung basiert, dass es nichts anderes als Materie geben kann. Doch damit setzt man voraus, was doch erst zu beweisen ist.
Abgesehen davon schließt ein Multiversum einen Schöpfer nicht aus. Warum sollte ein kreativer Gott nicht in der Lage sein, einen Mechanismus zu erschaffen, der ständig neue Universen mit unterschiedlichen Eigenschaften erzeugt. Doch wenn dabei unser Universum herauskommen soll, muss dieser Mechanismus ziemlich gut abgestimmt sein. Das Feinabstimmungsproblem wird also nur vom Erdgeschoss (der Abstimmung unseres Universums) in den Keller (den abgestimmten Erzeugungsmechanismus des Universums) verlagert. Mit der unerwarteten und unglaublich präzisen Feinabstimmung entdecken wir ein positives Argument für intelligente Planung, das die Zufallshypothese in Zweifel zieht. So formuliert auch der Astrophysiker Paul Davies treffend: „Dem Eindruck, dass es einen Plan gibt, kann man sich nicht entziehen.“21 Wieder eine Fragestellung, über die es sich lohnt, im Gespräch zu bleiben.
(Alexander Fink)
Einwand 8:
Die Wissenschaft macht Gott unnötig und zeigt, dass er in Wahrheit ein Lückenbüßer für Unerklärtes ist.
Die Antwort: „Gott war’s!“, war zu früheren Zeiten eine beliebte Erklärung: Warum blitzt es? Wieso gibt es Erdbeben? Warum die Pest? Und so weiter. Letztlich war die Lösung immer, dass Gott etwas damit zu tun haben musste. Seit Beginn der modernen Naturwissenschaften wurden solche Gotteserklärungen aber immer mehr als Falschmeldungen entlarvt – vor allem Physik, Biologie und Chemie halfen uns, die Welt besser und systematischer zu verstehen. Das tun sie noch immer.
Heißt das aber, dass wir Gott kategorisch aus dem Kreis der möglichen Erklärungen ausschließen sollten? Selbst für die Fragen, die sich vielleicht nie naturwissenschaftlich erklären lassen? Einige sagen nun: „Ja, genau das heißt es! Selbst dann, wenn wir niemals dazu in der Lage sein sollten, naturwissenschaftlich zu erklären, warum und wie materielle Prozesse erlebnisfähige selbstreflexive Ich-Subjekte hervorbringen oder warum die Mathematik so vortrefflich auf die physikalische Realität passt, müssen wir einfach zugeben, dass es keine Antwort auf diese Fragen gibt. Gott steht als Erklärung aber nicht zur Diskussion.“
Wenn man zurückfragt, warum er so rigoros ausgeschlossen wird, bekommt man oft zu hören: „Weil es keine verbindlichen Gründe für seine Existenz gibt.“ Mit Verweis auf Einwand 1 lässt sich hierzu allerdings sagen: Das Fehlen von zwingenden Belegen für Gott ist erwartbar und damit kein Beleg für das Fehlen Gottes – als denkmögliche Erklärung steht er also durchaus im Raum.22 Das heißt natürlich nicht, dass er deshalb automatisch die beste Begründung für etwas ist – aber eben auch nicht, dass er auf gar keinen Fall als mögliche Erklärung infrage kommt.
Wo kommt dieses Denken zum Tragen? Besonders interessant sind hier die Argumente der Religionsphilosophie, weil gerade ihre Prämissen die Existenz Gottes nicht voraussetzen und sie deshalb auch nicht Gefahr laufen, sich irgendwann als Lückenbüßerei zu entpuppen. Das lässt sich am leichtesten an einem konkreten Beispiel erklären, z. B. am kosmologischen oder moralischen Argument (siehe Einwand 5, 11 u. 45).
Ich gebe aber offen zu: Selbst Argumente, die ohne Wissenslücken auskommen, haben ein Problem: Wenn Christen sich in Gesprächen darauf beschränken zu zeigen, dass etwas am besten (oder gar nur) mit der Existenz eines Schöpfers zu erklären ist, kann schnell ein falscher Eindruck entstehen. Nämlich der, dass Gott so etwas wie eine Arbeitshypothese zur Welterklärung sei. Für Fragen, wie das Leben und das Universum entstanden sind oder wie sich der Mensch entwickelt hat. Falsch ist dieser Eindruck deshalb, weil er ein falsches Gottesbild transportiert. Der Gott, an den Christen glauben, will nämlich in erster Linie nicht „Welterklärer“ sein – uns nicht die technischen Wie-Fragen des Universums erklären. An dieser „Funktion“ hat er kein zentrales Interesse.
Das finde ich sehr nachvollziehbar – gerade, weil die eigentlichen Fragen unseres Lebens ganz andere sind, z. B.: Was bringt die Zukunft? Wie gehe ich mit Sorgen, Krankheit und Tod um? Wie schaffe ich es, mein Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen? Wie finde ich Anerkennung? Wie inneren Frieden? Wem kann ich vertrauen? Wer bin ich eigentlich? Was ist der Sinn des Lebens? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nun nicht darauf hinaus, dass nur derjenige, der gläubig ist, Antworten auf solche Fragen finden kann. Das würde nicht stimmen. Es gibt auch gute „gottfreie“ Gedanken hierzu. Aber wenn das mit Gott stimmt, liegt es trotzdem nahe, dass der, der sich das Universum und uns Menschen ausgedacht hat, die eigentlichen Antworten auf unsere eigentlichen Fragen kennt. Und damit alles andere als unnötig ist (siehe Einwand 41).
Jesus formuliert das an einer Stelle recht eindrücklich, wenn er mahnt: „Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt?“ (Lk 9,25) Auf unseren Fall gemünzt: Was bringt es jemandem, die Welt naturwissenschaftlich präzise erklären zu können, wenn er dabei das eigentliche Ziel seines Menschseins aus den Augen verliert – und letztendlich verfehlt? Leute wie Martin Nowak (Evolutionsbiologe), William Newsome (Neurobiologe), Simon Conway Morris (Paläontologe), George Ellis (Kosmologe) oder Heino Falcke (Astronom), die in ihren jeweiligen Fachbereichen hoch angesehen und zugleich engagierte Christen sind, zeigen, dass sich beides nicht ausschließen muss.23
(Stephan Lange)
Einwand 9:
Der biblische Schöpfungsbericht und wissenschaftliche Erkenntnisse (Urknall, Evolution) schließen einander aus.
Wissenschaft erforscht natürliche Mechanismen. Wie funktioniert etwas unter bestimmten Rahmenbedingungen? Der biblische Schöpfungsbericht stellt uns eine wunderbar durchdachte Ordnung von Lebensraum und Lebewesen vor Augen und führt alles auf das Schöpfungshandeln Gottes zurück. Er fragt nach dem Woher und dem Wozu. Die überwältigende Mehrzahl alttestamentlicher Theologen stimmt übrigens darin überein, dass der Schöpfungsbericht nicht wie ein naturwissenschaftlicher Lehrtext verstanden werden möchte – wurde er doch lange vor Entstehung der naturwissenschaftlichen Methodologie verfasst.24 Will man ihn also nicht anachronistisch verstehen, muss man ihn mit der Perspektive lesen, wie Menschen zur damaligen Zeit über Natur, Schöpfung und Gott gedacht haben. Geht man von diesen unterschiedlichen Fragestellungen aus, kann man kaum einen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und biblischem Schöpfungsbericht entdecken.
Dennoch macht der Schöpfungsbericht Aussagen, die Konsequenzen für die Naturwissenschaft haben. So war es bis in die 20er-Jahre des 20. Jahrhunderts für die führenden Naturwissenschaftler selbstverständlich, dass das Universum ewig existiere. In einem längeren Prozess setzte sich dann aber gegen Widerstände doch die Auffassung durch, dass das Universum einen Anfang haben müsse. Dann stellt sich aber die unangenehme Frage, wer oder was für diesen Anfang verantwortlich war. Und diese Frage ist naturwissenschaftlich nicht beantwortbar. Wissenschaftliche Modelle, die bis zum Urknall zurückzurechnen versuchen, erreichen den Moment des Urknalls nicht. Der Anfang des Universums ist nach aktuellem Stand der Wissenschaft aus prinzipiellen Gründen empirisch unantastbar.
Angesehene Physiker wie der Nobelpreisträger Arno Penzias25, Ard Louis26 oder Aron Wall27 sehen in dieser Entdeckung eines Anfangs des Universums das biblische Weltbild bestätigt. Wie weit die naturwissenschaftliche Relevanz des Schöpfungsberichts geht, hängt allerdings stark vom Textverständnis ab. Man kann drei Hauptrichtungen unterscheiden, wie Christen den Schöpfungsbericht im Hinblick auf seine wissenschaftliche Aussageabsicht interpretieren. Für den wissenschaftlichen Fortschritt ist es dabei sehr fruchtbar, wenn unterschiedliche Ansichten ohne Maulkorb im argumentativen Diskurs stehen, solange sie wissenschaftlich nachvollziehbarer Methodik folgen.
Erstens: Der Junge-Erde-Kreationismus sieht die in Genesis erwähnten Tage als reale 24-Stunden-Tage, wie es auch die Mehrzahl der Kirchenväter tat.28 Damit kommt er in Konflikt mit vielen plausibel etablierten Modellen der Erdgeschichte. Doch Vertreter dieser Anschauung können gewisse Erfolge vorweisen, wenn sie Unstimmigkeiten in gängigen Datierungsmethoden nachweisen, denen im wissenschaftlichen Mainstream häufig keine große Bedeutung beigemessen wird. Ein spannendes Beispiel dafür liefert die wiederholte Entdeckung von elastischem Gewebe an Dinosaurierfossilien, was sich bei Annahme langer Zeiträume nur durch einen bisher noch unbekannten Konservierungsmechanismus erklären lässt29 oder die immer wieder in geologischen Proben gemessenen unerwartet hohen C14-Konzentrationen, die konventionell auf mehrere Millionen Jahre datiert werden und daher gar kein C14 mehr enthalten dürften (das in diesen Proben gemessene radioaktive Kohlenstoff-Isotop C14 müsste nach so langer Zeit bereits zerfallen sein; eine spätere Verunreinigung der Proben mit „frischem“ C14 erscheint meist unplausibel).30
Zweitens: Der Alte-Erde-Kreationismus hingegen interpretiert die Schöpfungstage entweder als nicht aufeinanderfolgende Tage oder als lange Zeiträume, was der entsprechende hebräische Begriff „jôm“ durchaus zulässt.31 Es gibt also keine Probleme mit der konventionellen Altersbestimmung. Vertreter dieser Sicht argumentieren zudem, dass die vielfältigen zweckmäßigen Baupläne der Lebewesen nicht aus den bekannten regelhaften evolutionären Prozessen hervorgegangen sein können, die bisher nur Variationen innerhalb von Bauplänen erklären können. In einem streng chronologischen Textverständnis entstehen dann allerdings Fragen wie: „Warum werden die Sonne und die Sterne erst am vierten Tag, also nach den Landpflanzen erschaffen?“
Drittens: Der sogenannten theistischen Evolution zufolge erschuf Gott die Vielfalt des Lebens mit den Mitteln der biologischen Evolution.32 Deren Vertreter sehen im Schöpfungsbericht bildlich zu verstehende Erzählungen, die uns etwas über die Ordnung der Schöpfung berichten, aber nicht über die Chronologie der Entstehung. Gott steht als ordnende und steuernde Hand hinter den schöpferischen Prozessen der Natur, die nach seinem Plan die Entfaltung des Lebens hervorbringen. Während dieses Modell an gängige naturwissenschaftliche Modelle problemlos angepasst werden kann, ergeben sich große theologische Fragen: Warum sollte ein guter und allmächtiger Gott den grausamen Mechanismus natürlicher Selektion durch den Tod einsetzen, um die Vielfalt des Lebens zu erschaffen?
Es gibt sehr detaillierte Diskussionen aller drei Modelle, die den Rahmen dieses Kapitels sprengen würden.33 Und auch wenn keines davon alle offenen Fragen endgültig klärt, halten sie alle einen Schöpfer für die bessere Erklärung des Universums verglichen mit der Alternative von Zufall und Notwendigkeit. So stimmen sie in folgenden wissenschaftlich gut bestätigten Punkten überein:
1 Das Universum ist nicht selbsterklärend, sondern stellt die Frage nach seiner eigenen Ursache. Vieles spricht dafür, dass das Universum einen Anfang hat, was gut mit der Idee eines Schöpfungsaktes zusammenpasst.
1 Das Universum wurde von Gott aus einem ungeordneten Zustand in einen Zustand lebensfreundlicher Ordnung überführt, was sich gut mit der beobachteten Feinabstimmung des Universums deckt.
1 Die zentral wichtigen Übergänge von unbelebter zu belebter Materie sowie von unbewusstem zu bewusstem Leben lassen sich nicht einfach als Aufsummierung von Eigenschaften einfacherer materieller Komponenten erklären, sondern weisen völlig neue Systemeigenschaften auf.
Sie stimmen darin überein, dass der Mensch eine besondere Stellung einnimmt als verantwortliches Gegenüber Gottes, die nicht aus seiner biologischen Herkunft heraus erklärt werden kann. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen.
1 Anhänger aller drei Anschauungen glauben, dass Gott in die Natur eingreifen kann, wie er es z. B. auch bei der Auferstehung Jesu von den Toten getan hat. Die Unterschiede beziehen sich nur darauf, wie oft Gott übernatürlich eingegriffen hat und wie lange er sich dafür Zeit ließ.
Manche von uns heute erlebten Widersprüche zwischen Schöpfungsbericht und Naturwissenschaft dürften sich mit neuen wissenschaftlichen Entdeckungen in Luft auflösen, dafür könnten auch wieder neue entstehen. Wenn wir Menschen versuchen, all unser interdisziplinäres Wissen zusammenzutragen, um die größte aller Fragen nach dem Ursprung der Welt zu lösen, sollte es nicht überraschen, dass inhaltliche Konflikte auftreten können.
Als Christen glauben wir aber, dass diese Konflikte ein Problem unseres begrenzten Wissens und der Notwendigkeit sind, die biblischen Texte und naturwissenschaftlichen Daten immer durch unsere menschliche Weltanschauungsbrille interpretieren zu müssen – sie sind nicht prinzipiell unauflösbar. Deswegen freuen wir uns darauf, weiter zu forschen, nachzudenken und lassen verschiedene Denkansätze zu Wort kommen, um sie zu prüfen. Das ist interdisziplinäres wissenschaftliches Arbeiten im besten Sinne!
(Alexander Fink)
Einwand 10:
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die „Erfolge“ von Gebet einer ganz normalen Wahrscheinlichkeit unterliegen.
Hier gibt es durchaus unterschiedliche Studien. Atheisten wie Richard Dawkins führen gerne solche an, die die These der medizinischen Wirkungslosigkeit von Gebet nahelegen.34 Christen beziehen sich auf Studien, die deutlich machen, dass Gebet durchaus eine Wirkung auf die Befindlichkeit und Heilungschancen von Patienten hat.35 2009 zitiert der FOCUS eine Übersichtsstudie aus dem Journal of Religion, die 18 solcher Gebetsstudien analysiert hat, und resümiert: „Einige Studien scheinen eine positive Wirkung auf die Gesundheit zu beweisen, andere wieder nicht.“36
Der Theologe Craig S. Keener hat in seinem akribisch recherchierten Werk Miracles zahlreiche Begebenheiten aus mehreren Kontinenten dokumentiert, in denen sogar auf öffentliches Gebet wunderbare Heilungen oder andere Ereignisse folgten.37 Beispielweise wurde im Mai 2007 während eines christlichen Jugendlagers mit über hundert Teilnehmern in Mumbai ein Junge namens Vikram regungslos auf dem Grund eines Swimmingpools gefunden. Eine anwesende Krankenschwester habe weder Atmung noch Puls feststellen können. Auch zwei Ärzte, zu denen der Junge transportiert wurde, hätten ihn nicht wiederbeleben können und ihn für tot erklärt. Doch die Christen beteten für Vikram. Und nach eineinhalb Stunden sei der Junge völlig überraschend lebendig zurückgekehrt. Vikram habe erzählt, dass er den Namen Jesus gehört habe und so gerettet worden sei. Die hinduistischen Eltern seien geschockt gewesen, denn ihres Wissens nach konnte der Junge den Namen Jesus vorher noch nie gehört haben.38
Doch vermutlich leidet diese Herangehensweise ans Gebet an einem grundlegenden Problem: Sie behandelt Gebet, als sei es ein natürlicher Mechanismus, als sei Gott ein Wunschautomat. Ich muss nur methodisch korrekt beten, dann wird auch das gewünschte Resultat erfolgen. Doch Gebet gleicht vielmehr dem Gespräch eines Kindes mit seinem Vater. Würde man eine Studie durchführen, wie sich das Äußern von Wünschen an den Vater auf die Erfüllung dieser Wünsche und das Wohlbefinden des Kindes auswirkt, käme man sicher auch zu sehr unterschiedlichen Schlüssen. Denn einige Wünsche des Kindes wird ein guter Vater wohl ablehnen und in förderlichere Bahnen lenken, oft zum Unwillen des Kindes, das dies alles erst viel später begreifen wird. Wie oft wehrt sich ein Kind dagegen, ein Musikinstrument oder Mathe zu üben, weil es lieber herumtollen möchte. Aber als Erwachsener ist es dann begeistert, dass es etwas gelernt hat. Auch ein Fußballteam, das die Meisterschaft gewonnen hat, wird dem Trainer das lange, harte und entbehrungsreiche Training schnell verzeihen.
Dietrich Bonhoeffer hat keine wunderbare Rettung erlebt, sondern wurde von den Nazis hingerichtet. Er schreibt: „Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen.“39 Sein tragisches Ende und das leidvolle Leben vieler Menschen, die intensiv zu Gott gebetet und eben keine Gebetserhörung erlebt haben, machen die Unverfügbarkeit des Gebets deutlich. Wenn Gott eine Person mit freiem Willen ist, so werden wir seine Gedanken nie ganz verstehen können, also auch nicht, wie er unser Gebet erhören will. Wer wie Jesus betet, betet voller Vertrauen, dass Gottes Wille geschieht, dass er seinen guten Plan in dieser gefallenen Welt und in meinem gebrochenen Leben verwirklicht.
Das Vaterunser-Gebet legt gerade den Fokus auf Gottes Reich und darauf, dass dieses gute, immer liebevolle und leidensfreie Zusammenleben im Kommen begriffen sei. Und doch konnten und können Menschen tatsächlich schon jetzt immer wieder erstaunliche Ereignisse erleben, wie sie in öffentlichen Heilungen, Bewahrung und Führung bezeugt sind (s. o.). Das Zusammentreffen von Gebet und Ereignis kann in solchen Fällen kaum als natürlicher Zufall erklärt werden. Dass Gebet hingegen nicht immer in Erfüllung geht, kann viele Ursachen haben und entzieht sich einer Beschreibung durch Wahrscheinlichkeiten. Auf jeden Fall hilft Gebet, sich in allen äußeren Umständen Gott anzuvertrauen. Das ermöglicht einen demütigen Umgang mit Glück und Erfolg und einen hoffnungsvollen Umgang mit Leid und Niederlagen. Und letztlich stehen wir selbst in der Verantwortung, es auszuprobieren. Denn Gott lädt zum Beten ein: „Wer bittet, dem wird gegeben.“ (Lk 11,9) – mahnt aber auch: „Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet.“ (Jak 4,2)
(Alexander Fink)
14 Vgl. dazu auch I. Hutchinson (2018): Can a Scientist Believe in Miracles? An MIT Professor Answers Questions on God and Science.
15 C. S. Lewis (1991): Wunder. Möglich, wahrscheinlich, undenkbar? S. 72.
16 R. Penrose (1989): The emperor’s new mind. S. 339–345.
17 Für weitere Beispiele von Feinabstimmung vgl. z. B. L. A. Barnes (٢٠٢٠): A Reasonable Little Question. A Formulation of the Fine-Tuning Argument; M. Widenmeyer (2019): Das geplante Universum; L. A. Barnes; F. L. Geraint (2016): A Fortunate Universe. Life in a Finely Tuned Cosmos; G. Gonzalez, J. Richards (2004): The privileged planet.
18 L. A. Barnes (2020): A Reasonable Little Question. A Formulation of the Fine-Tuning Argument. S. 1239.
19 Vgl. M. Widenmeyer (2019): Das geplante Universum. S. 7.
20 So der Schlusssatz von E. R. Siegel (2020): Have We Finally Found Evidence For A Parallel Universe?
21 P. Davies (1992): Prinzip Chaos. Die neue Ordnung des Kosmos. S. 289 f.
22 Siehe hierzu auch Fußnote 5.
23 Vgl. hierzu auch folgende Lesetipps: H. Falcke (2020): Licht im Dunkeln. Schwarze Löcher, das Universum und wir. A. Kellner (2018): Expedition zum Ursprung. Ein Physiker sucht nach dem Sinn des Lebens oder B. Drossel (2016): Naturwissenschaftler reden von Gott.
24 Vgl. z. B. den akribisch dem hebräischen Text folgenden C. J. Collins (2005): Genesis 1–4; E. Zenger (92015): Einleitung in das Alte Testament. S. 67 ff.; W. H. Schmidt (112011): Alttestamentlicher Glaube. S. 233 ff.
25 Vgl. A. Penzias (1992): Creation is supported by all the data so far.
26 https://youtu.be/xgskFDykU7E (Zugriff: 07.09.2020).
27 http://www.wall.org/~aron/ (Zugriff: 07.09.2020).
28 Z. B. R. Junker (2020): Genesis, Schöpfung und Evolution; A. vom Stein (32017): Creatio; www.wort-und-wissen.org; www.answersingenesis.org/days-of-creation.
29 Vgl. H. Binder (2020): Gewebereste und Zellbausteine in Dinosaurierfossilien.
30 J. R. Baumgardner et al. (2003): Measurable 14C in Fossilized Organic Materials.
31 Z. B. J. Lennox (2014): Sieben Tage, das Universum und Gott; H. Ross (22015): A Matter of Days. Resolving a Creation Controversy; www.johnlennox.org; www.reasons.org.
32 Z. B. B. Drossel (32018): Und Augustinus traute dem Verstand; D. Alexander (22014): Creation or Evolution. Do we have to choose?; www.glaubenaturwissenschaft.blogspot.com; www.biologos.org.
33 T. Cabal; P. Rasor (2018): Controversy of the Ages; IVP Counterpoints series (2017): Four views on Creation, Evolution and Intelligent Design; K. Keathley et al. (2017): Old-Earth or Evolutionary Creation?; T. C. Wood; D. R. Falk (2019): The Fool and the Heretic; J. P. Moreland et al. (2017): Theistic Evolution. A Scientific, Philosophical, and Theological Critique; R. Junker; S. Scherer (72013): Evolution. Ein kritisches Lehrbuch (2013); IVP Counterpoints series (2013): Four views on the Historical Adam.
34 Am bekanntesten sind H. Benson et al. (2006): Study of the therapeutic effects of intercessory prayer und M. Krucoff et al. (2005): Music, imagery, touch, and prayer as adjuncts to interventional cardiac care.
35 Vgl. die Auswertung von 89 Studien in H. G. Koenig et al. (22012): Handbook of Religion and Health, Kap. 2 u. 3. Oder auch R. C. Byrd (1988): Positive therapeutic effects of intercessory prayer in a coronary care unit population.
36 FOCUS (18.06.2009): Die zweifelhafte Macht der Gebete; https://t1p.de/2abd (Zugriff: 07.09.2020).
37 C. S. Keener (2011): Miracles. The Credibility of the New Testament Accounts. Kap. 3.
38 Ebd. S. 564 f.
39 D. Bonhoeffer (2005): Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. S. 265.