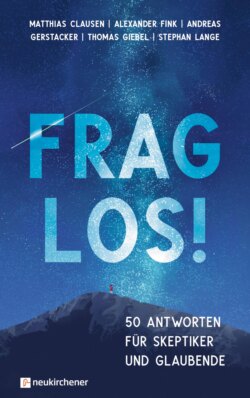Читать книгу Frag los! - Matthias Clausen - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGlauben und Denken
Einwand 1:
Beweise erst mal, dass es Gott gibt. Wenn du das geschafft hast, höre ich zu.
Auf dieses Anliegen könnte man ganz einfach antworten und sagen: „Weil Gott kein Teil des Universums ist, kann man ihn auch nicht mit naturwissenschaftlichen Mitteln belegen.“ Aber dann könnten Sie zu recht zurückfragen: „Aber warum macht er sich dann nicht für uns belegbar? Wenn es ihn wirklich gibt und er jeden Menschen gerne erreichen möchte, sollte es ihm doch ein Anliegen sein, alle Menschen – gerade die Skeptiker unter uns – zweifelsfrei von sich zu überzeugen. Zum Beispiel mit einem zwingenden Beleg oder einem eindeutigen Beweis. Möglichkeiten für einen allmächtigen Gott gäbe es ja viele: Er könnte sich direkt sichtbar machen oder uns zumindest unmissverständliche Zeichen geben, indem er z. B. Hier ist Jesus. Ja, es gibt mich wirklich! einmal pro Woche in jeder Sprache der Welt groß in den Himmel schreibt. Er könnte dafür sorgen, dass sich nur die Gesundheit kranker Menschen verbessert, für die gebetet wird. Oder ganz andere Wunder vor aller Augen tun. Oder vieles andere.“
Aber wir sehen so etwas nicht. Ein Bekannter sagte mir einmal: „Es bleiben nur folgende Möglichkeiten: a) Es gibt Gott einfach nicht, b) er will der Menschheit seine Existenz nicht zwingend beweisen oder c) er kann es nicht.“ Und er hat recht: Das sind die drei logischen Optionen, vor denen wir letztlich stehen. Als Christ mache ich mich, und das mag sich zunächst seltsam anhören, für Antwort b stark: Ja, es gibt Gott – aber er will uns keine unumstößlichen Belege für sein Dasein geben. Er hat sogar gute Gründe, dies nicht zu tun. Das will ich natürlich erklären.
Gott ist kein Es, sondern ein Jemand – ein Jemand mit Gefühlen, Wünschen und Absichten. Dem sogar etwas fehlen kann, nämlich der Kontakt zu uns Menschen. Gott fehlt etwas, wenn ihn auch nur ein einziger Mensch ablehnt. Und wenn das vorkommt, dann lässt es ihm keine Ruhe und er geht dieser Person nach. Er sieht jeden als unendlich wertvoll an und wünscht sich, mit allen seinen Geschöpfen in einem vertrauensvollen Kontakt zu stehen.4
Vertrauen ist aber eine Überzeugung, die sich weder erzwingen noch beschließen lässt. Zwang trägt immer die Last der Unfreiheit. Echtes Vertrauen kommt nur zustande, wenn ich wirklich frei in meiner Entscheidung bin. Für uns heißt das: Gott könnte uns natürlich zwingende Gründe geben, sodass wir gar nicht anders könnten, als von seiner Existenz auszugehen. Aber meine Motivation, mich Gott zu nähern, wäre dann nicht mehr freiwillig, sondern extern erzwungen.
Denn was wäre, wenn jeder Mensch zu 100 Prozent wüsste, dass er existiert: ein allmächtiger, allwissender, vollkommen gerechter, liebevoller und heiliger Gott. Dieses Wissen würde unser Denken und Handeln nicht nur etwas, sondern massiv beeinflussen. „Nein“, sagen hier manche. „Würde es nicht! Wenn sich Gott eindeutig klar machen würde, könnte ich mich immer noch frei gegen ihn entscheiden.“ Ja, das stimmt! Aber Hand aufs Herz: Wie viele Menschen, die aktuell leben oder je gelebt haben, würden so handeln? Vielleicht gar nicht so wenige, das will ich nicht abstreiten. Trotzdem übertreibe ich sicher nicht, wenn ich sage: Viele würden nicht so rebellisch sein. Sie würden, wenn sie zweifelsfrei wüssten, dass Gott existiert, ihm aus rein praktischer Klugheit gefallen wollen oder zumindest versuchen, nicht in Ungnade bei ihm zu fallen. Eine aufgrund von Berechnung, Sicherheitsdenken und/oder Egoismus gewonnene Haltung hat mit einer vertrauensvollen Beziehung aber wenig zu tun. Genau darauf will Gott jedoch hinaus.
Er liefert uns also keine zweifelsfreien Gründe für seine Existenz, weil er will, dass es aus vollkommen freien Stücken geschieht, wenn wir uns für eine Beziehung mit ihm entscheiden. Wer trotzdem eindeutige Belege fordert, der verlangt von Gott entweder, seinen Wunsch nach einer Beziehung aufzugeben, die auf Freiwilligkeit beruht, oder das logisch Unmögliche. (Denn selbst für Gott ist es nicht möglich, jemanden dazu zu zwingen, etwas freiwillig zu tun.)
Das heißt natürlich nicht, dass es gar keine Gründe für die Existenz Gottes gibt. Es gibt sie. Keine eindeutig zwingenden, wohl aber Argumente, die einer stimmigen Logik folgen und somit zeigen, dass es schlüssig ist, von Gottes Dasein auszugehen.5 Anders formuliert: Man begeht keinen intellektuellen Selbstmord, sondern folgt logisch konsistenten Argumentationen, wenn man z. B. die Tatsache, dass wir Menschen erlebnisfähige und selbstreflexive Ich-Subjekte sind,6 die Geltung der Naturgesetze, die mathematische Verstehbarkeit, Entstehung und Feinabstimmung des Universums oder die Existenz objektiver Moral auf Gott und sein Handeln zurückzuführt.
Ich weiß: Zu solchen Argumenten hat sich im Laufe der Zeit nicht nur unüberlegte, sondern auch ernst zu nehmende Kritik, gesammelt. Aber natürlich auch eine entsprechende Kritik der Kritik, sodass wir schlussendlich – und vor allem dann, wenn wir nicht nur Einzelargumente, sondern den gesamten Argumentrahmen betrachten7 – vor einem starken Plädoyer für die Existenz Gottes im theistischen Verständnis stehen (siehe Einwand 5).
(Stephan Lange)
Einwand 2:
Wenn Gott will, dass wir an ihn glauben, warum zeigt er sich nicht einfach?
Ich greife einmal den Schwung auf, der im letzten Kapitel aufkam: Gott würde sein eigentliches Ziel mit uns Menschen sabotieren, wenn er uns eindeutig zwingende Belege für seine Existenz gäbe. Können wir von Gott aber nicht noch mehr erwarten? Wenn Sie nun sagen: „Ja, vor allem mehr Konkretheit“, bin ich voll bei Ihnen. Denn es stimmt ja: Wenn die Argumente für Gott wirklich so weit tragen, dass man sein Dasein begründet in Betracht ziehen kann, ist das natürlich eine wichtige, aber letztlich noch keine ergiebige Einsicht. Und das sogar in zweierlei Hinsicht:
Zum einen hat Gott selbst kein Interesse daran, dass seine Geschöpfe nur zur bloßen Überzeugung kommen, dass er existiert. Das ist nicht seine Absicht. Zum anderen hilft es uns nicht wirklich weiter. Denn selbst wenn man sagt, dass es plausibel ist, von seinem Dasein auszugehen: Mit welchem Gott hätten wir es dann zu tun? Dem deistischen8, dem muslimischen, dem bahaiischen9 oder vielleicht doch dem christlichen? Wir könnten also von Gott, sofern es ihn gibt und er uns gerne begegnen möchte, erwarten, dass er sich (viel) klarer macht.
Und genau das trifft den Kern – denn Gott hat sich eindeutig gezeigt. Nicht in einem Dogma, einer Ideologie oder Institution und in erster Linie übrigens auch nicht in einem Buch. Sondern in erster Linie in einer Person – der Person Jesus Christus. Gott hat sich anschaulich gemacht, indem er selbst in Jesus Mensch wurde und uns damit ein Angebot macht: „Wer wissen will, wer und wie ich bin, wie ich denke und urteile, der schaue sich Jesus an. In ihm seht ihr mich.“
Aber warum sollte das stimmen? Warum sollte man glauben, dass sich Gott in Jesus zeigt? Ich finde diese Frage deshalb so berechtigt, weil ich sie mir vor elf Jahren auch gestellt habe. Im Rückblick würde ich mir folgende Antwort geben: Weil Jesus genau das von sich sagt, und zwar auf eine Art und Weise, die für mich sehr glaubwürdig ist. Wie meine ich das? Nun, wenn wir uns Jesus und sein Selbstverständnis anschauen, wie es im NT beschrieben wird, dann wird uns jemand vorgestellt, der von sich beansprucht, Gott selbst zu sein. Dieses Selbstbild äußert sich in verschiedenen Kontexten wie im Anspruch Jesu, Sünden vergeben zu können (z. B. Mk 2,5; Lk 7,47; Mt 12,31). Im jüdischen Kontext ist das klar Chefsache – nur Gott allein kann Sünden vergeben.
Jesu Selbstverständnis zeigt sich auch in der Rolle, die er sich im erwarteten Endgericht zuschreibt. An einer Stelle sagt er: „Ich sage euch: Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen.“ (Lk 12,8) Hierzu ist es hilfreich zu wissen, dass der Titel der Menschensohn die häufigste Selbstbezeichnung Jesu ist (über 80-mal). Für seine jüdischen Zeitgenossen lag die Anspielung auf das alttestamentliche Buch Daniel klar auf der Hand: Der Menschensohn steht dort für die Person, die am Ende aller Zeiten ins endzeitliche Richteramt eingesetzt wird, um „auf den Wolken des Himmels kommend“ (Dan 7,13) das Endgericht durchzuführen. Und auch hier ist im jüdischen Kontext klar: „Richter der Endzeit“ kann nur einer sein: Gott allein. Jesus macht also in Lk 12,8f. – aber auch an anderen Stellen (z. B. Lk 7,22f.; Joh 6,35ff.; Mt 25,31ff.) – deutlich, dass das Ergehen der Menschen am Jüngsten Tag von ihrer Haltung ihm gegenüber abhängt. Und auch seine Selbstbetitelung, der Sohn Gottes zu sein, schwächt seinen Gottesanspruch nicht ab. Im Gegenteil: Jesus beansprucht damit nichts Geringeres, als derselben Natur wie Gott zu sein (siehe Einwand 16). Die religiöse Elite seinerzeit verstand dies, und es veranlasste sie dazu, Jesu Tod wegen Blasphemie zu fordern (Joh 19,7).
Das waren natürlich nur einige Passagen, die den Anspruch Jesu zeigen, an Gottes Stelle zu stehen. Was ist davon zu halten? Letztlich stehen wir vor vier Möglichkeiten: a) Es ist falsch, was Jesus sagt, und er weiß das auch – dann ist er ein eiskalter Lügner, b) es ist falsch, was er sagt, er denkt aber, dass es richtig sei – dann leidet er an religiösen Wahnvorstellungen, c) der Gottesanspruch Jesu entspricht der Wahrheit oder d) er hat ihn nie erhoben, es handelt sich dabei um einen Mythos.
Was lässt sich hierzu sagen? Nun, der internationale Forschungsstand der historischen Jesusforschung erlaubt auf jeden Fall nicht, die Mythos-Möglichkeit ernsthaft in Betracht zu ziehen.10 Maßgebende Experten in diesem Fachbereich gehen davon aus, dass Jesus in der Tat mit dem Selbstverständnis auftrat, Gott zu sein. Ernsthaft denkbar sind daher nur noch die (drei) Möglichkeiten, dass Jesus ein Lügner, ein Größenwahnsinniger oder aber wirklich Gott selbst ist. Was davon stimmt? Wie wirkt Jesus auf uns? Oder besser gefragt: auf Sie?
Es versteht sich von selbst, dass ich Ihnen diese Bewertung nicht abnehmen kann. Meine Bitte wäre daher, sich ein eigenes Urteil über „den Fall Jesus“ zu bilden. Gerade dann, wenn Ihre letzte Lektüre der Lebensberichte Jesu schon etwas zurückliegt. Schnappen Sie sich doch einfach mal ein Neues Testament und lesen Sie in aller Ruhe eine seiner Biografien. Das geht ganz klassisch per Buch oder modern via bibleserver.com oder Smartphone-App. Die digitalen Bibelzugänge haben praktischerweise sogar viele verschiedene Übersetzungen parat (hier empfiehlt sich eine gut lesbare wie die Neue Genfer Übersetzung). Und fragen Sie sich beim Lesen: Für wen halte ich Jesus? Welchen Eindruck macht er auf mich? Zeigt sich hier vielleicht wirklich Gott selbst?
(Stephan Lange)
Einwand 3:
Glaube an Gott ist nichts als Wunschdenken.
Darauf kann man zweifach antworten. Die erste Möglichkeit erscheint naheliegender, die zweite ist jedoch effektiver. Aber es soll ja spannend bleiben, daher zunächst:
Möglichkeit 1: Nichts als Wunschdenken. Stimmt diese Beschreibung für Glaubende? Sätze mit „nichts als“ sind generell riskant. Es reicht im Grunde ein Gegenbeispiel, um sie zu widerlegen. Wer tatsächlich behaupten wollte, aller Glaube an Gott sei ausschließlich Ausdruck von Wunschdenken, dem könnte ich z. B. einfach meine eigene Lebensgeschichte erzählen. Wie bin ich selbst zum Glauben gekommen? Der Wunsch, das alles möge doch bitte wahr sein, kann dabei sogar eine Rolle gespielt haben – nur eben nicht die einzige.
Stattdessen war mein eigener Glaube gerade zu Beginn das Ergebnis von Nachdenken: Stimmt das alles? Sind die Inhalte des christlichen Glaubens begründet? Natürlich haben mich auch Menschen beeindruckt, die von ihrem Glauben überzeugt waren. Aber selbst Christ geworden bin ich nicht aus emotionalem Überschwang, sondern weil mich gute Gründe überzeugt haben; solche, wie sie sich auch in diesem Buch finden.
„Gut“, könnte man einwenden, „aber auch das waren ja nur vorgeschobene Gründe, darunter lag der uneingestandene Wunsch, an Gott glauben zu ‚dürfen‘, der nur nachträglich rationalisiert wurde.“ So etwas kann man immer unterstellen, und es lässt sich logisch nicht widerlegen. Wenn man wollte, könnte man meinen Protest dagegen sogar als Beleg für die These „Wunschdenken“ werten – ansonsten hätte ich es ja gar nicht nötig, mich zu wehren … Rückfrage: Wie würde es Ihnen gefallen, wenn auch Ihre eigenen Überzeugungen als Ausdruck von Unreife gewertet würden? „Nicht fair“, würden Sie sicher sagen. Für das eigene Erleben sollte zuerst jeder selbst als Experte gelten, jedenfalls bis zum Erweis des Gegenteils. So weit die erste Variante, auf den Einwand zu reagieren. Sie ist hoffentlich nachvollziehbar, aber nicht die einzige Möglichkeit zu antworten, und wie gesagt auch nicht die wirksamste.
Möglichkeit 2: Und wenn es so wäre? Was würde denn das über die Frage aussagen, ob die Inhalte des Glaubens wahr sind oder nicht? So nämlich ist der Einwand meiner Erfahrung nach häufig gemeint: „Glaube ist ein Konstrukt, ein Ausdruck von Wunschdenken – also falsch.“ Geistesgeschichtlich lässt sich dies auf die Religionskritik des 19. Jahrhunderts zurückführen, besonders auf Ludwig Feuerbach, in Abwandlung auch auf Karl Marx und Sigmund Freud.
Mit meinen eigenen Worten gesagt, lautet diese Religionskritik vor allem bei Feuerbach so: „Glaubende sind Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, die Schwierigkeiten mit der Realität haben – deshalb ‚malen‘ sie sich einen Gott an den Himmel, der ihnen damit umzugehen hilft. Diesen Gott gibt es aber gar nicht, sondern er ist nur Ausdruck ihres Wunschdenkens. Und er ist bei näherem Hinsehen auch nichts anderes als die Projektion eines Menschen, sozusagen eine ins Unendliche vergrößerte Version eines Menschen.“ Deswegen ist diese Form von Religionskritik auch als „Projektionstheorie“ bekannt. Gegen diese Theorie habe ich mehrere Einsprüche:
Einspruch 1: Die Projektionstheorie sagt nichts über die Wahrheitsfrage. Also über die Frage, ob es Gott nun gibt oder nicht, ob die Inhalte des Glaubens der Wahrheit entsprechen oder nicht. Sondern die Theorie setzt schon voraus, dass die Wahrheitsfrage geklärt ist, dass es ihn also nicht gibt. Wenn man dies schon voraussetzt, ist Projektion eine denkbare Erklärung. Aber diese Erklärung begründet in keiner Weise, dass es Gott nicht gibt. Denn natürlich sind Dinge nicht einfach deswegen wahr, weil man sie sich wünscht. (Das lernen z. B. Kinder schnell.) Aber das Gleiche gilt auch für das Gegenteil: Dinge werden auch nicht dadurch unwahr, weil Menschen sie sich wünschen. Ich gebe gerne zu, dass mir der Glaube an Gott Trost gibt. Aber folgt daraus, dass er keine reale Basis hat? Da gibt es keinen logischen Zusammenhang.
Einspruch 2: Normalerweise geben mir meine Bedürfnisse sogar Aufschluss über die Wirklichkeit. Ich habe z. B. regelmäßig Hunger, ich bin auf Nahrung angewiesen, und es gibt auch Nahrung, jedenfalls grundsätzlich. Mein Bedürfnis gibt mir Hinweise darauf, wie mein Körper und die äußere Wirklichkeit aufgebaut sind. Oder ich habe soziale Bedürfnisse, brauche die Begegnung mit anderen Menschen – ich bin ein soziales Wesen. Warum soll dies bei einem religiösen Bedürfnis auf einmal umgekehrt sein? Warum soll hier gelten: „Du sehnst dich nach Gott – also gibt es ihn nicht.“? Das wäre so, als wenn man zu jemandem sagte: „Du hast Hunger, also gibt es kein Essen.“ Das wäre weder besonders nett noch logisch. Stattdessen könnte man einen Schritt weitergehen und fragen: Wenn Menschen tatsächlich eine solche Sehnsucht nach Gott verspüren – vielleicht nicht alle, aber doch einige –, die anscheinend durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann: Könnte dies nicht sogar ein Hinweis auf Gott sein? Keine Angst: Das soll nicht der Versuch eines Beweises für Gott sein; es soll nur zeigen, dass man die Projektionstheorie genauso gut „auf den Kopf stellen“ und sogar in ein Argument für den Glauben verwandeln könnte.
Einspruch 3: Der christliche Glaube ist für viele Menschen im Kern sehr attraktiv – er ist zugleich aber ganz anders als das, was unsere unterbewussten Erwartungen an die Welt nahelegen. Er ist sogar so anders, dass ich mir schwer vorstellen kann, wie dieser Glaube eine menschliche Erfindung sein soll: Ein Gott, der Mensch wird, scheinbar klein und unbedeutend, zwar ungemein einnehmend und anziehend, aber schutzlos. Dieser geht dann als Mensch bis ans Kreuz, stirbt dort grausam und opfert sich stellvertretend für die Menschen – ein solcher Gott passt so überhaupt nicht zu den Größenfantasien, die die klassische Religionskritik dem christlichen Glauben unterstellt hat. Einen solchen Gott kann man sich kaum ausdenken. Auch das ist für sich kein Beweis für den Glauben, aber ein starkes Indiz.
(Matthias Clausen)
Einwand 4:
Glaube ist nicht rational, sondern eine Frage der Sozialisation.
Das sagst du nur, weil …“, ist vielleicht ein gängiges Argument, aber wenig hilfreich. Denn wie eine Überzeugung zustande kommt oder was einen Menschen dazu motiviert, etwas zu vertreten, sagt vielleicht etwas über diesen Menschen aus, aber nicht notwendig über die Überzeugung selbst. Ist sie wahr oder nicht? Entspricht sie der Wirklichkeit? Um das herauszufinden, reicht es nicht, sich die Vertreter dieser Überzeugung anzuschauen und ihre Vernünftigkeit zu bewerten. Stattdessen sollte man Gründe für und gegen ihre Überzeugung selbst überprüfen.
Man muss also unterscheiden zwischen der Rationalität eines Menschen und der Rationalität einer Überzeugung. So kann man das Richtige („Die Erde ist eine Kugel.“) auch aus unzureichenden Gründen glauben („Ich mag Kugeln.“ oder „In meinem Kinderzimmer stand so ein schöner Globus.“). Die magere Begründung ändert in diesem Fall aber nichts daran, dass der Gegenstand der Überzeugung selbst richtig ist.
Warum schreibe ich das so ausführlich? Weil die Rationalität von Menschen und die ihrer Überzeugungen in Gesprächen häufig durcheinandergebracht werden. Der philosophische Fachbegriff dafür ist der „genetische Fehlschluss“; genetisch im Sinne von „entstehungsbezogen“. Dieser Fehlschluss liegt dann vor, wenn allein von den Entstehungsbedingungen einer Überzeugung auf ihren Wert (ihre Wahrheitsgemäßheit, ihre Vernünftigkeit) geschlossen wird.
Das gilt auch für den christlichen Glauben. Natürlich kann man darüber nachdenken, wie Glaube in Christen zustande kommt und wodurch er motiviert ist; dazu gleich mehr. Nur selbst wenn man zeigen könnte, dass Glaube vielfach durch Sozialisation, Herkunft oder kulturelle Gewohnheiten geprägt ist, hätte man damit noch nichts über den Wert des Glaubens selbst ausgesagt.
So ist es ja auch bei unseren anderen Überzeugungen. Ein Beispiel: Ich verstehe mich als überzeugten Demokraten – ich glaube, dass die Demokratie die beste uns bekannte Staatsform ist. Sie hat sicher ihre Grenzen, ist manchmal schwerfällig, aber es ist eben die beste, die wir kennen. Ich behaupte, dass ich für diese meine Überzeugung gute Gründe habe, dass ich mich mit der Geschichte beschäftigt habe und Alternativen ausschließen kann. Aber natürlich könnte man mir vorhalten: „Das alles glaubst du doch vor allem deswegen, weil deine Eltern es dir beigebracht haben und du in einem demokratischen Land aufgewachsen bist.“ Und da ist sogar etwas dran. Nur ändert das nichts an den Argumenten für meine Überzeugung. Selbst wenn man weiter einwendete: „Und wärest du in einem ganz anderen System aufgewachsen, würdest du jetzt vielleicht dieses andere System vertreten.“ Auch das stimmt – vielleicht, auch wenn es natürlich spekulativ ist. Aber geschenkt: Das könnte so sein. Was aber ändert das an den Argumenten, die ich jetzt und hier für meine Überzeugung anführe? Nichts.
Genauso ist es auch mit meinem christlichen Glauben. Natürlich kann man mir vorhalten, dass mein Glaube wesentlich mit meinem Elternhaus zusammenhängt und auch damit, dass ich in einer Kultur aufgewachsen bin, die dem christlichen Glauben grundsätzlich positiv gegenübersteht. Dagegen könnte ich einwenden, dass ich zu einem bewussten Glauben erst als Jugendlicher gefunden habe, und dass dies vor allem mit eigenem Nachdenken und einer bewussten Entscheidung einherging. Siehe oben.
Aber wieder gilt: geschenkt. Meinetwegen waren meine Herkunft und meine Umgebung mit wirksam bei meinem Weg zum Glauben. Aber was folgt daraus? Das Gleiche gilt schließlich auch für alle anderen Überzeugungen, auch für Ihren möglichen Nichtglauben. Entscheidend ist, was an objektiven Gründen für oder gegen unsere jeweiligen Überzeugungen spricht, nicht, wie wir selbst zu ihnen gekommen sind.
Und selbst wenn man spekulierte: „Wärest du in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen, wärest du jetzt vielleicht kein Christ, sondern Hindu oder Muslim“, könnte ich antworten: Das ist zwar spekulativ – aber es könnte sein. Nur was folgt daraus? Denn auch hier gilt das Gleiche auch für den Nichtglaubenden. Der engagierte Atheist, der meinen Glauben für irrational hält, wäre vielleicht auch selbst kein Atheist, wäre er ganz woanders aufgewachsen. Dann wäre er vielleicht Pantheist oder Polytheist oder Mormone. Folgt daraus schon, dass ich über seine Einwände gegen meinen Glauben gar nicht nachdenken muss? Das würde er doch sicher verneinen! Und damit hätte er recht. Nein, wir kommen nicht darum herum: Wir müssen jetzt prüfen, was uns glaubwürdig erscheint, weil es gut begründet ist.
Vielleicht ist mit dem Einwand aber auch genau das gemeint: „Es kann gar keine rationalen Gründe dafür geben, an Jesus zu glauben. Also kann Glaube nur eine Sache der Sozialisation sein.“ Damit würde aber wieder vorausgesetzt, was doch eigentlich erst diskutiert werden soll. Wer sich keine guten Gründe für den Glauben denken kann, dem nenne ich gerne ein paar Kandidaten: klassische Argumente für die Existenz Gottes, etwa das sogenannte kosmologische Argument, die Feinabstimmung des Universums oder das moralische Argument (siehe Einwand 5, 7, 11 bzw. 45). Oder, was mir persönlich noch mehr liegt, ich komme gleich auf die Person Jesus zu sprechen. Ich nenne z. B. Belege für die historische Glaubwürdigkeit des NTs (siehe Einwand 19–22 u. 28–32), die uns am Ende in die Lage versetzen, selbst ein begründetes Urteil zu fällen: Wer war dieser Jesus? Der, der er zu sein beansprucht, oder hat er sich und andere furchtbar getäuscht? (siehe Einwand 2) Darüber diskutiere ich gerne und hier entscheidet sich auch, ob und inwieweit Glaube rational ist.
Ganz abgesehen davon: Empirisch stimmt der Einwand „Glaube ist einfach eine Frage der Sozialisation“ natürlich auch nicht. Sonst könnten ja niemals Menschen zum Glauben kommen, die vorher etwas anderes oder gar nichts geglaubt haben. Es gäbe auch keine Konversionen von einer Glaubensrichtung in eine andere. Das alles gibt es aber. Es ist in unseren Breitengraden vielleicht weniger häufig als in anderen Teilen der Welt, aber es ist auf jeden Fall erkennbar. Und das ist nicht nur ein persönlicher Erfahrungswert, sondern auch durch Studien belegt.11
(Matthias Clausen)
Einwand 5:
Die Menschheit hat sich Tausende Götter ausgedacht und an fast keinen davon glauben Christen. Atheisten gehen nur einen Schritt weiter …
Interessanterweise wurde den frühen Christen im Römischen Reich genau das vorgeworfen: Nicht so sehr, dass sie „zu viel“ glaubten, also an Gott, Jesus, Wunder usw. – sondern eher, dass sie „zu wenig“ glaubten, ja sogar den Glauben an die Götter der griechischen oder römischen Volksfrömmigkeit, andere Kulte und den römischen Kaiser als gottgleiche Gestalt, ablehnten. Stattdessen beharrten sie darauf, dass es nur einen Gott gibt, der unsichtbar ist, unvorstellbar und der Urgrund der Wirklichkeit – und dass dieser Gott sich in Jesus gezeigt hat.
Wie kamen sie dazu? Nicht einfach durch ein Ausschlussverfahren nach dem Motto: „Die anderen Göttern sind als Aberglaube enttarnt, denn inzwischen wissen wir, dass die Kräfte der Natur nicht von Göttern gesteuert werden, sondern sich eben nach eigenen Gesetzen richten. Also lehnen wir andere Götter ab – bleibt nur noch der Gott unserer eigenen Kultur übrig.“ Dann wäre es tatsächlich inkonsequent, ausgerechnet den „eigenen“ Gott von der Kritik auszunehmen.
Aber so ist der christliche Glaube gar nicht gedacht. Er wird gestützt von Argumenten für den Gott, der sich in Jesus zeigt. Und dieser Gott hat mit vielen anderen Gottesvorstellungen, z. B. dem Polytheismus der Antike oder den Naturgottheiten der sogenannten Primärreligionen12, fast nichts gemein (siehe Einwand 22). Die Frage: „Du lehnst den Glauben an diese anderen Gottheiten als irrational ab, warum glaubst du dann noch an den Gott von Jesus Christus?“, ist für mich daher analog zu einer Frage wie: „Du hältst doch auch Alchemie für irrational, warum betreibst du dann überhaupt Naturwissenschaft?“
Was also spricht für den Gott des christlichen Glaubens? Dazu enthalten viele Texte in diesem Buch wesentliche Argumente. Dabei lassen sich grundsätzlich zwei Typen unterscheiden: Typ 1: Argumente für den Theismus, also für einen personalen Schöpfergott, wie ihn das Christentum, aber auch das Judentum und der Islam beschreiben. Und Typ 2: Argumente speziell für den Glauben an den christlichen Gott.
Zu Typ 1: Hier ist der aktuelle Stand der Naturwissenschaften günstig. Zum Beispiel sind sich Naturwissenschaftler einig in der Beobachtung der sogenannten Feinabstimmung des Universums, also der Ausrichtung der Naturkonstanten auf die Möglichkeit der Entstehung des (menschlichen) Lebens hin. Diese Feinabstimmung ist in ihrer Passgenauigkeit so extrem unerwartet, dass z. B. die Erklärung durch einen extrem glücklichen Zufall wenig plausibel ist. Die Erklärung mit einem absichtsvollen Schöpfer ist hier dagegen durchaus plausibel (siehe Einwand 7).
Ein weiteres Indiz ist die gängige Theorie zur Entstehung des Universums, die Urknall-Theorie. Demnach hat das Universum einen Anfang. Alles, was anfängt zu existieren, hat aber üblicherweise eine Ursache. Wenn nun auch das Universum insgesamt einmal angefangen hat zu existieren, muss es ebenfalls eine Ursache haben. Und diese Ursache muss vor und außerhalb des Universums gelegen haben, weil sie ja schon vorher wirksam gewesen sein muss. Das deutet zwar nicht zwingend auf Gott hin, wie ihn Christen sich vorstellen, aber der Schöpfergott des Theismus ist hier eben ein naheliegender Kandidat. Denn auch er wird als Gegenüber gedacht und als jemand, der absichtsvoll handelt und dessen Handeln Konsequenzen hat. (Damit habe ich das sogenannte Kalam-Kosmologische Argument für Gott umrissen, wie es aktuell besonders von dem Religionsphilosophen und Autoren William L. Craig vertreten wird13, siehe Einwand 11.)
Zu Typ 2: Wichtige Argumente für die spezifisch christliche Vorstellung von Gott finden sich ebenfalls in anderen Teilen dieses Buches, etwa in den Texten zur historischen Glaubwürdigkeit der Jesusüberlieferung im NT allgemein (siehe Einwand 19–22, 28–32), zur Glaubwürdigkeit speziell der Botschaft von der Auferstehung von Jesus (siehe Einwand 23) sowie zum Anspruch von Jesus, Gott gleich zu sein (siehe Einwand 2, 16 u. 50).
Das alles sind Argumente für den Glauben an Gott, so wie er sich in Jesus zeigt. Es passt gut zusammen, ihnen zu folgen, sie für schlüssig zu halten und zugleich andere Gottesvorstellungen zurückzuweisen, wenn für sie eben keine vergleichbar guten Gründe angeführt werden können. Das gilt erst recht für Gottesvorstellungen wie die der griechischen und römischen Antike oder der Primärreligionen, für die keinerlei auch nur entfernt vergleichbaren Gründe angeführt werden können. In beiden Fällen, in der Entscheidung für die christliche Gottesvorstellung und gegen andere, kommen also die gleichen Kriterien für gute Argumente zum Zuge.
(Matthias Clausen)
4 Vgl. M. Clausen (2016): Ich denke, also bin ich hier falsch? Glauben für Auf- und Abgeklärte. S. 91.
5 Wer an dieser Stelle einhakt und sagt, dass er aber nur von dem ausgehe, wofür es eindeutige Gründe gibt, der sei darauf hingewiesen, dass wir im Alltag von vielem ausgehen, das wir nicht wirklich gut begründen können – schon gar nicht empirisch. Niemand von uns hat ein zwingendes Argument z. B. dafür, dass es Bewusstsein außer dem eigenen gibt, dass materielle Gegenstände auch dann noch da sind, wenn niemand hinschaut, dass die Welt schon länger als 15 Minuten existiert etc. All diese Überzeugungen sind nicht naturwissenschaftlich nachprüfbar – trotzdem ist es vernünftig, sie zu haben.
6 Dass der Mensch ein Bewusstsein hat, das ihn zum Erleben und Selbstreflektieren befähigt, ist in einem rein materiellen Universum nämlich weder erwartbar noch plausibel zu platzieren. Vgl. H. Tetens (2013): Der Naturalismus. Das metaphysische Vorurteil unserer Zeit?: https://t1p.de/i6w8 (Zugriff 07.09.2020).
7 Vgl. I. Hutchinson (2018): Can a Scientist Believe in Miracles? An MIT Professor Answers Questions on God and Science; W. L. Craig (2015): (Un)Begründet glauben? 5 Gründe für die Existenz Gottes und 3, warum sie zählen: https://youtu.be/yEKq1Kd_mjw (Zugriff: 07.09.2020); W. L. Craig (2017): theo:logisch. Warum der christliche Glaube vernünftig ist; S. Lange (42020): Begründet glauben. Denkangebote für Skeptiker und Glaubende; H. Tetens (2019): Gott und Mensch: https://youtu.be/PrAMoyRQhRM (Zugriff: 07.09.2020); T. Keller (2019): Glauben wozu? Religion im Zeitalter der Skepsis; W. Löffler (32019): Einführung in die Religionsphilosophie und natürlich auch C. S. Lewis (2016): Pardon, ich bin Christ.
8 Deismus: Gott hat zwar die Welt geschaffen, übt aber keinen weiteren Einfluss mehr auf sie aus.
9 Bahaitum: Im Mittelpunkt dieser Religion steht der Glaube an einen Gott und die mystische Einheit der Religionen. Neben ihren akzeptieren die Bahai auch die heiligen Schriften anderer Religionen.
10 Z. B. C. Keith (2019): The Reception of Jesus in the First Three Centuries; R. Riesner (2019): Messias Jesus. Seine Geschichte, seine Botschaft und ihre Überlieferung; N. T. Wright (22018): Jesus. Wer er war, was er wollte und warum er für uns wichtig ist. J. Schröter (2017): Jesus Handbuch; B. Pitre (2016): The Case for Jesus. The Biblical and Historical Evidence for Christ. J. D. G. Dunn (2003): Jesus Remembered: Christianity in the Making.
11 Siehe z. B. C. Lienemann-Perrin; W. Lienemann (2012): Religiöse Grenzüberschreitungen. Studien zu Bekehrung, Konfessions- und Religionswechsel; J. Zimmermann; A.-K. Schröder (22011): Wie finden Erwachsene zum Glauben? Einführung und Ergebnisse der Greifswalder Studie.
12 Hiermit sind Natur- bzw. Stammesreligionen lokaler ethnischer Gruppen gemeint.
13 Vgl. W. L. Craig (2017): theo:logisch. S. 52 ff. oder auch youtu.be/jUMUqwD_CJs (Zugriff: 07.09.2020).