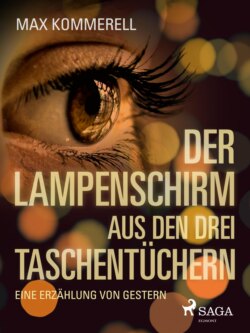Читать книгу Der Lampenschirm aus den drei Taschentüchern - Max Kommerell - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gott und die Geige
ОглавлениеEin zigeunermärchen
Zuerst schuf Gott eine Frau. Der Schmerz der Schöpfung war noch frisch in ihm. Er gedachte der herrlichen Zeiten, wo noch die Sonne in seinem Haupt war und die Sonnenblume aus der Erde seiner Schenkel wuchs, wo in seinem Haar die Sterne knisterten und Elefant und Kolibri sich in seinem Busen tummelten, so daß er kaum merkte, daß er Gott war – denn er war immer eins von denen drinnen, und auch ein anderes, das er lieb hatte oder verabscheute, das er schlug, umherstieß oder fraß, und nannte sich bald »mein Goldlotos« und duftete sich, oder »du verfluchte Brennessel« und brannte sich, und konnte sich entfliehen und sich wieder einholen in herzerquickender Vielgestalt. Da war nun freilich eine arge Leere. Wohl war jetzt alles da, und viel wirklicher da als vorher. Zum Beispiel die Rose. Die war ganz aus sich selbst, wie sie sein wollte, mit all ihren kleinen Launen. Ihr Stiel war nicht ganz gerade, ihr Kelch ein wenig zur Seite gebogen, die meisten Blütenblätter waren noch in der Schlankheit der Knospe gebunden, nur ein tiefergewölbtes hatte sich schon frei gemacht und hing und leuchtete. Auch bebte sie ein wenig, gleich der Luft; ja, man spürte es, Luft und Rose flüsterten miteinander, und Gott hätte gar zu gern gewußt, was die Rose da sagte, und was nicht. Denn eine junge Rose in einer Nacht, das ist nichts Kleines, und das war ja nun hinter ihr! Wie sie ihrer selbst gewiß war und »ich« duftete! Wie scharf sie sich ausschnitt vor dem Grün des Rasens und dem purpurnen Braun der Blutbuchen hinter ihr! So wohlbeschaffen und gelungen, daß sich das ernste Haupt Gottes auf sie herabneigte und eine Träne des Entzückens in ihren Kelch fiel. Die Rose hegte die Träne Gottes und wußte nichts davon. Ja, das war es, Gott hatte gut mit den Dingen reden, sie antworteten nicht. Und er besann sich, ob nicht doch irgendeines seiner Geschöpfe ihm antworten könne. Da kam ihm ein Gedanke: vielleicht die Frau! Und Gott beschloß, sie zu besuchen. Jeden Abend, wenn es kühl wurde, schlug er den weiten blauen Mantel um seinen Leib und besuchte sie. Auch sie hatte er längst gekannt, ehe er sie schuf. Damals hieß sie noch anders, nämlich: das Geheimnis der Spiegelung; und sie war immer dabei und waltete, wenn Gott in sich selbst Brunnen wurde und zu sich selbst heraufsah, und wenn er sich in solchen Augenblicken verwunderte, wie viele Rinnen das Unerschaffene durch sein Antlitz zog und wie er sich selbst ein Verbannter war, zu dem es ihn zu sagen drängte: komm, sei mein Gast! Daran gedenkend, besuchte er sie nun, und fand sie, wie sie gerade Pflanzen zähmte. Sie lächelte eine wilde Rebe an, und sogleich begann sich die Rebe in Kreisen, die nach oben enger wurden, langsam um sie zu bewegen, ja wand sich ihr wie eine zahme Schlange am Leib hinauf, näher, je mehr sie lächelte, und nicht anders als so gewann sie den herbsüßen Geruch ihrer heimlichen Blüte, den träumerischen Geschmack ihrer Frillen und den am Stock sich klärenden Saft ihrer Beere, die so viel vom Menschen weiß. Ein Ähnliches tat sie dem perlfarbenen Zittergras an, das von der wiederholten Berührung ihrer Lippen schweigend und wartend zur schweren, goldenden Ähre ward; und den wilden Mohn bog sie zu sich, strich über ihn, ihr eigenes Haupt mit geschlossenen Lidern hin und her wiegend, und teilte ihm so die schlaftrunkene Schwere ihrer Stirne mit, bis die Kraft in seinen Körnern wuchs, und so wurde sie Mutter der Gifte, der gabenreichen, ehe sie denn Mutter eines Menschen war. Gott fand sie, wie ihre Hände eben mit den Ranken von Wein und Efeu redeten; er legte den Arm um sie, daß sie im Schatten seines Mantels saß, und seine Rede regnete auf sie im Wind seiner Hand, und er klagte ihr seine Klagen. Sie aber erwiderte ihm beinahe trotzig: »Weißt du, daß die Geschöpfe auch über dich klagen? Gestern kam mir das Wildpferd und sagte: Ich bin das schnellste von allen, aber meine Seele ist noch viel schneller, warum hat mir Gott das Maß gesetzt? Zwar ist die Ebene meine Beute, aber aufstampfen möchte ich, daß sich die Erde öffnet, daß den stummen Wassern von meinem Hufschlag der Mund gelöst wird und daß die versteckten Feuer meinem zurückgeworfenen Hufe nachlecken, ja, daß alles unterirdische Gold sich zu schräger Bahn an die Sonne legt und ich auffahre, aus milchigen Wolkenböden Funken ziehend und von Stern zu Stern die Botschaft des Aufruhrs tragend? Aber jetzt ist nichts in mir frei als der Dampf, der aus meinen Nüstern bricht. – So sagte das Wildpferd. Aber die Nachtviole flüsterte mir, wie der berückende Mond ihr Inneres an sich ziehe, während die Wurzeln sie in die Erde festknoten, ja, daß sie nie, nie mit ihren Samtblättern als weichen Flügeln durch die Nachtluft rudern könnte ... Und nichts an mir ist frei als der Duft, der kleine, namenlose, der mir entströmt, ich weiß nicht wohin. – Und darum, weil du ihnen allen ein Maß gesetzt hast, dem Adler so gut als der Schnecke, darum verstocken sich dir die Geschöpfe und geben dir nicht mehr Antwort.« Derart sprach Gott mit der Menschenfrau und die Menschenfrau mit Gott, und sie folgte seiner Hand mit dem Blick, wie einem weissagenden Vogel, und hing noch lang, wenn er schwieg, an seiner Schulter, um die er den weiten blauen Mantel schlug.
Und eines Abends, als Gott wieder bei ihr war, fing sie zu schluchzen an und sagte: »Jetzt, o Gott, weiß ich nicht nur, was ich und was alle Geschöpfe wissen, sondern auch alles, was du selber weißt, weil du es mir Abend um Abend gesagt hast. Dies letzte aber ist bei weitem das Schwerste zu tragen. Denn sieh, Gott, du bist Gott und hältst es aus, dies alles zu wissen, ich aber bin nicht Gott!« Gott erschrak, denn von allen Vorwürfen, die je ein Geschöpf gegen ihn erhob, war dieser der bei weitem gerechteste. So sagte er denn: »Du sprichst wahr, und es ist Zeit, daß wir scheiden. Doch lasse ich dich nicht ohne einen Trost, nimm hier meinen Mantel und wickle dich die Nacht in seine Falten.« Und er gab ihr seinen Mantel und schritt davon, aufrecht und rüstig. Sie staunte, denn sie hatte geglaubt, er sei ein alter Mann; nun aber funkelten seine Schultern dunkelbraun gegen das finstere Blau einer großen Abendwolke. Sie war müd, ach wie müd, und dachte bei sich selber: was wird mich wohl ein Mantel trösten, und sollte es der Mantel Gottes sein!– Da sie aber fröstelte, wickelte sie sich wirklich in ihn ein. Sie mußte weinen, erst sanft, dann heftig und ohne Grenzen, so daß ihr Leib erschüttert wurde. Und als sie den Mantel Gottes ganz mit ihren Tränen getränkt hatte, schlief sie ein. Beim Erwachen aber war sie nicht mehr allein, sondern neben ihr ruhte der zweite Mensch, ein Mann, und schlief. Sie weckte ihn, und als ihre Blicke sich begegneten zu einem ersten Erkennen, vergaß sie das Wissen Gottes.
Nun war Gott sehr allein. Und da er mit sich zu Rate ging, wem er sich künftig anvertrauen könnte, schien ihm niemand geeigneter als ein riesiger Ahorn, der in der Mitte des Gartens stand. Und als wieder einmal sein Herz überging von der Sorge der Schöpfung, ging er zu diesem Baum und lehnte sich an ihn, vor Schmerz ringend, einer Schwangeren vergleichbar, wenn sie die ersten Wehen schütteln, und er umspannte den Leib des Ahorns und sagte und schluchzte und flüsterte und schrie all sein Leid in den Busen des Baumes, Abend um Abend. Bis der Baum mit dem Leid Gottes ebenso getränkt war wie vordem die Seele der ersten Menschenfrau. Und wie sie vordem Haupt und Hände bewegt hatte, so neigte er jetzt Wipfel und Gezweig und bewegte die Wipfel und Blätter durcheinander wie in einer Gebärde des Schlafes. Und wie einer Schlafenden dunkle Laute aus dem Mund kommen, so griff Schwermut in seine Zweige, und der Stamm ächzte mit beinahe menschlichem Schrei. Auch ohne Wind bewegte er sich, denn das ihm eingehauchte Leid Gottes atmete durch ihn als innerer Wind. Den Geschöpfen hieß er fortan der singende Baum. Und die Stunde, da er sang, die Stunde des singenden Baumes. Sogar die Oberfläche der Erde traf dieser Laut wie ein leises Fieber, so daß die Erdschlangen erstaunt aus ihren Höhlen krochen und ihre Häupter aufrichteten in die schwingende Luft.
Nun beschloß Gott, niemand mehr seinen Schmerz zu sagen. Eines Abends ging er wie von ungefähr an der Höhle vorbei, worin die beiden ersten Menschen waren. Da war es gar lieblich. Ein sanfter Hügel schwoll vor dem Eingang, von wo ein Quell entsprang; innen bedeckte Moos das Erdreich, von den Wänden hingen an großen Ranken Blüten, die lila Schlünde hatten und mit kleinen gelben Flecken getigert waren, großen Schmetterlingen ähnlich; der Eingang selbst war verhangen mit Ackerwinde und Jelängerjelieber. Gott aber sah hinein. Der Mann schlief, die Frau wachte. Und obwohl es ganz still blieb, merkte sie doch, daß das Auge Gottes einen Augenblick auf ihr geruht hatte. Sie merkte es daran, daß die Stille plötzlich selber zu horchen schien. Es war Dämmerung, nahe der Nacht. Sie richtete sich auf ihrem Lager in die Höhe und blickte starr nach dem Eingang, dann auf den Mann, der schlief. Sie lächelte, wurde ernst, schüttelte langsam das Haupt.
Bald entdeckte der Mann der ersten Menschenfrau, daß sie ihn zur Stunde des singenden Baumes verließ (es war dieselbe Stunde, da Gott sie früher zu besuchen pflegte) und sich unter diesen Baum setzte. Gewöhnlich blickte sie dann noch eine Weile nach ihrer Rückkehr drein wie abwesend und fand erst langsam das Wort wieder. Als müßte sie die Sprache Gottes verlernen und die Sprache der Menschen aufs neue lernen. Das alles merkte der Mann der ersten Menschenfrau, und also nahm er eine Axt, ging zu dem Baum und hieb ihn um. Der Baum schrie, nicht wie ein Mensch, sondern wie Gott selber, er war ja beinahe Gott, so wie das Echo beinahe die Stimme ist. Und als wüßte er, daß er nie mehr singen würde, drängte er die ganze Kraft seines künftigen Singens in diesen einen Schrei. So schrie der Baum, und so fiel er um. Und als er umfiel, sah es aus, als ränge in der bleichen Dämmerung ein großer Körper die Arme im Versagen seiner Kraft, und die anderen Bäume standen herum wie entsetzte Zeugen des Entsetzlichen. Dem Mann sträubten sich die Haare wie nach einem Mord und nach Schlimmerem als Mord, er warf die Axt weg und rannte, bis er die Hand nicht mehr vor dem Auge sah. Schon lang war die Menschenfrau herbeigeeilt. Sie griff mit ihren beiden Händen in die Wunde des Baums, legte ihren Busen an seine Leiche, und in törichter Hilflosigkeit löste sie ihr offenes Haar über der Stelle, wo die Axt geschnitten hatte, als gälte es da, Blut zu stillen oder Tränen zu trocknen. Und als sie vor langem Weinen tränenlos geworden war und ohne Sinn vor sich hin starrte, rührte der Mond mit seinen Strahlen an ihren Nacken. Sie fuhr zusammen, und als sie sich umwandte, da war es gar nicht der Mond, sondern Gott. Sie sagte: »So kommst du noch einmal zu mir, Gott?« Er nickte stumm. Sie deutete auf den Baum: »Weißt du das schon, Gott?« Er nickte stumm. Ihr war, als müßte sie an Gottes Hüfte fassen und tasten, ob der Schnitt, der den Baum zerhieb, nicht auch durch den Leib Gottes ging. Und zugleich war es ihr, als hätte der Mann, dessen Frau sie war, Gott getötet, und als müßte sie ihm gerade darum für immer angehören. – »Hast du keinen Trost, hast du keinen Trost?« fragte sie hastig und immer wieder. Gott aber sagte, indem er sich an ein seltsames Werk machte, zu dem Baum nicht zu ihr: »Jetzt kam dir die Stunde des Übergangs. Ich will dir aus dir selber ein Gefäß machen, ein Gefäß der Klänge, in das deine Seele hinübergeht. Als Baum bist du tot, aber in diesem Gefäß wird deine Seele leben, als Schlafende vorerst, aber zu ihrer Zeit als Wachende!« Was er nun schuf, das ging ihm leicht vonstatten und ohne die Mühe menschlicher Künstler, weil er mit dem Holz redete und es sich so und so zu fügen bat, so daß ohne Werkzeug alles unter seinen wunderbaren Händen wurde, wie er es wollte. Die Klänge des singenden Baumes bauten sich selbst ihr Haus aus dem Holz des Ahorns und entlehnten dem Schmerz Gottes die Maße der Wölbung. Und so hatte Gott die Geige erschaffen und ihr die sterbende Seele des Baumes eingeflößt – ihre Gestalt erinnerte an die Gestalt des Menschen. Aber sie war keine Geige, wie sie die Menschen haben, sondern Gottes Geige, die nur er erklingen lassen konnte. Denn seltsam war es mit ihren Saiten beschaffen. Gott sagte zur ersten Menschenfrau: »Ich dachte bei mir, daß die Strahlen der Sonne auf den Strahlen des Mondes spielen sollen. Aber nun will ich’s anders, und die Geige soll ein Zeichen sein, daß ich dir von meinem Haar geschenkt habe und du mir von deinem.« Und Gott befahl ihr, mit der Hand in sein Haar zu fassen, da wo es in dichten Büscheln aus der denkenden Form seiner Stirne quoll. Sie gehorchte mit Zittern und schloß ihr Auge vor Ehrfurcht. Und Gottes Stirn drückte sich schwer in ihre Hand, so schwer, als hielte sie die ganze Welt, und von selbst löste sich eine Strähne von seinem Haupt. Dann strich Gott ihr einmal und ganz sanft durch ihr offenes Haar, das ihm gleichfalls, wie der Baum eine reife Frucht, eine Strähne in seiner Hand ließ. Und Gott spannte das Haar der ersten Menschenfrau über den Steg der Geige und sein eigenes Haar über den Geigenbogen, strich mit ihm über die Saiten hin und spielte eine Melodie, die kurz war und das menschliche Herz mit Süßigkeit tötete. Es war ein Augenblick, der an Maß des Glückes dem langen Leiden gleichkam, zu dem die erste Frau des Menschen bestimmt war. Eine Gewalt verschloß ihr die Augen, sie selbst war ein kristallenes Meer, auf das ein glühender, goldener Sturm herabfuhr, es durchdrang mit purpurnem Licht, es hinauftrug auf brausenden Flügeln, bis es zuhöchst in durchsichtigem Äther zu funkelndem Rauch zerstäubte. Dann vergingen ihr die Sinne, und sie erwachte in die Zeit. –
Kurz vor diesem Einschnitt merkte man dem Inder eine gewisse Mühe an, während man vorher ganz vergaß, welch schwierige Arbeit er mit jedem Satz leistete. Englisch wie Deutsch sprach er gleich vollkommen, und wenn ein Unterschied in seiner Beherrschung beider Sprachen war, so dieser, daß er Englisch sprechend einen ausgebildeten Takt für den Sprachgebrauch zeigte, während sein Deutsch die Möglichkeit benutzte, in dieser Sprache aus ursprünglichem Begreifen eine eigene Wendung zu finden, ein Unterschied also, der beinahe mit den Sprachen selbst gegeben war. Auch half ihm merkwürdigerweise Beethoven zum Reden. Denn wenn er im übrigen dem neuen Erdteil fertigen Geistes gegenübertrat, so wurde er noch von zwei Erscheinungen hingerissen: vom Zauber des einfachen Liedes (das, wie angedeutet, ihn vor allem aus der englischen Dichtung ansprach) und von diesem deutschen Künstler. Das Lied war ihm die Verewigung der einmaligen und persönlichen Menschenstimme; dieser aber die Einsamkeit der Erde, die im Gebet eines Menschen, der ihr ganzes Geschick in sich nimmt, selber betet und ihr Gebet selber erhören muß. Besonders den letzten Quartetten verdankte er manche Tönung seines nicht immer flüssigen, aber eigenen Ausdrucks. – Jetzt eben hatte sein Sprachvermögen ungestört walten können, weil er sich bei gewagten Prägungen von der Zuhörerin bestätigt fühlte. Und wenn er plötzlich unsicher wurde, war es, weil sich die weniger ermunternde Hälfte seines Publikums in den Vordergrund schob. So blickte er nicht auf, denn er scheute den Anblick einer Uhr, die der Hausherr als eigentliches Symbol besitzenden Unverständnisses von Minute zu Minute herauszog und die nun, an seiner Männerbrust versteckt, gar ein kleines Läutewerk entsicherte, gerade als Dasa gesagt hatte: »Sie erwachte in die Zeit.« Diese Koinzidenz war freilich nicht wohltuend. Aber wie er an diesem Tag kaum die Freiheit hatte, etwas ganz zu verneinen, so folgte dem lästigen Nebenbei ein schönes auf dem Fuß. Ehe die Baronin über das läutende Gewissen des Mannes lächelte, war ihr Gesicht in einer wunderbaren Trunkenheit des Schmerzes zur Seite gebogen; nicht ohne ein wenig zu erschrecken, trat es in den ihr gewöhnlichen Ausdruck der geselligen Bereitschaft zurück. So wiederholte sich auf diesem Gesicht genau der Vorgang, der mit den Worten bezeichnet war: »Sie erwachte in die Zeit.«
»Artur, es ist nun einmal dein Schicksal, daß du dich keinem Genuß überlassen darfst.« »Ja, ja, die Sitzung um drei Uhr«, stieß der Angeredete hervor, und versicherte nach einem nicht ganz gebändigten Gähnen, ihm schiene dieser Gott ein recht sonderbarer Gott. »Auch der Mann läßt zu wünschen übrig. Der Baum war doch eine ganz harmlose Ablenkung; wie dumm, ihn abzuhauen. Na, wie lang ist es noch?« Und er sah dem Inder über die Schulter, der gefällig genug war, ihm den Einschnitt mit dem Finger zu zeigen. »Na, in zehn Minuten werden Sie es geschafft haben. So lang kann ich noch der erotischen Niederlage dieses fatalen Gottes assistieren.« Gehorsam übersetzte Dasa weiter; keine Rüdheit hätte ihn mehr davon abgebracht, vor der selbstlos lauschenden Frau seine Erzählung zu Ende zu bringen:
Ob das ihr Geschehene vor tausend Jahren oder eben erst geschah, wußte sie nicht. Denn es gibt kein Maß, das die Ewigkeit durch Fristen ausmäße. Aber eines wußte sie deutlich: daß der Mann, der diesen Baum gefällt hatte, in der Nähe auf sie wartete und sie ihm nichts von allem sagen würde, da sein Leben einfach war und ihres doppelt. Der gefällte Baum lag zu ihren Füßen, die Geige erklang bei jeder Berührung und war Mitwisserin. Unerkennbar verstellt, ins Weite entstellt war die Landschaft. Der Baum, der war die Mitte gewesen. Aber den Bach, der ihn in einem kleinen Bogen schüchtern-vertraulich umflossen hatte, der seine Wurzeln zu tränken, seine gezackten Blätter zu spiegeln gewohnt war – diesen Bach erkannte sie wieder, fern am Horizont als ein ab und zu erglitzerndes schmales Band; und die Birke, deren bräutlichen Schleier der heldenmütige Ahorn anzurühren schien, stand die jetzt nicht weitab und allein auf einem niedrigen Sandhügel? Und wo waren Feige und Zwergkürbis und ihr gleichverschwistertes Gegenüber Ulme und Rebe? In ganz verschiedenen Ländern vielleicht! Der Weg aber, der über Felsen und einen Teppich erlesenster Würzkräuter zur Höhle geführt hatte, der ging jetzt als Straße über das ferne Gebirg, ihr noch erkennbar an den alten Serpentinen. Was sich um sie herdehnte, das war der Rasen, wo die Wildpferde sich mit ihren Füllen getummelt hatten, geneckt von den Schwalben, die unter ihren erhobenen Hälsen hindurchkreuzten – aber jetzt war er eine endlose Steppe, an deren Rand man erst die Umrisse einiger Tiere gewahrte! Auch fehlte viel, daß Falter eine Wolke gebildet hätten und Blumen einen Wald; und wenn es Nacht würde, so würden auch die Sterne fremd und weither glänzen und nicht mehr innig durch das Laubwerk herabblicken, wie umgekehrte Blumenkelche. Wird sie die Länder der Erde im Geist zusammenfügen müssen wie die Bruchstücke eines zerrissenen Briefes? Denn ihr Garten, wo sie vorher mit ihrer Stimme vom einen End zum andern gereicht hatte, war Welt geworden und sie in ihr der unmerklichen Grille gleich, die in einer Furche der Erde nistet. Sie erhob sich, drückte die Geige an sich wie ein Kind und verbarg sie ihrem Mann und allen. –
»Nun, mein Wertester, geht’s mit dem besten Willen nicht länger, nicht wahr, Sie entschuldigen mich und lesen meiner Frau noch bis zum Schluß? Es ist ja noch Mokka da.« Dasas Schultern und die Wangen der Baronin wurden mit einem Tätscheln derselben fleischigen Hand beschenkt, worauf der Baron hinausstürmte und alsbald den selbstzufriedenen Laut seiner Hupe vernehmen ließ. Sie aber überraschte Dasa, ehe er fortfuhr, mit der Frage, was er denn vorher mit jener Hölle der ungetanen Taten gemeint habe. Er sann einen Augenblick nach. »Tag und Nacht könnte ich davon reden und finde jetzt kaum einen Beginn. Es gibt, jenseits von allem, was uns Recht und Unrecht heißt, die Wahrheit des Wesens. Sie geht hervor in der Zeit; ja, die Zeit ist gar nichts anderes als das Hervorgehen des Inneren. Es geht aber nicht hier hervor und dort nicht, noch ist das Hervorgehen in sein Belieben gestellt. Es muß hervorgehen, und das Inwendigste wird Hülle eines noch Inwendigeren, das hervorgeht. Diese Wahrheit, wonach die Rose Rose und der Skorpion Skorpion ist, ist für jedes Geschöpf unverletzlich; nur der Mensch kann sie verletzen.« Die Baronin antwortete rasch und scharf, indem sie sich eine Zigarette anzünden ließ und den Prediger dieser neuen Hölle ohne sonderliches Wohlwollen ansah: »Selbst wenn etwas Inwendiges litte und vor Qual daran stürbe, daß es nicht hervorgeht – ist es nicht besser so, falls es böse ist und zerstören würde?« »Wenn es nur stürbe!« rief er aus. »Es stirbt aber nicht, das ist so schrecklich als tröstlich. Inwendiges, das nicht hervorgeht, stirbt nicht, es verdammt sich. Es wird krumm und giftig, weil die Zeit ihr Werk an ihm nicht tun kann – die Zeit als die Gewalt, die Inwendiges nach außen kehrt. So kann es auch nicht sterben, das heißt: in die Inwendigkeit zurückgehen, sondern es wird schlecht und schließt sich vom Kreislauf aus.« Sie sah vor sich hin, zerdrückte den Rest der Zigarette und bat Dasa, die Erzählung zu Ende zu bringen. –
Nach langen Tagen träumte ihr, sie säße wieder ohne Trost auf dem Strunk des gefällten Ahorns, und Gott wäre ihr zur Seite. Weil er kein Wort sprach, dachte sie: dies ist der Abschied, und sie fragte: »Willst du mich in aller Ewigkeit nie wieder besuchen, Gott?« Gott antwortete: »Doch, aber ganz zuletzt, wenn du es nicht mehr gedenkst. Weil mir aber jede Gestalt zu klein ist, will ich dich besuchen in der kleinsten Gestalt.« Und am Abend desselben Tages, als der Mann der ersten Menschenfrau vom Acker heimkam, uralt, gebückten Ganges, taub, mit harten Zügen – das Gold des Abends lag auf seinen schwieligen Händen, und er merkte es nicht –; als die Frau ihm dann Brot und zu trinken reichte und Altknecht und Altmagd und Söhne und Töchter nebst den Söhnen und Töchtern der Knechte zusammensaßen und alle miteinander das Gebet gesprochen hatten, klopfte ein alter Landfahrer an den Laden – ein Zigeuner. Sie baten ihn herein: Willst du essen, willst du trinken, willst du ein Lager für die Nacht? Und sie nötigten ihn zu sitzen. Er legte die Hand auf den Tisch, und unter den vielen Händen, die schwer wie Steine auf dem eichenen Tisch lagen, waren seine feiner als die anderen und reicher an Rinnen und lasteten nicht. Als er der Menschenfrau gegenübersaß, erschrak sie und dachte an die im Traum gehörten Worte. Er antwortete auf keine ihrer gastlichen Fragen. Er fragte selbst: Habt ihr eine Geige? Sie sahen sich verlegen an. Keiner hatte je das Wort gehört. Aber die erste Menschenfrau verbarg ihre Bewegung, indem sie aufstand, nach der hinteren Kammer ging und aus einer Truhe das Ding holte, das der Fremde gemeint hatte, um es vor ihn auf den Tisch zu legen. Er nahm es. Und beim ersten Strich, den er tat, wußte sie, daß er Gott war, und ihr Gesicht glich dem Gesicht eines solchen, der innen ein Wort gefunden hat, das viele Rätsel lösen würde, es aussprechen will und es nicht mehr zu Ende sagen kann. Ihre Lippen formten Silben, aber ohne Laut. Sie schloß dabei die Augen und zuckte zurück mit der Stirn. Als ihr Mann und das Gesinde sich faßten, war alles geschehen.
Sie legten sie auf eine Trage und brachten sie in eine der unterirdischen Höhlen, in denen man damals die Toten aufzubahren gewohnt war, ohne daß Feuer an ihnen leckte, und ohne daß Erde sie begrub. Nach einiger Zeit hieß es dann: der Tote war angenommen. Dann war die Leiche nicht mehr da. Die Luft war rein vom Geruch der Verwesung. – Alle gingen mit. Unter dem Geleite befand sich auch ein ungeschicktes Kind, das die jüngste Magd geboren hatte, niemand wußte von wem. Sie war daran verstorben, und da die erste Frau des Menschen noch ein spätes Kind geboren hatte, nahm sie das fremde mit an die Brust. Ihm fehlte die Sprache. Mitunter fuhr es mit den Händen durch die Luft, als sähe es etwas, was die anderen nicht sahen, und als sollte man es erraten. Dies Kind beschloß den Zug auf eine sonderbare Weise. Es ahmte mit einem Holzscheit und einem dürren Reis, das es vor dem Herde aufgelesen hatte, das Geigen Gottes nach und hatte dabei unbewußt und ohne Ordnung zerstreute Töne auf den Lippen – solche, die es Gott hatte geigen hören. Es kehrte nicht mehr mit den Leuten zurück. Man dachte, es sei bei der Toten in der Höhle geblieben. So war es zuerst auch gewesen. Aber als es dort dunkler und dunkler wurde und sich schließlich ein großer Uhu stumm auf die Brust der Toten gesetzt hatte, ging es scheu hinweg. Nicht daß es sich fürchtete; es merkte, daß die Toten den Menschen nicht mehr gehören. Zurück mochte es nicht. Wohin es ging, weiß niemand, doch wurde es ein Anfang mächtiger Dinge. Es hatte nicht die Sprache, und es hatte nicht die Geige; nur die Sehnsucht hatte es, und erinnerte sich ganz allein von allen Menschen, die lebten, einiger Töne aus der Weise des singenden Baumes. So kam es, daß mit der Zeit sich allerlei Gebilde, die jenes erste und einzige Gebilde der Hände Gottes nachahmten, unter den Menschen fanden. Zwar war ihrer keines mit dem Haare der ersten Menschenfrau bespannt, noch wurde es mit dem Haupthaar Gottes gestrichen, aber die Menschen spielten schön darauf. Die aber so taten, hatten dunklere Haut und einen weicheren Gang als andere, ihre Haare waren wie Schlangen, ihre Augen länglich und ihre Finger frauenhaft, und sie kamen und gingen, wie Schatten kommen und gehen. Aus den Ordnungen der Menschen gestoßen, irrten sie von Stadt zu Stadt und nannten sich selbst die Diebe, die Gottes Töne gestohlen hatten. Aber niemand konnte ihnen die gebracht haben, als jenes stumme Kind. Nur wenige Töne freilich. Aber daher, daß sich einige wenige Töne aus der Weise des singenden Baumes unter die Töne der Menschen verloren, stammt alle Kunst. Und Meister sind die, deren Musik diese Töne sucht und, wenn sie einen findet, in ihn hinüberstirbt. Es sind nämlich Gottes Töne nicht da, damit sie vom Menschen gespielt werden, sondern damit sie von ihm gehört werden, und auch dies nicht, solange er lebt, sondern erst, wenn er stirbt. Und so sagen die Zigeuner: wenn ein Meister sterben solle, so neige sich Gott, den anderen unhörbar, mit feiner Geige zu ihm und geige ihm seine Weise ganz ins Ohr. –
Sie dankte ihm. »Ich will meinem Mann, so gut es mein leider schwaches Gedächtnis vermag, berichten, was er versäumen mußte. Heute abend denn, bei Frau Neander! Über Ihr Rätselwort habe ich mich noch nicht beruhigt. Erzählen Sie nicht zuviel Menschen von dieser Ihrer Hölle der ungetanen Taten. Ich glaube, das Eigene eines Menschen ist nur schön, wenn es aus Versehen zum Vorschein kommt.« Er wußte, daß sein Anteil an dieser Frau gering war und so bleiben würde, ja, daß sie ihm wohl beim Empfang offener war als jetzt, da er von ihr ging. Dennoch wurde ihm das Ganze dieser Stunden erst durch ihr letztes Wort vollkommen, und es war ewig in seinem Herzen, nachdem es, mit dünner Stimme gesagt, einen halben Augenblick die Luft erschüttert hatte. Er nahm es mit, es gehörte ihm von ihr, geistiger und berechtigter als ein Kleinod, das auf ihrer Brust geruht hatte.