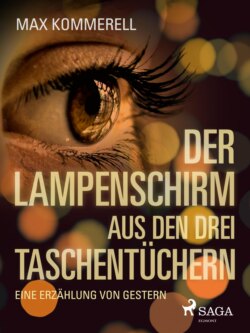Читать книгу Der Lampenschirm aus den drei Taschentüchern - Max Kommerell - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Vorwerk
ОглавлениеBewegt von diesem Wort ging er weiter, ziellos und doch gelenkt, nachdem sein Vertrauen auf den Zufall so schön belohnt war. Schöne Länge dieses Tages und dieser Wege! Die Weise vom Morgen her, die vom Gehen in den Straßen sprach, war wieder um ihn. Sie hatte recht. Er ging in Musik und vergaß die Zeit. Zuletzt mußte er ziemlich rasch gegangen sein. Aus einer großen weißen Wolke am sonst blauen Himmel traf ihn ein feiner Regenschauer. Der Mantel! Doch der war vergessen. Es war besser, unterzutreten. Die Häuser waren selten geworden, hier am Stromufer vor der Stadt freilich ragte wenige Schritte vor ihm in kreisrunder Ausbuchtung ein merkwürdiges Gebäude über den Strom, das Vorwerk genannt – eine vornehme, draußen gelegene Vergnügungsstätte. Wird er eintreten, oder hinaufgehen? Heute flogen nun einmal in seiner Phantasie Seelenbilder aus und ein; so drängte ihm dieses Teehaus, in dem es sogar eine Teekarte gab, die Vorstellung eines jungen Mannes auf, der Überfluß an Zeit hatte und es stark frequentierte. Er war wohl auch jetzt oben. Vinzenz hieß er, Vinzenz Feldner; vor Monaten hatte ihn dieser Vinzenz nach einem Vortrag gescheit und zutunlich ausgefragt und sich später durch Herzenseröffnungen in seinen Schutz begeben, ohne sich vorher nach seiner Willigkeit zu erkundigen. Dem Inder war der Leichtsinn versagt; er war denn Freund, so gut es ging, mit manchem stillen Seufzer. Hier also mochte Vinzenz vor nicht langer Zeit die Stufen hinaufgegangen sein, immer zwei zugleich nehmend; den beigefarbenen Mantel lose um die Schulter, die leeren Ärmel herabhängend – den Mantel, an dem seine beiden Drahthaarigen so gern zupften. Denn er lebte mit ihnen, um nie allein zu sein und doch auch keinem Gesellen Rede stehen zu müssen. Es war wenig über vier Uhr. Der Jazz hatte noch nicht begonnen. Das sprach für Hinaufgehen. War heute nicht Freitag? Da spielte Bruno, wie man den Kapellmeister nannte, der etwas mit Vinzenz befreundet war. Ihn sollte er hören ... vergeblich bekämpfte Vinzenz die Kälte Dasas gegen solche Versuchungen. »Du machst ein Gesicht, als setze man dir Negerblut mit Schlagsahne vor«, behauptete Vinzenz in den seltenen Fällen, wo Dasa einer solchen Kapelle ausgeliefert war. Das hier sei etwas Neues, eine kontrapunktische Behandlung des Jazz, höchste Geistigkeit der Wollust, und Dasa müsse ihr wenigstens einmal erlegen sein, ehe er sie ablehne ... Im Hinaufgehen sagte er sich: »Vinzenz ist im Grund ein Ruf um Hilfe. Das verbirgt er mit Anmut. Es wäre unrecht, seinem Lebensversuch ohne Nachsicht, ohne ein Lächeln der Neigung zuzusehen.« Er war oben, nahe dem Halbrund einer inneren Wand, die wie eine breite Säule das Treppenhaus in sich verbarg, und erblickte von dort aus einen oberen und einen unteren Halbkreis der Sitzenden. Dieser hing weiter über den Strom hinaus und hatte kein Dach. Doch fanden die Gäste unter aufgestellten bunten Schirmen Schutz genug und verließen ihre Sitze nicht; vermutlich würde in zwanzig Minuten wieder die Sonne scheinen. Kaum ließ er sich an einem Tisch nieder, ohne Befragen sogleich mit der ihm zusagenden Teesorte bedient, so erkannte er den ihm beschriebenen Kapellmeister daran, daß Vinzenz sich gerade von ihm verabschiedete. Er war zugleich der Saxophonist und saß nun, da das Spiel beginnen sollte, vor seiner am Notenpult angebrachten Klaviatur von farbigen Knöpfen, womit er später die wechselnde Lichtverteilung regeln wird und nun die Eintänzer verständigte. Er gab abgeschriebene Stimmen aus mit einem trübseligen Lächeln seines sinnlichen und etwas müden Mundes, und die einnehmende Herablassung, mit welcher er die paar Exoten, Slawen und Franzosen sowie den Deutschen am Klavier behandelte, der ein Dilettant war, Jurist von Beruf, – diese Herablassung erklärte ihm, wodurch Vinzenz an diesen Mann gekettet war. Wie es für starke Menschen den älteren Freund gibt, der ihnen körperhaft das Vorbild eigenen Werdens ist, so gibt es für schwächere den, der darstellt, wozu sie sich fürderhin verurteilt fühlen. Und der Mann mit dem gebräunten Teint des Skiläufers, der nicht viel hatte, aber immer elegant war, in braunem Rock über grauer Hose und in seidenem Hemd, der Mann, der auf eine so jugendliche Weise den Fünfzigern zuging, blickte wohl auf Vinzenz mit umgekehrter Wehmut: war er des Jünglings unentrinnbare Wirklichkeit, so war ihm der Jüngling seine unwiederholbare Möglichkeit. So tauschten sie ihre Glossen aus über Frauen und Kunstwerke. Sir Jazz, wie Vinzenz ihn nannte, war gebildet, ein Meister des Gesprächs. Die ganze, große bewegliche Gestalt war wie in sinnliches Feuer getaucht; stören konnten nur die Augen, die unsicher flackerten oder schweiften in einer Verlorenheit, für die er an anderen Rache zu nehmen doch zu vornehm war.
Die Töne, denen die Fürsprache des Jünglings bei Dasa Einlaß verschaffte, waren nicht unverfänglich. Durch ein weiches, leieriges, schleieriges Sumsen indistinkter Sumpfgeräusche blitzte das Thema des Saxophons auf und ab und hin und her gleich dem nadelförmigen Leib der Libelle ... Eine entnervende Melodie in Rhythmen von großer Spannweite. Würden vielleicht die Menschen auf diesem seltsamen Umweg darauf verfallen, daß es eine Musik aus vielen, nebeneinander regierenden Rhythmen gibt? Indessen erging sich sein Blick unter den Tanzenden und haftete an einem Mädchen, das er noch immer ungern mit Vinzenz zusammen dachte, obwohl sie als verlobt galten. Mit betonter Vertraulichkeit, die unter dreien nur dem angenehm war, der sie gewährte, hatte ihn Vinzenz unlängst zum Mitwisser ihres Einverständnisses gemacht. Sie hieß Irene, jedoch wurde sie »Waise« genannt, weil sie sich selbst schelmisch so bezeichnete, besonders bei Erwähnung ihrer Eltern, die, in verschiedenen Städten lebend, Freundschaft hielten und sich mit der Erziehung ihrer Tochter nicht übernahmen. Die begabte Mutter, von der Liebe und von der Kunst enttäuscht, hatte sich ganz zurückgezogen, der Vater, ein vielseitiger, verführerischer Weltmann, hatte im Unterschied zu anderen Vätern nur die eine Angst, seine Tochter möchte allzu mädchenhaft bleiben, und setzte sie daher jeder Versuchung aus. »Ist es fein von Eltern, ihre Kinder so gut zu kennen?« fragte sie manchmal gute Freunde. Sie selbst hatte ein kleines Amt in einem Institut für Erforschung der Naturvölker Südamerikas und nahm in zarten Nachzeichnungen ein Inventar der Besitztümer auf. Heimlich aber sang sie, beglückt und bedrückt; denn ihrer glockenreinen Stimme war der Umfang versagt. Sie hauste mit einer älteren Freundin, die ihr mehr als ergeben war. Überhaupt war sie für jeden, der sie näher kannte, bestrickend dadurch, daß sie sich aufs unbefangenste mitteilte und dabei ganz unberührbar blieb; sie nahm alles wörtlich und beantwortete jede Konvention mit dem feinsten Gefühl, jede Geste mit dem echtesten Ton.
Auch jetzt bemerkte er sie, nicht Vinzenz, mit dem sie tanzte. Hierbei fiel, ohne daß sie etwas Wildes oder gar Sinnliches angenommen hätte, von ihren Bewegungen alles Behindernde ab. Sie trug sich sonst nicht ganz gerade, aus einer gewissen Schwäche, auch war sie körperlich träg, und ihre Arme schienen beim Gehen nachzuhelfen. Erst im Tanz zeigte sich die Schönheit ihrer hochbeinigen Gestalt – sie nannte sich mit der ihr eigenen, drolligen Selbstverspottung »die Dame ohne Leib«. Besonders blickte ihr Dasa gerne nach, wenn sie sich drehte. Die abgeschnittenen Haare rollten sich im Nacken auf, an Ephebenköpfe erinnernd, auch von vorn war das Gesicht ein strenges, rundes Oval, an dem nichts hervorsprang. Der erste Eindruck war Fremdheit, die sogleich eine Sphäre um sich selbst hervorbrachte. Ging man zu näherer Betrachtung über, so überraschten die starken Backenknochen und der beim Lachen auffallend breite Mund, vor allem die Farbe der Augen: sie waren nicht blau, wie man nach dem schönen Aschblond ihres Haares erwartete, sondern gelbbraun und eher klein. Auch waren die Hände rundlich, gedrungen und nicht sehr gegliedert. Eben lachte sie im Gespräch. Er glaubte den reinen Klang zu hören. Erst im Lachen war sie eigentlich anwesend; ihr Körper war eine Botschaft aus der Ferne, ihre Stimme eine Bitte um Nähe. Dasa konnte sich nie Rechenschaft geben, was ihn an ihr so ergriff. Jetzt sagte er vor sich hin: »Es gibt keinen Ort und keine Zeit, die Seele stirbt nie. Wo sie hervortritt, ist sie herzbezwingend. Ist sie da, so scheuen wir ihre ferne Abkunft. Entschwebt sie, so ist uns, als ginge unser Eigenstes fort.« Er spürte eine wunderbare Schwäche und lehnte sich an eine Halbsäule der Wand, die aufquellende Träne hinter zusammengepreßten Lidern verbergend. Es war das Geschenk dieser Träne, daß es jetzt, da er das Auge wieder zu einem Spalt öffnete, nichts Einzelnes mehr gab, nur klangvolle Bewegung, ein silbergraues Wogen, das sich schied und wieder zusammenschlug um das helle Blau der einen Gestalt, deren Auftauchen und Schwinden das Maß aller Bewegung war. »Laß mich jetzt nicht, laß mich niemals durch mein Hinzutreten diesen Liebling Gottes verwirren«, betete er zu seinem Schutzgeist. Da wurde er angesprochen von Vinzenz: »Nun, habe ich dir zuviel gesagt von dieser Kontrapunktik des Jazz? Ich sehe, sie hat es dir angetan – so ekstatisch lehnst du an diesem Balken! Irene sieht dir schon länger zu, ich könnte es ihr übelnehmen. Du kommst doch an unseren Tisch, wir freuen uns so.«
Es geschah. Nach einer kleinen Pause fuhr Vinzenz heraus: »Nun bring deine Sache vor!« Irene half sich, wie immer, wenn sie nach Worten suchte, mit einem rührenden, halblauten Lachen, das langsam abklang. »Wir stritten darüber, ob Sie ... Vinzenz sagte nämlich ...« »Wenn du so um die Sache herumgehst, glaubt Dasa gar, du wollest ihm eine Liebeserklärung machen. Er wäre schon errötet, wenn er nicht zu braun dazu wäre.« Dasa fand dies alles nicht ermutigend. »Wenn ein Streit bis in den Tanz hinein dauert«, sagte er, »mag man ihn immerhin einem Dritten vorlegen.« »Irene ist eifersüchtig auf meine Verehrung für dich.« Dasa durchschaute sogleich diese Lüge und ersparte durch eine Handbewegung dem Mädchen, das sich schnell verteidigte, jeden Versuch dazu. Sie berichtete, sie habe Vinzenz gefragt, warum er Dasa so liebhabe, und er habe etwas geantwortet, was ihr mißfiel. Der Inder blieb stumm. Da gestand Vinzenz unerschrocken, er habe als Grund angegeben, daß Dasa ihn erlösen könne. – Wenn ein Wunder darin besteht, daß das Unmögliche geschieht, so war für Dasa eine vorfallende Unschicklichkeit wirklich ein Wunder. Das einzige Wunder, das es für ihn gab. Und solch ein Wunder geschah das zweitemal an diesem dämonischen Tag. Seine Natur war angegriffen, ja verneint, und von einem, der sie zu bejahen glaubte. Zugleich mußte er den hilflosen Jüngling schonen und durfte sich ihm kaum entziehen. Einen Augenblick fielen ihm die Lider herab, die Hände hingen schlaff. Vinzenz hielt dies fälschlich für gemacht und war gar nicht bußfertig. Da sagte Dasa leise und entschieden: »Das ist ein Wort, taktlos gegen den Geist, gegen die Sterne und gegen die heiligen Bücher. Daß du mich in dieses Wort verstrickt hast, verzeihe ich dir gern.« Vinzenz sagte verlegen: »Unter dreien, das fühle ich selber, nimmt sich das Wort anders aus als unter zweien.« Dasa ließ dies nicht gelten. »Sie ist gewohnt, was du sagst, anzuerkennen. Hier konnte sie es nicht, und da sie erfolglos bei dir gegen dich klagte, suchte sie einen Schiedsrichter.« »Mein heidnisch gesinnter Vater«, sagte die Waise, »erzog mich nicht gerade fromm. Aber ich nehme Anstoß, wenn man von etwas, das unter unsresgleichen vorgeht, so spricht, als ob es sich zwischen Christus und seinen Jüngern zugetragen hätte. Übrigens mißverstand Vinzenz vielleicht sich selbst. Er meinte wohl, Sie helfen ihm die Zeit verstehen, über deren Rätsel er öfters seufzt.« »Wenn ich schon fehl bin«, fuhr Vinzenz auf, »will ich auch ganz fehl sein. Warum alles historisch nehmen? Handelt Gott und handelt der Teufel nicht täglich in menschlicher Gestalt an uns? Kann nicht jeder bürgerliche Salon zur Schädelstätte werden? Und hat nicht jeder Schaffende Gewalt, zu taufen mit Wasser und Geist?« Als Dasa noch nachsann, wie er diese Verstandesspiele vereiteln könnte, sagte die Waise: »Ich finde, durch ein Wort, wie Vinzenz es gebraucht hat, macht man den Unterschied zwischen Mensch und Mensch zu groß.« Dasa erklärte, nichts Strengeres, nichts Gerechteres darüber sagen zu können. Vinzenz war ernst geworden. Er streckte ihm unvermittelt die Hand hin und wurde, als Dasa zögerte, glutrot. Dasa ergriff sie schließlich doch, und Vinzenz sagte: »Erlaube mir hie und da zu fehlen, damit mir der Gewinn deiner Zurechtweisung werde.« Irene war durch dies Wort gerührt: »Du meintest im Grund, daß in Dasas Gegenwart sich dein Wesen freier regt« – und nun neigte sie sich flüsternd Dasa zu –, »das Forcierte fällt dann von ihm ab!« Jetzt fand es Dasa schwerer, bescheiden zu sein; es war gar schön, aus diesem Mund dies Zeugnis zu erhalten. »Das kann freilich einem Menschen durch einen anderen geschehen. Aber es ist die höchste aller Wirkungen. Ich habe noch weit dahin. Es ist nötig, sich ganz zu beherrschen und sich frei wegzugeben. Man ist für die anderen ein Element, so durchsichtig, daß man nicht bemerkt wird.« Irene lächelte ihm zu: »Wir wollen nicht so bescheiden sein, daß wir uns gar nichts mehr sagen können. Für Vinzenz sind Sie das, und gewiß auch (sie hielt inne) für andere.« Dies »andere« betete Dasa ebensosehr an, wie er sich vor Vinzenzens unschicklichem Wort entsetzt hatte. Seine Kraft zum Widerspruch war gebrochen. »So darf ich der Gemeinschaft, die so wohltätig ist, vielleicht den rechten Namen geben: es ist die Gemeinschaft des Reflexes.« Beide sprachen ihm erstaunt diese Silben nach.
In diesem Augenblick fühlte sich Dasa von einem eisigen Hauch berührt. Er hatte das Bedürfnis, die Jacke zuzuknöpfen oder sich sonstwie in sich zurückzuziehen. Sogar ein Schluck aus der Teetasse schien ihm ein Schutz. Er drehte sich um und sah, wie sich eine der merkwürdigsten Erscheinungen der Stadt, ihm nicht ganz unbekannt, zuerst auf ihren Tisch hin, dann absichtlich daran vorbei bewegte. Vinzenz hatte ihm diesen Mann einmal auf dem Golfplatz gezeigt, oberhalb dessen sie beide auf einer offenen Terrasse aßen, und fragte ihn damals nach seiner Meinung. Ausnahmsweise zögerte Dasa nicht; sein Widerwille war augenblicklich und zwingend. »Wieviel unkindliche Menschen werden ihm erliegen, bis er an einem ganz kindlichen zugrunde gehen wird!« So hatte er gesagt. Der Gang jenes Mannes war geräuschlos, und so gelenkig wie sonst nur der Gang eines Tieres. Er trug einen grauen Frack, in der Hand einen gleichen Zylinder, und hielt an einer Koppel drei vollkommen schöne goldbraune Tschouhündchen, die aussahen wie kleine Zierlöwen. Er selbst nicht groß, zäh, elastisch, berühmter Reiter und Schlittschuhläufer; die Haut olivenfarben, das Auge dunkel und trostlos, das zurückgekämmte Haar aber, obwohl er wenig über vierzig schien, fast ganz weiß; nur eine Strähne, die hinter dem rechten Ohr lag, rief das Tiefschwarz der Jugend zurück. Er warf einen unverhohlenen Blick des Hasses auf Dasa. Dieser sah lieber zur Seite, voll Mitleid mit den Spitzern, die wohl manchmal von diesem Blick ihres Herrn träumen mochten; und während sich der verschmähende Zug der etwas vorstehenden Unterlippe verstärkte, ging er aufrecht und geradeaus blickend nahe an Vinzenz vorbei zur Treppe, als wüßte er, wie vor dem roten Samt der Wandbekleidung die hochmütige Stirn und gerade Nase ein Porträt machten. Als er die Treppe hinabgehend verschwand, konnte sich Dasa eines Lächelns nicht erwehren ob so öffentlich betonten Behagens an der eigenen Erscheinung. Dann erschrak er. Vinzenz, ihm gegenüber, war schneeblaß geworden und zitterte an Hand und Lippe. Leider war die Waise abgelenkt; sie hatte eine Freundin erblickt, die im gleichen Institut wie sie arbeitete, und ging zu ihr hin. Jetzt beugten sie sich beide über ein Aquarium, das neben einem kleinen, in eine Nische eingelassenen Springbrunnen mit Kühle, Schuppenglanz und Spiegelungen der längst wieder scheinenden Sonne erquicklich war. Vinzenz faßte sich, rückte nahe an Dasa heran und flüsterte rasch: »Höre schnell, ehe sie wiederkommt! Er hat mich stark (er suchte nach einem Wort) beeinflußt, stärker, als du denkst. Deine Bemerkung – neulich am Golfplatz, von der Kindlichkeit – rettete mich. Ich brach mit ihm, für immer, durch eine Zuschrift, die er heute früh erhielt und in seiner Eitelkeit nie vergeben wird. Nur mit dir kann ich jetzt diese Begegnung überstehen. Dank, Dank!« Auch wenn Dasa geantwortet hätte, wäre seine Antwort in dem hellen Gelächter Irenes untergegangen, die zum Tisch zurückkam und ein über das andere Mal sagte: »Nein, die prophetischen Fische! Nein, die prophetischen Fische! Kennt ihr beiden den reichen Rumänen oder Ungarn – ich weiß nicht, was er ist –, der das Schloß Groß-Bottnang gekauft und ein Observatorium hineingebaut hat? Er ging nämlich eben vorbei, ihr habt ihn wohl nicht gesehen, wir eigentlich auch nicht; wir sahen nur den Fischen zu, die friedfertig um den ihnen zugeleiteten Sprudel herumschwammen und sich so wenig streiften und störten, als wären sie Schatten. Plötzlich tauchte in der Wasserfläche das gespiegelte Profil dieses Mannes auf, der offenbar drei Schritte von uns entfernt die Treppe hinunterging, der Kopf, bloß der Kopf; aber der Kopf eines gefallenen Engels! Und über diesen ins Wasser gefallenen Engelskopf erschraken die Fische so, daß sie Reißaus nahmen. Seht ihr, solche Augen haben sie gemacht!« Und ihr gar nicht fischartiges Gesicht ahmte aufs lustigste die Verblüfftheit der Fischgesichter nach. »Kann das sein, oder habe ich’s mir eingebildet, und hat sie etwas anderes erschreckt, die prophetischen Fische?« Als sie sich gefaßt hatte, berichtete sie, ihr Vater sei ein paarmal bei ihm gewesen und habe abschließend geäußert: »Er weiß fast alles, aus allen Wissensgebieten, aber die Art, wie er mit dem Detail umgeht, verrät unausrottbare Halbbildung. Die Einrichtung ist ein Vermögen: unten hochmodern, erster Stock Renaissance, zweiter Stock Bauernmöbel und Volkskunst, Stickereien und alte Musikinstrumente. In seinem Arbeitszimmer hängen, sagte mein Vater, drei tolle Selbstbildnisse in Pastell. Das erste in einem lila Halbdunkel gehalten, zeigt ihn fünfundzwanzigjährig, aufrecht, von vorn, starren Blicks und gereckten Kinnes; vor ihm auf dem Tisch, auf den sich seine kleine Faust stützt, brennt ein Feuerzeug mit aufrechter Flamme, in das er eine Blume hält. ›Der Brandstifter‹ steht darunter. Zu dem zweiten hatte er sich nackt in einen Kartoffelsack gesteckt, was ihm vorzüglich stand, es heißt ›Der Prophet‹. Das dritte heißt ›Reife‹. In malerischer Hirtentracht hält er da einen Ährenstrauß vor sich hin.« »Einen Augenblick«, sagte Vinzenz, zog aus seiner Brieftasche drei Photographien, die mit dieser Beschreibung so ziemlich übereinstimmten, und gab sie Dasa, der nur einen müden Blick darauf warf. Aber das Lachen auf Irenes Mund verzog sich nun zu einem Schmollen, hierbei zeigte sich ein Ausdruck, über den sie bisweilen selbst so entrüstet war, daß sie sich vor dem Spiegel Ohrfeigen gab. »Ich habe einen Mund wie eine Weinbergschnecke.« So ihre Schönheit für einen Augenblick selbst vernichtend, bestritt sie nun ihren Freund: »Ich habe es immer geahnt, und du hast es mir verborgen. Sehr tief mußt du mit ihm zusammenhängen, sonst trügest du nicht diese lächerlichen Photos bei dir; im Grund ist dir dieser Hochstapler wichtiger als ich.« Dasa verbarg sein Aufhorchen, indem er die Bilder betrachtete. Also hier heftige Eifersucht, während Vinzenz ihm selber nach Lust anhängen durfte! Dieser, noch eben ganz nichts als weiche Dankbarkeit gegen sie, verhärtete sich; sie hätte, so dachte er, gegen einen dereinst von ihm geliebten Menschen nicht diesen wegwerfenden Ausdruck gebrauchen sollen. Er beschloß also, ihr von seinem Bruch nichts zu sagen. »Wie finden Sie diese Bilder?« fragte Irene den Inder, der aufsah und sagte: »Dieser Mann hat eine Leidenschaft zu sich selber, vielleicht ist sie der Schlüssel zu seinen Taten.« »Woher weißt du das?« sagte Vinzenz und verschlang ihn schier mit Blicken. Dasa: »Es ist nur eine Vermutung. Vielleicht wurde er sich schon als Knabe seiner Schönheit bewußt als eines Dinges, mit dem er gar nichts zu schaffen hat – eines ihm anhängenden Zaubers, den er begreifen lernte aus einer Kette seltsamster Wirkungen.« Vinzenz griff sich in etwas gemachter Weise vor die Stirn: »In der Tat, ich weiß von ihm selbst, daß seine junge Mutter zu ihm, als er sieben Jahre war, sagte: Du bist so rätselhaft schön, daß ich für dich sterben möchte. Als Dreizehnjähriger habe er eines Morgens vor seiner Tür den Leichnam eines Mädchens gefunden, das sich aus Liebe für ihn getötet hatte. Später sei er einer Schar von Aufständischen in einem gestohlenen Prinzengewand gezeigt worden als ihr künftiger König, worauf diese ohne Murren in den Tod zogen. Er ist weder Ungar noch Rumäne, sondern Grieche, heißt Kondylos und wurde, natürlicher Sohn eines Archimandriten, von einem sehr reichen Reedereibesitzer adoptiert. So erklärt sich auch der Ausspruch der Mutter, die ihn sehr jung gebar und nur selten und heimlich sah.« »Woher weißt du denn das?« fragte Irene, aber nicht sie, sondern Dasa wurde der Antwort gewürdigt, die er keineswegs begehrte. »Ganz Vertrauten teilte er einiges aus seinem sonst geheimgehaltenen Leben mit.« Die Waise störte ihn durch ein weiteres, wie ihm schien, unangebrachtes Wort. »Er soll eine Art Heiratsbüro haben.« Dasa lächelte ungläubig, aber Vinzenz eröffnete, daß der seltsame Mann in einem Flügel seines Schlosses Jünglinge, seine etwas maskuline Gattin im anderen Flügel Mädchen beherbergte, erzog und amüsierte – sei es, daß die jungen Menschen sich während der Ferien selbständig in diese Obhut gaben, sei es, daß sie ihr von befreundeten Familien anvertraut wurden. Man verfügte über Rennställe, Motorboote, Tennis- und Golfplätze, ja, die einzige Anstalt zum Polospiel war im Besitz dieses Kondylos. Die jungen Mädchen überwachten die Pflege der Polopferde oder wurden an Webstühlen zum Teppichwirken angeleitet. Auch sonst waren künstlerische Werkstätten aller Art vorhanden. »Ist es wahr (fragte Irene weiter), daß Frau Kondylos selbst die Muster entwirft, und zwar solche astrologischen Inhaltes?« »Ja«, sagte Vinzenz noch zurechtweisend, aber halb hinübergezogen, und wandte sich wieder zu Dasa: »Da seine Reichtümer unbegrenzt sind, führen die jungen Menschen dort ein Leben, das ihnen paradiesisch erscheint. Und da er, von Geld, Schönheit und Geist abgesehen, über andere, durchaus dämonische Mittel verfügt, kann er seinem Einfluß alles zumuten. Er darf es wagen, ihnen ihr Horoskop zu stellen und danach Bündnisse zu stiften, aus denen schon eine Reihe von Ehen hervorgingen.« In Irene stiegen die Tränen hoch. Vinzenz wollte eben dem Inder Einzelheiten über den größeren oder geringeren Anteil des Ehestifters an solchen Ehen zuflüstern, als er das unterdrückte Weinen Irenes bemerkte. Wie sehr bewegte es ihn! Schien es ihm doch das Weinen eines Geistes über sein Leben, und ihm war, als müßte er das Gewesene und das Künftige immer wieder verantworten vor diesem Geist, der stellvertretend für seine Verirrungen Strafe litt. Er widerrief den vorigen Entschluß und war aufrichtig gegen sie. »Irene, ich habe heute für immer mit diesem Mann gebrochen.« Zwar nicht den Seufzer der Erleichterung, aber doch jede Glosse hielt sie diesmal zurück: »Wie hast du denn das fertiggebracht?« »Dasa stand hinter mir, ohne es zu wissen.« Dasa mußte nun entdecken, daß auch er etwas zu verzeihen hatte. Vinzenz hielt es für unerheblich. »Er verlangte nämlich dein Horoskop oder wenigstens die Daten dazu.« »Nun, die wußtest du nicht, konntest sie ihm also auch nicht geben«, sagte Dasa, der sich eine unreine Aufmerksamkeit auf seine Person fernhielt. Da erinnerte ihn Vinzenz eines Gespräches, wo er ihm diese Angaben tatsächlich entlockt hatte. »Er stellte dir dann dein Horoskop, das ich mir nicht mitzuteilen bat. So weiß ich nur, daß er auf Grund dieses Horoskopes von mir forderte, auf deinen Umgang zu verzichten. Das Nähere (dies sagte er auf einen entrüsteten Blick Irenes) möchte ich für mich behalten. Jedenfalls bekam er von mir heute früh eine offene Postkarte, worauf die Worte: Werter Herr, Ihr astronomischer Turm ist ein Fingerhut, und ich kann mich nicht so klein machen, um mit Ihnen fürderhin dort Platz zu haben.« Dasa fand schon dies unartig, so flüsterte Vinzenz das Weitere nur Irene zu: »Ich halte mich lieber an einen, der das Sternengewölbe in seinen natürlichen Dimensionen erträgt.« Irene meinte: »Besser ihn auf unartige Weise loswerden als gar nicht«, worauf Kondylos für immer aus ihrer Unterhaltung schied.
Nichts ist wirksamer als ein neuer Begriff, der ohne Erklärung ausgesprochen wird. Er belebt, indem er zu raten gibt. So kamen jetzt auch die beiden jungen Menschen auf das Wort zurück, das sie vorher aus dem Munde Dasas traf, und baten um Aufschluß, was er mit der Gemeinschaft des Reflexes habe sagen wollen. Er erwiderte: »Man kann eine Person Jahre nicht mehr gesehen haben; das Gespräch bewahrt Abstand, bis man entdeckt, daß man sich irgend einmal nahe gewesen sein muß. Was war es nur? Endlich erinnert man sich, daß man einmal vier Stunden in einem Kahn hinter Schilf verborgen den Einfall von Wildenten auf einem See abwartete. Das scheint wenig. Aber man war in diesen langsamen Stunden Zeuge derselben Naturbegebenheit: des Erlöschens der Sterne, der ersten Röte und verschiedener, abgebrochener Laute, die man sich vorzählte – der schrille Ton des Rohrsängers, das kurze tonlose Glucksen des Wasserhuhns, aber auch Laute von nicht fernen Gehöften, wo ein Hahn kräht, ein Hund anschlägt. Jetzt, sagt man, stellen sich die Kühe im Stall auf die Füße. Schließlich legt die halb über den Rand ragende Sonnenscheibe scharf begrenzt einen waagrechten Streif über den stahlgrauen See. Das genügte, um für immer zwischen zwei oder drei Menschen, die sich noch eben fremd waren, die Gemeinschaft herzustellen, die ich die Gemeinschaft des Reflexes nenne. Sie ist die echteste und stärkste aller Gemeinschaften.« »Kann dergleichen nicht jedem von uns passieren?« »Nicht so ganz, lieber Vinzenz! Es gehört dazu, daß die Begebenheit in sich eine Weihe hat und daß diese Weihe von den Beteiligten in gleicher Weise empfunden wird. Dieser Reflex kann auch von einem begeisterten Wort herrühren, das gleichzeitig in zwei Seelen fällt. Ja, was die Stämme zu Völkern macht, ist im Grunde nichts anderes, als daß die Menschen zu Zeugen derselben großen Begebenheiten wurden.« »Seltsam«, sagte Vinzenz. Könnte man sich herzliche Unschuld des ganzen Wesens mit anmutiger Schelmerei in einem Gesicht gepaart denken, so wüßte man, wie die Waise jetzt ausah, als sie sagte: »Nun weiß ich, warum Vinzenz und ich so gute Freunde sind. Wir sind es als Zeugen einer schönen Begebenheit. Und unsere schöne Begebenheit sind Sie!« Kaum hatte er Zeit zu der Bemerkung, er hoffe, daß schönere Begebenheiten sie schöner zusammenfügen würden als diese höchst gemischte, denn Vinzenz rief ihm zu: »Verhülle dich noch so tief in deinen sieben Bescheidenheiten, ich merke dir dennoch an, daß du heute ein heimliches Fest begehst und Großes zu verschenken hast. Ich frage niemand nach seinen heimlichen Festen. Nur bitten muß ich dich um etwas; als Zeichen, daß du mir wirklich verzeihst, gewähre es mir. Laß uns beide heute abend da sein, wo du auch bist.« Erstaunt sah Dasa in das liebenswürdig zerstreute Knabengesicht, das jetzt einen einfachen, uneitlen Ausdruck hatte. Wird der Zufall heute alle die Einladungen, zu denen ich ermächtigt bin, an meiner Statt aussprechen? fragte er sich selbst, des grauen Blattes gedenkend, das sich am Morgen durch den Türspalt schob. »Nicht nur erfülle ich deine Bitte gerne, sondern ich hätte, wenn sie unterblieben wäre, euch beide um dasselbe gebeten. Heute abend nach Tisch also, bei Frau Professor Neander.« Und ehe sie sich’s versahen, hatte er beiden die Hände gedrückt und war hinweg.